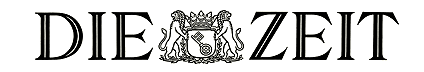
Other pages on Hannah Arendt in this site, here and here
Hannah Arendt, 100 Years Later
|
Why Arendt Matters by Elisabeth Young-Bruehl · Yale, 232 pp, £14.99
Hannah Arendt: The Jewish Writings ed. Jerome Kohn and Ron Feldman · Schocken, 640 pp, $35.00
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil by Hannah Arendt · Penguin, 336 pp, £10.99
Last year marked the centenary of Hannah Arendt’s birth. From Slovenia to Waco, conferences, readings and exhibitions were convened in her honour. This month, Schocken Books is issuing a new collection of her writings, its fifth publication of her work in four years. Penguin has reissued On Revolution, Eichmann in Jerusalem and Between Past and Future. And Yale has inaugurated a new series, ‘Why X Matters’, with Elisabeth Young-Bruehl’s Why Arendt Matters.
Arendt would undoubtedly have been pleased by all this. She didn’t like attention, but she did love birthdays. Birth meant the arrival of a new being who would, or could, say and do things no one had said or done before. The appearance of such a being, she thought, might move others to speak and act in new ways as well. There was always a certain pathos to this notion. Whatever its promise, birth is a fact of nature. And nature, Arendt insisted, is the sphere not of novelty or freedom but of repetition and routine.
Perhaps it was inevitable, then, that the centenary of Arendt’s birth should have devolved into a recitation of the familiar. Once a week, it seems, some pundit will trot out her theory of totalitarianism, dutifully extending it, as her followers did during the Cold War, to America’s enemies: al-Qaida, Saddam, Iran. Arendt’s academic chorus continues to swell, sounding the most elusive notes of her least political texts while ignoring her prescient remarks about Zionism and imperialism. Academic careers are built on interpretations of her work, and careerism, as Arendt noted in her book on Eichmann, is seldom conducive to thinking.
The lodestone of the Arendt industry is The Origins of Totalitarianism, published in 1951 and reissued by Schocken in 2004 with an introduction by Samantha Power. Divided into three parts – ‘Anti-Semitism’, ‘Imperialism’ and ‘Totalitarianism’ – the book was composed at two different times and evinces two conflicting impulses. Arendt wrote the first two sections in the early to mid-1940s, when Fascism was her fear and a federated, social democratic Europe her hope. She considered calling the book ‘Imperialism’ and the title of her intended conclusion, on the Nazi genocide, ‘Race-Imperialism.’
By the late 1940s, however, Arendt’s hope for postwar Europe had waned – it was a victim, as she had predicted in 1945, of the anti-Communist drive for collective security, which she compared to Metternich’s Holy Alliance – and the Soviet Union was her preoccupation. She wrote the last third of the book in 1948 and 1949, in the early years of the Cold War. Racism merged with Marxism, Auschwitz with the Gulag, and Fascism morphed into Communism.
This last section is the least representative – and, as historians of Nazism and Stalinism have pointed out, least instructive – part of the book. But it has always attracted the most attention. Young-Bruehl claims that the section on imperialism is of ‘equal importance’ to the one on totalitarianism, yet she devotes a mere seven scattered paragraphs to it. Samantha Power uses the last section to examine recent genocides, despite Arendt’s insistence that totalitarianism seeks not the elimination of a people but the liquidation of the person. And when Power tries to explain al-Qaida or Hamas, she also looks to the last section, even though Arendt’s analysis of imperialism would seem more pertinent.
Arendt saw totalitarianism as the product of mass society, which arose from the breakdown of classes and nation-states. Neither a political grouping nor a social stratum, the mass denoted a pathological orientation of the self. Arendt claimed that its members had no interests, no concern for their ‘wellbeing’ or survival, no beliefs, community or identity. What they had was an anxiety brought on by loneliness, ‘the experience of not belonging to the world’, and a desire to subsume themselves in any organisation that would extinguish their ‘individual identity permanently’. With their insistence on absolute loyalty and unconditional obedience, totalitarian movements filled this need: they fastened mass man with a ‘band of iron’, providing him and his fellows with a sense of structure and belonging.
Ideology and terror reinforced this grip. Racism and Marxism confined their adherents in a ‘straitjacket of logic’, lending the world a spurious consistency and relieving people of ‘the freedom inherent in man’s capacity to think’. By reducing men and women to the barest animal life, terror ensured that no one would resist ideology’s law of nature, in the case of Nazism, or history, in the case of Stalinism. Because ideology ‘may decide that those who today eliminate races’ – or classes – ‘are tomorrow those who must be sacrificed’, terror must ‘fit each of them equally well for the role of executioner and the role of victim’. The purpose of totalitarianism, in short, was not political: it did not fulfil the requirements of rule; it served no constituency or belief; it had no utility. Its sole function was to create a fictitious world where anxious men could feel at home, even at the cost of their own lives.
Arendt’s account dissolves conflicts of power, interest and ideas in a bath of psychological analysis, allowing her readers to evade difficult questions of politics and economics. We need not probe the content of a particular ideology – what matters is not what it says but what it does – or the interests it serves (they do not exist). We can ignore the distribution of power: in mass society, there is only a desert of anomie. We can disregard statements of grievance: they only conceal a deeper vein of psychic discontent. Strangest of all, we needn’t worry about moral responsibility: terror makes everyone – from Hitler to the Jews, Stalin to the kulaks – an automaton, incapable of judgment or being judged.
During the Cold War, Arendt’s text allowed intellectuals and officials to avoid any reckoning with the politics of Communism and its appeal. Today, it offers a similar detour. ‘If one could pierce the cloak of mystery that shrouds al-Qaida, Hamas or Islamic Jihad,’ Power writes in her introduction,
one might well find some of the qualities Arendt associated with totalitarian movements: ‘supreme disregard for immediate consequences rather than ruthlessness; rootlessness and neglect of national interests rather than nationalism; contempt for utilitarian motives rather than unconsidered pursuit of self-interest; “idealism”, i.e. their unwavering faith in an ideological fictitious world, rather than lust for power’.
Power makes the occasional nod to American policies in the Middle East and to terrorism’s local causes, but she cannot resist the psychological thrust of Arendt’s analysis: ‘Arendt wrote of German and Soviet selfless devotion to the idealised collective, but what greater testament to such selflessness can there be than martyrdom of the kind that thousands of young Muslim men and women are queuing up to undertake today?’
Young-Bruehl also believes that the anti-political ‘elements of totalitarianism have continued to be with us’. Unlike Power, she finds these elements on both sides of the war on terror: in militant Islam and neo-conservatism; in 9/11 and Shock and Awe; in the ‘supranationalism’ of bin Laden and Bush; in the Republican and Islamist push to submit the private sphere to public scrutiny.
But as virtually every intelligence analysis has shown, Islamist radicals are driven by hostility to the state of Israel and repressive Arab regimes, US patronage of Israel and those regimes, and, in Europe, discrimination against Muslims and support for US policies in the Middle East. Eliza Manningham-Buller, the head of MI5, recently said that British suicide bombers ‘are motivated by perceived worldwide and long-standing injustices against Muslims; an extreme and minority interpretation of Islam promoted by some preachers and people of influence; and their interpretation as anti-Muslim of UK foreign policy, in particular the UK’s involvement in Iraq and Afghanistan’. The Islamists’ grievances are local and specific. They are not the flotsam and jetsam of mass society or a globalised world; they come from and return to mosques, schools, parties and close-knit neighbourhoods. Suicide bombing is primarily a response to foreign occupation, and terrorism is, as it always has been, the weapon of choice for people with little power or no mass base.
The Bush administration is committed to the interests of its main constituencies: corporations, evangelicals, the military and big oil. It has revived the most toxic elements of American nationalism – not supranationalism – and though neo-conservatives may savour war for its own sake, Bush has folded their ethos into the rhetoric of national security and human rights. His party’s intrusions into the family and sexuality don’t reflect a general desire to dissolve the public and the private – Republicans happily respect the freedoms of employers – but are rather an effort to shore up the power of husbands and fathers. Whatever one may think of these warring antagonists, it is difficult to see how their aims are anything but political, their weapons anything but strategic and rational.
By the Cold War’s end, Arendt’s account of totalitarianism had been so trashed by historians that Irving Howe was forced to defend her as essentially a writer of fiction, whose gifts for ‘metaphysical insight’ enabled her to see the truth that lay beneath or beyond the verifiable facts. ‘To grasp the inner meaning of totalitarianism,’ Howe wrote in 1991, ‘you must yield, yourself, a little imaginatively.’ That fiction is again in vogue, but where once it was passed back and forth between intellectuals and officials, today it appeals primarily to the belligerati, who ignore the more informed analyses of Manningham-Buller or the former CIA officer Robert Baer.
If Arendt matters today, it is because of her writings on imperialism, Zionism and careerism. Composed during the 1940s and early 1960s, they not only challenge facile and fashionable applications of the totalitarianism thesis; they also eerily describe the dangers that the world now faces. By refusing to reckon with these writings, the journalists, intellectuals and academics who make up the Arendt industry betray her on two counts: they ignore an entire area of her work and fail to engage with the unsettling realities of their own time. The latter would not have surprised Arendt: empires tend to have selective memories. The history of ‘imperialist rule’, she wrote at the height of the Vietnam War, ‘seems half-forgotten’, even though ‘its relevance for contemporary events has become rather obvious in recent years.’ America was so transfixed by ‘analogies with Munich’ and the idea of totalitarianism that it did not realise ‘that we are back, on an enormously enlarged scale . . . in the imperialist era.’
In the second section of The Origins of Totalitarianism, Arendt argues that imperialism’s animating impulse is expansion for expansion’s sake. Against the claims of some Marxists, she insists that capitalism provides a model, not a motive, for the imperialist, who patterns the acquisition of power on the accumulation of capital. The capitalist sees money as a means to more money. The imperialist sees every conquest as a way station to the next. Cromer looked at Egypt and saw India, Rhodes looked at South Africa and saw the world. ‘I would annex the planets if I could,’ he said. So it is today: Afghanistan leads to Iraq leads to Iran leads to who knows where? ‘The famous domino-theory’, Arendt wrote, is ‘a new version of the old “Great Game”’. As Kipling said, the Great Game finishes only ‘when everyone is dead’.
Despite its claims during the Cold War, Arendt argued, the United States was never threatened by Communism. World War Two had made the US ‘the greatest world power and it was this world power, rather than national existence, that was challenged by the revolutionary power of Moscow-directed Communism.’ I wonder what Arendt would have said about Islamist terrorism, which poses even less of a threat to America’s survival.
She was also sceptical of imperial professions of benevolence, and during the Cold War mocked both superpowers’ ‘hollow assurances of good intentions’. And though she had much to say about the threat to human rights from an international system that prized sovereignty above all else (a point Power discusses at length), she had little patience for great powers insisting on limiting the sovereignty of weak states while refusing to accept any comparable limitation on their own (a point Power never mentions). Few developments bred more cynicism and contempt for human rights than this double standard.
More important, the language of moral responsibility and humanitarian concern in the 20th century reminded Arendt of the racism that was ‘the main ideological weapon of imperialistic politics’ during the 19th. The British Empire achieved the most successful combination of racism and responsibility and thus served as an instructive example for the American. Arendt identified Burke, arguably Britain’s greatest critic of imperialism, as one of the empire’s subterranean inspirations. Against the Jacobins, Burke insisted that there were no Rights of Man, only the rights of Englishmen. That union of inheritance and freedom, Arendt believed, turned Britain into a ‘kind of nobility among nations’ and was ‘the ideological basis from which English nationalism received its curious touch of race-feeling’.
In the 19th century, Burke’s successors turned his criticism of messianic liberalism into a charter for racist imperialism. With their notion of a ‘national mission’, which had ‘a peculiarly close affinity to race-thinking’, British imperialists sought to export the rights of Englishmen to the rest of the world. Imagining themselves as ‘dragon-slayers who went enthusiastically into far and curious lands to strange and naive peoples to slay the numerous dragons that had plagued them for centuries’, colonial administrators and secret agents – the empire’s emblematic figures – took on ‘a responsibility that no man can bear for his fellow-man and no people for another people’: to protect those who are ‘hopelessly one’s inferiors’.
For a while, it seemed as if today’s rhetoricians of empire had dropped racism from the language of responsibility. But the quagmire in Iraq has reversed that. ‘Arab societies can’t support democracy as we know it,’ says Ralph Peters, a retired US army officer and prominent columnist. Rather than build a liberal society, the Iraqis ‘preferred to indulge in old hatreds, confessional violence, ethnic bigotry and a culture of corruption’. According to the New York Times columnist David Brooks, after the fall of Saddam the Iraqis succumbed to their native ‘demons: greed, blood lust and a mind-boggling unwillingness to compromise . . . even in the face of self-immolation’. Liberal hawks such as Leon Wieseltier believe much the same thing:
The security situation is at bottom the social-cultural situation. It seems increasingly clear to me that the blame for the violence in Iraq, and for its frenzied recoil from what Fouad Ajami hopefully called ‘the foreigner’s gift’, belongs to the Iraqis. Gifts must not be only given, they must also be received . . . For three and a half years, the Iraqis have been a free people. What have they done with their freedom? . . . After we invaded Iraq, Iraq invaded itself.
Looking back on 12 years of Nazi waste and ruin, Arendt wrote in 1951: ‘There is hardly an aspect of contemporary history more irritating and mystifying than the fact that of all the great unsolved political questions of our century, it should have been this seemingly small and unimportant Jewish problem that had the dubious honour of setting the whole infernal machine in motion.’ There was something outlandish about the discrepancy between the size and significance of European Jewry and the war that resulted from the animus against it. Yet this would not be the last time that the world’s oldest pariah would be the focus of international attention.
Though Arendt had a long, often sympathetic involvement in Zionist politics, she was wary of the project almost from the start. ‘I find this territorial experiment increasingly problematic,’ she wrote in a 1940 letter, just one of the fascinating documents gathered by Jerome Kohn and Ron Feldman in their splendid collection of Arendt’s Jewish writings, many of which have been translated for the first time. In 1948, she confessed to her complete ‘opposition to present Zionist politics’. Her opposition was rooted in three concerns: the correspondence she saw between Zionism and Fascism, the Zionists’ dependence on imperialism, and her growing awareness of what she called ‘the Arab question’.
Of all the co-optations of Arendt for contemporary political purposes, none is more outrageous than the parallel, drawn by Power and others, between Palestinian militants and the Nazis. Arendt firmly rejected that analogy (in a 1948 letter to the Jewish Frontier), and few of the protagonists in the struggle over Palestine so reminded her of the Nazis as the Zionists themselves, particularly those of the Revisionist tendency, whose influence Arendt was among the first to notice.
From its inception, Arendt argued, Zionism had exhibited some of the nastier features of European nationalism. Drawing ‘from German sources’, she wrote in 1946, Herzl presumed that the Jews constituted neither a religion nor a people but an ‘organic national body’ or race that could one day be housed ‘inside the closed walls of a biological entity’ or state. With its insistence on the eternal struggle between the Jews and their enemies, she wrote in the 1930s, the Zionist worldview seemed ‘to conform perfectly’ to that of ‘the National Socialists’. Both ideas, she added in 1944, ‘had a definite tendency towards what later were known as Revisionist attitudes’.
Initially a minor current, according to Arendt, Revisionism poured into the Zionist mainstream in the 1940s. The Revisionists knew what they wanted and used guns to get it. Far from denying them legitimacy, their violent audacity provoked only token disapproval from mainstream Zionists, who secretly or unwittingly supported their initiative. Revisionist violence spoke to a new dispensation among the Jews, which Arendt described in ‘The Jewish State’. After centuries of settling for ‘survival at any price’, the Jews now insisted on ‘dignity at any price’. Though Arendt appreciated the shift, she also detected a secret death wish in the spirit of machismo: ‘Behind this spurious optimism lurks a despair of everything and a genuine readiness for suicide.’ Many Zionists, she claimed two years later, would rather go down with the ship than compromise, fearing that compromise would send them back to the humiliating days of silent suffering in Europe.
In 1948, the leader of Herut, Israel’s Revisionist party, travelled to America. Arendt drafted a letter of protest to the New York Times, which was signed by Einstein, Sidney Hook and others. Herut was ‘no ordinary political party’, she wrote. It was ‘closely akin in its organisation, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties’. It used ‘terrorism’, and its goal was a ‘Führer state’ based on ‘ultra-nationalism, religious mysticism and racial superiority’. The letter also decried those ‘Americans of national repute’ who ‘have lent their names to welcome’ the Herut leader, giving ‘the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel’. The leader of Herut was Menachem Begin.
The second failing of Zionism, according to Arendt, was that its leaders looked to the ‘great powers’ for support rather than to their future neighbours. Her disagreement here was both moral – ‘by taking advantage of imperialistic interests’, she wrote in 1944, the Zionists had collaborated ‘with the most evil forces of our time’ – and strategic. At the very moment that imperialism was being challenged throughout the world, Zionism had attached itself to a universally maligned form. ‘Only folly could dictate a policy that trusts distant imperial power for protection, while alienating the goodwill of neighbours,’ she wrote. In a 1950 essay, she declared that Zionists simply ignored or failed to understand ‘the awakening of colonial peoples and the new nationalist solidarity in the Arab world from Iraq to French Morocco’. Self-styled realists, they were profoundly unrealistic. They ‘mistook decisions of great powers for the ultimate realities’, she wrote in 1948, when ‘the only permanent reality in the whole constellation was the presence of Arabs in Palestine.’
Arendt did allow for one imperial future, however. ‘The significance of the Near East for Britain and America,’ Arendt wrote in a 1944 article entitled ‘USA – Oil – Palestine’, ‘can be expressed nowadays in a single word: oil.’ With America’s reserves dwindling, control over the world’s oil supply would ‘become one of the most important factors in postwar politics’. After the war, America would control roughly half the world’s shipping, and ‘that fact alone will force American foreign policy to secure its own oil hubs.’ Because of Europe’s reliance on Arab oil, she added, ‘America’s future influence on intra-European matters will depend to a large extent’ on its control over an intended pipeline in the Middle East. Though she hoped that America would not pursue an imperial policy, she had no doubt that oil would be a key factor in its deliberations. And with Israel responsible for the ‘caretaking of American interests’ in the Middle East, she wrote in ‘Zionism Reconsidered’, ‘the famous dictum of Justice Brandeis would indeed come true: you would have to be a Zionist in order to be a perfect American patriot.’
While Arendt had worried about Zionism’s darker tendencies and imperial dalliances from the beginning, her awareness of the Arab question came slowly. By 1944, however, she had come to see it as the ‘most important’ challenge. Without ‘Arab-Jewish co-operation,’ she wrote in 1948, ‘the whole Jewish venture in Palestine is doomed.’ Zionism left the Palestinians with no options other than emigration or ‘transfer’, which could be accomplished only using Fascist methods, or second-class status in the land of their birth. This last option, she remarked in 1943, assumed ‘that tomorrow’s majority will concede minority rights to today’s majority, which indeed would be something brand new in the history of nation-states’. In the mid-1940s, she warned that the Arabs would soon ‘turn against the Jews as the Slovaks turned against the Czechs in Czechoslovakia, and the Croats against the Serbs in Yugoslavia’. ‘In the long run,’ she added, ‘there is hardly any course imaginable that would be more dangerous.’
Many people believe that great crimes come from terrible ideas: Marxism, racism and Islamic fundamentalism gave us the Gulag, Auschwitz and 9/11. It was the singular achievement of Eichmann in Jerusalem, however, to remind us that the worst atrocities often arise from the simplest of vices. And few vices, in Arendt’s mind, were more vicious than careerism. ‘The East is a career,’ Disraeli wrote. And so was the Holocaust, according to Arendt. ‘What for Eichmann was a job, with its daily routine, its ups and downs, was for the Jews quite literally the end of the world.’ Genocide, she insisted, is work. If it is to be done, people must be hired and paid; if it is to be done well, they must be supervised and promoted.
Eichmann was a careerist of the first order. He had ‘no motives at all’, Arendt insisted, ‘except for an extraordinary diligence in looking out for his personal advancement’. He joined the Nazis because he saw in them an opportunity to ‘start from scratch and still make a career’, and ‘what he fervently believed in up to the end was success.’ Late in the war, as Nazi leaders brooded in Berlin over their impending fate and that of Germany, Eichmann was fretting over superiors’ refusing to invite him to lunch. Years later, he had no memory of the Wannsee Conference, but clearly remembered bowling with senior officials in Slovakia.
This aspect of Arendt’s treatment of Eichmann is often overlooked in favour of her account of the bureaucrat, the thoughtless follower of rules who could cite the letter of Kant’s categorical imperative without apprehending its spirit. The bureaucrat is a passive instrument, the careerist an architect of his own advance. The first loses himself in paper, the second hoists himself up a ladder. The first was how Eichmann saw himself; the second is how Arendt insisted he be seen.
Most modern theorists, from Montesquieu to the American Framers to Hayek, have considered ambition and careerism to be checks against, rather than conduits of, oppression and tyranny. Arendt’s account of totalitarianism, too, makes it difficult to see how a careerist could survive or prosper among Nazis and Stalinists. Totalitarianism, she argued, appeals to people who no longer care about their lives, much less their careers, and destroys individuals who do. It preys on the dissolution of class structures and established hierarchies – or dissolves those that remain – and replaces them with a shapeless mass movement and a bureaucracy that resembles an onion more than a pyramid.
The main reason for the contemporary evasion of Arendt’s critique of careerism, however, is that addressing it would force a confrontation with the dominant ethos of our time. In an era when capitalism is assumed to be not only efficient but also a source of freedom, the careerist seems like the agent of an easy-going tolerance and pluralism. Unlike the ideologue, whose great sin is to think too much and want too much from politics, the careerist is a genial caretaker of himself. He prefers the marketplace to the corridors of state power. He is realistic and pragmatic, not utopian or fanatic. That careerism may be as lethal as idealism, that ambition is an adjunct of barbarism, that some of the worst crimes are the result of ordinary vices rather than extraordinary ideas: these are the implications of Eichmann in Jerusalem that neo-cons and neoliberals alike find too troubling to acknowledge.
Corey Robin teaches political science at Brooklyn College and the Graduate Center of the City University of New York. He is the author of Fear: The History of a Political Idea.
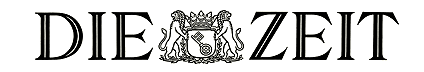
DIE ZEIT, 12.10.2006 Nr. 42
Das hätte nie geschehen dürfen
Neue Bücher über Hannah Arendt und bisher unbekannte Texte zeichnen das Bild einer leidenschaftlichen Denkerin und ratlosen Moralphilosophin.
Von Ludger Lütkehaus
Detlev Schöttker/Erdmut Wizisla (Hrsg.): Arendt und Benjamin
Texte, Briefe, Dokumente; Suhrkamp Verlag, 2006; 210 S., 11 €
Thomas Wild: Hannah Arendt
Leben, Werk, Wirkung; Suhrkamp Basis-Biographie, 2006; 160 S., 8,20 €
Julia Schulze Wessel: Ideologie der Sachlichkeit
Hannah Arendts politische Theorie des Antisemitismus; Suhrkamp Verlag, 2006; 248 S., 10 €
Hannah Arendt: Über das Böse
Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik; übers. v. U. Ludz; Nachwort von F. Augstein; Piper Verlag, 2006; 200 S., 19,90 €
Vier Wochen nach der Selbsttötung Walter Benjamins am 26. September 1940 in Port Bou schreibt Hannah Arendt an dessen Freund Gershom Scholem: »Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde.« Wenige Tage vorher hatten sich Arendt und »Benji«, seit der Emigration nach Frankreich »sehr nahe befreundet«, auf der Flucht in Marseille gesehen. Ein Jahr später wird in einem weiteren, bisher ungedruckten Brief an Scholem die Vorgeschichte der Selbsttötung geschildert: die Anzeichen für die sich verstärkenden suizidalen Impulse Benjamins, genährt von einer aussichtslos erscheinenden beruflichen und politischen Situation, einer panischen Angst vor der nächsten Station des Exils, den Vereinigten Staaten.
Das Grab des »verscharrten Juden« Benjamin in Port Bou kann Hannah Arendt nicht finden; »nirgends stand sein Name, schneidend die Dissonanz zu der phantastisch schönen« Lage des Friedhofs. Dieser Brief wird zu einer Abrechnung: mit Max Horkheimer und vor allem Theodor W. Adorno, der »Schweinebande« des Instituts für Sozialforschung, die Benjamin auf ihre Lesart eines »dialektischen Materialismus« festlegen wollte. Durchaus ökonomie- und basisnah geht es – so jetzt die Herausgeber einer höchst spannenden Dokumentation, Detlev Schöttker und Erdmut Wizisla – um »intellektuelle Maßregelungen« und »finanzielle Abhängigkeiten«. Noch in der zögernden Drucklegung der Benjaminschen Nachlasstexte, zumal der Arendt anvertrauten Geschichtsphilosophischen Thesen, drückt sich nach ihrem Urteil die bestenfalls halbherzige Unterstützung Benjamins aus. 25 Jahre später, bei der Publikation der Benjamin-Briefe, wird der Streit endgültig eskalieren.
Der Ton ist nicht nur, wie stets bei Hannah Arendt, unverblümt, er ist schroff, wütend, bis zur Maßlosigkeit ungerecht, aber immer genährt von einer konzessionslosen Loyalität zum toten Freund. Arendts geliebter zweiter Mann Heinrich Blücher porträtiert in einem Brief aus derselben Zeit eindrucksvoll ihren Zorn: Es ist »verständlich genug, dass Du erschrickst, herrlich, bezaubernd und süß, aber wie Du es tust, nämlich mit der blitzschnellen Reaktion Deiner prächtigen Wut«. Die Leidenschaftlichkeit ihres Temperaments, ein nicht einschüchterbarer Mut, der sie zu einer Inkarnation der Zivilcourage macht, die Geradlinigkeit ihres Charakters verbinden sich mit einem nicht minder leidenschaftlichen intellektuellen Engagement.
Es gab nicht nur ein Werk, sondern auch ein Leben nach Heidegger
Auch in ihrem Werk kühlt Hannah Arendt ihr Temperament nur wenig herunter. Neben der bekannten ist zu ihrem 100. Geburtstag freilich auch eine unbekanntere Autorin zu entdecken. Arendt ist als politische Philosophin berühmt geworden. Ihre großen Werke – Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951), Vita activa oder Vom tätigen Leben (1958), Über die Revolution (1963), Eichmann in Jerusalem (1963) – stützen diese Lesart. Aber schon ihre Anfänge führen in eine andere, existenzphilosophische Richtung, zumal die bei Karl Jaspers entstandene Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustin, die sich indes mehr der Liebesbegegnung mit Martin Heidegger, ihrem ersten Lehrer, verdankt. Man muss aber daran erinnern, dass Hannah Arendt nicht nur ein Werk, sondern auch ein Leben nach Heidegger gehabt hat.
Im Anschluss an die Impulse ihrer Dissertation zeichnet sich seit dem 1950 begonnenen Denktagebuch eine Philosophie ab, die zur Grundlegung von Arendts politischem Denken wird: die Philosophie der »Gebürtlichkeit«. Heideggers »Sein zum Tode« stellt sie das »Sein von Geburt«, der »Mortalität« die »Natalität«, der »Endlichkeit« die »Anfänglichkeit«, der »Geworfenheit« die freie Spontaneität des Handelns gegenüber. In jeder Geburt beginnt ein »Jemand«, der im Handeln etwas Neues beginnen kann. Die Menschen als »Geborene« und Handelnde sind gleichsam Initiale des Lebens. Daher gibt es nur »die Menschen« im Plural. Die für Arendt zentrale »Pluralität« ist vor der politischen eine existenzphilosophische Kategorie.
Auch als Moralphilosophin ist Arendt wiederzuentdecken. Das Problem des Bösen ist es, das die wichtigste Neuerscheinung, die Nachlasspublikation ihrer Vorlesung Über das Böse, in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein umstrittenes Schlagwort geworden, das Hannah Arendts Ruhm mitbegründet hat: die Banalität des Bösen, der Untertitel ihres Buches Eichmann in Jerusalem. Julia Schulze Wessels Untersuchung Ideologie der Sachlichkeit spricht sogar von einem »zur Phrase degradierten Diktum«. Der Untertitel verbindet dennoch in seiner extremen Spannung das, was in Adolf Eichmann als Symptomfigur der NS-Herrschaft verbunden war: das Abgründige und den Normalfall, die Mittäterschaft an einem millionenfachen Mord und die ordnungsgemäße Organisationstätigkeit eines Bürokraten, der besten Wissens und Gewissens seinen Dienst versah. Dass sich das Buch nüchtern als »Bericht« verstand, trug dem Rechnung.
Im Eichmann-Buch selbst spricht Arendt von der »furchtbaren Banalität des Bösen«, und das an herausgehobener Stelle: im Schlusssatz vor dem Epilog. Sie betont so das Abgründige. Aber das hat der Karriere des banalisierten Schlagwortes keinen Abbruch getan. Aus ihr mag es sich erklären, dass die deutsche Version der Vorlesung, die Arendt 1965 an der New Yorker New School for Social Research unter dem unspektakulären Titel Some Questions of Moral Philosophy gehalten hat, wieder auf die Zugkraft des »Bösen« setzt. »Banal-Böses« oder »Radikal-Böses« – Arendt formuliert es mit Kant –: Das ist die Frage. Eine »quälende Frage«.
Trotz des improvisierenden, fragmentarischen Stils der Vorlesung handelt es sich um einen äußerst substanziellen Text. Das Buch hat das Format des Eichmann-Berichts. Es zieht seine moralphilosophische Konsequenz. Arendt geht von dem »Zivilisationsbruch« des Holocaust aus. »Dies hätte nie geschehen dürfen.« Wo weder Vergessen noch Verzeihen, noch gar eine »Bewältigung« der Vergangenheit möglich ist, kann nichts mehr sein, wie es war. Angesichts des »totalen Zusammenbruchs aller geltenden Normen im öffentlichen und privaten Leben« kann auch die Philosophie, zumal die Moralphilosophie nicht unberührt bleiben. Doch woran soll sie sich nun orientieren, wenn sie das Böse, das hier geschehen ist, als abgründiges Rätsel begreift, ohne auf das teuflisch oder metaphysisch Böse der theologischen Tradition rekurrieren zu können? Es gehört zu den großen Vorzügen dieser Vorlesung, dass Arendt bei aller sonstigen Urteilsfreudigkeit ihre Ratlosigkeit einbekennt.
Einstweilen nimmt sie ihre Zuflucht zu jenen epochalen Gestalten der Philosophiegeschichte, von denen sie sich am ehesten Auskunft über die Verbindlichkeit eines nichtbösen Handelns erhofft: zu Sokrates und zu Kant, dazu überraschend häufig zu Nietzsche, aber auch zu Jesus, zu Paulus und ihrem frühen Mentor Augustinus. Mit einer Fülle überraschender Pointen, die diese Vorlesung zu einer brillanten, nie langweiligen Lektüre machen, gewinnt sie Sokrates mit seinem Satz, dass es besser sei, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, und einer ziemlich kühnen Kant-Deutung eine Moral ab, die sich auf die Übereinstimmung des Urteilenden und Handelnden mit sich selbst gründen soll.
Das Selbst ist als moralisch urteilendes und beurteiltes gleichsam zweipersönlich, wie es als denkendes stets im spannungsvollen Zwiegespräch mit sich selbst steht: ein »Zwei-in-Einem«. »Pluralität« wird hier in das Subjekt selbst verlegt. »Von mir selbst kann ich nicht weggehen« wie von den anderen Menschen. »Deshalb empfiehlt es sich für mich, zunächst mit mir selbst in Übereinstimmung zu kommen (…). Wenn ich Unrecht tue, bin ich dazu verdammt, in unerträglicher Intimität mit einem Unrechttuenden zusammenzuleben, dem eigenen Feind, ich kann ihn nie loswerden.«
Diese Grundlegung der Moral gibt freilich prekäre Fragen auf. Denn eben das Banal-Böse, wie es sich in Eichmann »personifiziert«, der sich für einen »Idealisten« hielt und Kants kategorischen Imperativ als seine Handlungsmaxime verstand, ist dadurch geprägt, dass es keinerlei Differenz von Urteilendem und Handelndem, kein »Zwei-in-Einem« kennt, sondern mit sich stets rundum eins ist. Wenn Kant das »radikal Böse« im »Hang« der »Bösartigkeit« zum Bösen um seiner selbst willen sieht, so spricht Hannah Arendt gerade dem »extrem Bösen« jede »radikale« Verwurzelung in einem Selbst ab.
Von mir selbst kann ich nicht wie von anderen weggehen
»Das größte Böse ist nicht radikal, es hat keine Wurzeln, und weil es keine Wurzeln hat, hat es keine Grenzen (…). Das Lästige an den Naziverbrechern war gerade, dass sie willentlich auf alle persönlichen Eigenschaften verzichteten« – auch wenn man diese Charakterisierung angesichts des antisemitischen Fanatismus, den Eichmann in seinen Interviews mit dem SS-Mann Willem Sassen bezeugt hat, in Zweifel ziehen mag. »Das größte begangene Böse ist das Böse, das von Niemanden getan wurde, das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität«. Die schuldlosen »Wenigen«, die Arendt dem Banal-Bösen entgegenstellt, sind im Positiven durch völlige Identität ausgezeichnet. Sie brauchten keine Moral und kein »Du sollst«. Ihr Handeln war für sie ebenso selbstverständlich wie für die Eichmänner die Einstimmigkeit mit jedem Mordbefehl.
Der Versuch, Moral auf Selbstübereinstimmung zu gründen, muss also voraussetzen, was erst zu begründen wäre: ein urteilsfähiges und urteilswilliges Selbst. Gibt es das nicht, so ist Moral ohne Fundament. Und die »Banalität des Bösen« droht noch, vor dem letzten Eichmann-Gericht, die transmoralische Realität zu sein. Eine quälende Antwort auf die quälende Frage, aber von jener Redlichkeit, die Hannah Arendt wie wenige andere Philosophen ausgezeichnet hat.
Vom Verfasser erscheint zum 100. Geburtstag Hannah Arendts der Essay: »Natalität. Philosophie der Geburt«; Die Graue Edition, Zug 2006
N Z Z Online
Neue Zürcher Zeitung, 13. Dezember 2006, Ressort Feuilleton
Brigitte Hilmer
Arendt und Benjamin. Texte, Briefe, Dokumente. Herausgegeben von Detlev Schöttker und Erdmut Wizisla. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 2006. 210 S., Fr. 20.30.
Hannah Arendt lernte Walter Benjamin, den Cousin ihres ersten Ehemannes, in den Jahren der Emigration in Paris kennen und teilte als enge Freundin seine letzten Lebensjahre. Sie wurde Zeugin seiner unablässigen Arbeit, seiner Verzweiflung über seine finanzielle Lage und über seine Abhängigkeit vom Institut für Sozialforschung, das ihn von New York aus zu unterhalten suchte. Als Arendt 1940 in Marseille mit ihrem zweiten Mann ihre Ausreisepapiere für die USA erwartete, musste Benjamin sich der Datierung seines Visums wegen ohne die beiden auf den Weg über die Pyrenäen machen – ein Weg, der sein Ende bedeutete. Ein Typoskript der berühmten geschichtsphilosophischen Thesen, das Benjamin ihr überlassen hatte, konnte Arendt in die USA retten.
Mit seinem Ende erwies sich das Ungeschick, von dem Benjamin sich von jeher angeblickt fühlte, als tödliches Missgeschick. – Hannah Arendt stellte sein Leben unter dieses Thema, als sie das Profil des verlorenen Denkers und Freundes 1968 in einem grossartigen Essay vergegenwärtigte. Sie hatte in den USA vergeblich versucht, eine Ausgabe seiner Schriften in die Wege zu leiten, eine zweibändige Ausgabe wurde erst 1955 von Theodor W. und Gretel Adorno bei Suhrkamp realisiert. Mit ihrem Essay in der Zeitschrift «Merkur» geriet Arendt in Deutschland in ein Wespennest, nämlich unter geistige Erbwalter Benjamins, die gerade angefangen hatten, Adorno und dem Institut ihren Umgang mit dem nicht auf Linie zu bringenden Autor vorzuwerfen.
Aus der Distanz fällt die Klarheit und Souveränität ins Auge, mit der Arendt in dieser Situation Benjamins Profil zeichnet. Wenn sie seine Freundschaft mit Brecht gegen Adornos und Scholems Verdrossenheit verteidigt, dann nicht, um Benjamin für den historischen Materialismus zu vereinnahmen, sondern um darauf aufmerksam zu machen, dass er ein dichterischer Denker, ein literarischer Kritiker und «Perlentaucher» weit eher war als ein Philosoph. (Auch sie selbst verwahrte sich ja gegen diesen Titel.) Damit scheint sie beim Vortrag in Freiburg i. Br., zu dem Heidegger sie eingeladen hatte, mehr Verständnis gefunden zu haben als bei Benjamins ehemaligen Gönnern. «Benjamin kein Philosoph!?», hört man Adorno empört ausrufen; und Scholem hatte nun von Arendts «Frechheit» endgültig genug.
Die sorgfältige Zusammenstellung macht es möglich, diese Geschichte in teilweise unveröffentlichten Briefen und Dokumenten nachzuvollziehen, und ergänzt den Abdruck des Arendtschen Essays von 1968 mit Faksimile und Transkription der besagten ersten Fassung der geschichtsphilosophischen Thesen (Benjamin hatte sie auf Streifbänder von Zeitungen getippt) mit einem informativen Vorwort und einer Zeittafel.
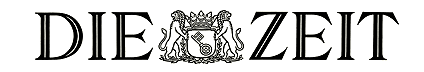
DIE ZEIT, 12.10.2006 Nr. 42
Denn sie war ein freier Mensch
Hannah Arendt, die Philosophin des 20. Jahrhunderts.
Von Seyla Benhabib
Seyla Benhabib: Hannah Arendt.
Die melancholische Denkerin der Moderne; Suhrkamp Verlag, 2006; 379 S., 14 €
In einem schattigen Winkel eines kleinen Hügels in Annandale-on-the-Hudson im Bundesstaat New York liegt nahe dem Bard College ein Friedhof, der wie kaum ein anderer Ort von der europäischen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts Zeugnis gibt. Hinter einer Reihe von Gräbern mit deutsch-jüdischen Namen – Fischer, Grünberg, Fleischmann – stehen zwei schlichte Steine: Heinrich Blücher (1899 bis 1970) und Hannah Arendt (1906 bis 1975). Ihnen gegenüber findet sich eine einfache weiße Bank, die Hannah Arendt aufstellen ließ, nachdem ihr Mann Heinrich Blücher, Professor am Bard College, hier begraben worden war. Dieser stille bescheidene Ort, an dem viele Flüchtlinge aus Hitler-Deutschland ihre letzte Ruhestätte fanden, ist, mit einem Wort von Isaac B. Singer, voller »Schatten über dem Hudson«. Schatten, die den Überlebenden des Totalitarismus folgten.
Hannah Arendt wäre am 14. Oktober 100 Jahre alt geworden. In New York, New Haven, Berlin, Paris und Istanbul, in Slowenien, Malta, Kolumbien und Brasilien würdigen Konferenzen ihr Leben und Werk. Wozu dieser Aufwand für eine Frau, die sich selbst als »das Mädchen aus der Fremde« bezeichnete und die durch die List der Geschichte, wie sie sagte, zu »irgendetwas zwischen einem Historiker und einem politischen Publizisten« geworden war? Es gibt viele Gestalten der Hannah Arendt. Sie ist die Schülerin und Geliebte Martin Heideggers und Studentin der griechischen Philosophie, Politik und Literatur. Sie ist die politisch engagierte, nichtzionistische Jüdin, die Kindern die Übersiedlung nach Palästina ermöglichte, nachdem sie selbst 1933 der Gestapo knapp nach Paris entkommen war. Sie ist eine der scharfsinnigsten Analytikerinnen des Antisemitismus, die trotz aller Kritik am Zionismus nie aufhörte, den Staat Israel zu verteidigen. Sie ist die große Theoretikerin, die in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951) die These vertrat, dass der Totalitarismus (damit meinte sie den Nationalsozialismus und den Stalinismus) eine neuartige Staatsform in der Geschichte darstelle. Deshalb begrüßte sie 1956 den Ungarn-Aufstand und veröffentlichte sieben Jahre später ihr Buch Über die Revolution, das eine revolutionäre Tradition feiert, die jene »neue Ordnung der Zeitalter« zu begründen sucht, wie sie im Wahlspruch der Vereinigten Staaten ihren Ausdruck findet. Schließlich gibt es Hannah Arendt noch in Gestalt der Intellektuellen, die in den Kreisen um die New York Review of Books und die Partisan Review verkehrt; eine Intellektuelle, die die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren leidenschaftlich begrüßt und mit all den New Yorker Kollegen bricht, die die Fortsetzung des Vietnamkriegs und damit die amerikanische Außenpolitik rechtfertigen. Aber was immer sie schreibt, stets gehen Melancholie und Hoffnung, Trauer und Erwartung in ihrer politischer Philosophie eine eindringliche Verbindung ein.
Doch wie haben Arendts Thesen über den Totalitarismus und die Revolution die Prüfung durch die Zeit überstanden? Die Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft frustrierte schon Arendts Zeitgenossen, weil sie eine Mischung aus Geschichtsschreibung, Philosophie, Journalismus und sogar Literaturbetrachtung war. Trotzdem bleibt das Werk neben Alexis de Tocquevilles Über die Demokratie in Amerika ein Klassiker des politischen Denkens — eine der großen Diagnosen der grotesken und missratenen Antworten des 20.Jahrhunderts auf die Probleme des modernen Nationalstaates. Zugegeben, Historiker haben Hannah Arendts Auffassung von der Bürokratie unter totalitären Regimen infrage gestellt; sie haben ihre Thesen über das moderne Verschwinden der Gemeinschaft und das zunehmende Gefühl der Verlassenheit beim »Massenmenschen« in der Zeit vor Hitlers Aufstieg zur Macht widerlegt. Raoul Hilbergs Darstellung Die Vernichtung der europäischen Juden dokumentiert genauer, welchen zentralen Stellenwert das antisemitische Projekt für den Nationalsozialismus besaß. Und nicht zuletzt irrte sich Arendt in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem immer dann, wenn sie kritiklos akzeptierte, wie sehr Eichmann seine eigene Rolle bei der Vernichtung der ungarischen Juden herunterspielte.
Doch all diese Schwächen und Irrtümer können ihre Hauptthese nicht entkräften: Die These, dass ein totalitäres Regime nicht nur nach Macht und Herrschaft strebt, sondern den Raum des Politischen selbst zerstört – und damit die Fähigkeit des Menschen zu gemeinsamem Handeln. Totalitäre Herrschaft will nicht nur strafen und überwachen, inhaftieren und töten. Sie erklärt die Bürger außerhalb der Gefängnismauern zu verfügbaren Körpern, zu »überflüssigen« Menschen.
Auch wenn das Böse niemals banal ist – und Arendt hat nie behauptet, dass es das ist –, gibt es in der politischen Moderne immer wieder die schreckliche Versuchung, Menschen verfügbar zu machen (und anderen die »Routineaufgabe« ihrer Beseitigung zuzuweisen). Serbische Milizionäre, die ihre muslimischen Nachbarn abschlachteten, Hutus, die Tutsis mit Macheten niedermachten, so genannte Dschihadisten im Irak, die Fußball spielende Kinder in die Luft jagen – all das sind politische Manifestationen des Bösen, die von Menschen verantwortet werden, die selbst nicht besonders böse sind. Das heißt: Unser moralisches und politisches Universum ist zwar komfortabler, wenn wir glauben, dass bösartige Handlungen nur von Menschen mit schlechtem Charakter und bösen Absichten begangen werden. Doch damit verstehen wir weder die staatlich organisierte Massenvernichtung des vergangenen Jahrhunderts noch die Vernichtungspolitik, die von nichtstaatlichen Akteuren in unserer Zeit betrieben wird.
Hannah Arendt war auch eine bedeutende Theoretikerin der Revolution. Ihre berühmte Unterscheidung zwischen Revolutionen, die wie die Französische darauf abzielen, die »soziale Frage« von Ungleichheit und Armut zu lösen, und Revolutionen, die wie die Amerikanische darauf abzielen, durch politische Verfassungen die Freiheit zu sichern, ist zwar historisch und analytisch nicht sonderlich präzise. Und doch hat es, wie der Autor Jonathan Schell sagt, »Arendtianische Revolutionen« gegeben, zum Beispiel die Welle gewaltfreier Bewegungen, die seit Mitte der 1970er Jahre in Griechenland, Südafrika, Chile, Polen, den Philippinen, Serbien und der Ukraine demokratische Regierungen ins Amt brachten. Auch der Fall der Berliner Mauer war so eine Revolution. In weitgehend gewaltlosen Aktionen haben Hunderttausende gewöhnlicher Bürger die »Bedingungen der Freiheit herstellen« wollen. Diese Selbstorganisation gewöhnlicher Menschen in gewaltfreien Massenbewegungen war für Arendt eine »Fata Morgana«, die in der Geschichte immer dann wieder auftaucht, wenn Menschen zu Akteuren werden anstatt zu Opfern des politischen Prozesses. Das ist alles andere als eine doktrinäre Verordnung der Demokratie von oben: Tyrannen können gestürzt werden, doch Freiheit ist nie verordnet, sondern muss immer selbst errungen werden.
Wird es in Zukunft weitere »Arendtianische Revolutionen« geben – oder wird die Banalität des Bösen der Erde keinen Frieden lassen? In letzter Zeit haben viele von uns stille Zwiegespräche mit Hannah Arendt geführt, Gespräche über Gebrauch und Missbrauch des Wortes »Totalitarismus« (im Zusammenhang mit gewalttätigen islamistischen Bewegungen); auch Gespräche über Sinn und Unsinn des Ausdrucks »das Böse«, zum Beispiel in der Formulierung von der »Achse des Bösen«. Wir haben mit Hannah Arendt über das Los der Flüchtlinge und Staatenlosen auf der ganzen Welt nachgedacht, und wir sind bestürzt angesichts des neuen Antisemitismus in der islamischen Welt und dem nicht enden wollenden Kriegszustand zwischen Israel und Palästina. Arendt wäre darüber keineswegs überrascht gewesen, aber sie wäre betrübt, dass ihr Jahrhundert noch so lange Schatten auf das unsere wirft.
Und wie steht es um Arendts philosophisches Vermächtnis? Seit ihrem Tod im Jahr 1975 wurden ihre persönlichen Papiere, Korrespondenz, Stipendienanträge und Vorlesungsnotizen, die in mehr als 80 Kisten als Schenkung an die Library of Congress gelangten, von Wissenschaftlern untersucht. Seither ist eine Reihe posthumer Veröffentlichungen ihrer Briefwechsel mit Karl Jaspers, Martin Heidegger, Heinrich Blücher, Kurt Blumenfeld, Uwe Johnson und anderen erschienen oder in Planung. Mit der Publikation ihres Denktagebuchs (1950 bis 1973), das noch nicht ins Englische übersetzt ist, und, wichtiger noch, mit der Veröffentlichung ihrer Vorlesungsmanuskripte unter dem Titel Some Questions of Moral Philosophy (deutsch: Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik) ist die Arendt-Forschung weiterhin in Bewegung.
Es stimmt schon: Gefesselt zwischen Aristoteles und Kant, zwischen ihrer philosophischen und literarischen Bewunderung für die Griechen und ihrer starken Verpflichtung auf die politische Moderne und moderne Revolutionen, werden Arendts philosophische Reflexionen über die moralische Verantwortung, das Urteilen, den Willen und sogar die Zeitvorstellung, so wie sie auch in dem unvollendeten Projekt Das Leben des Geistes vorliegen, uns kein zusammenhängendes philosophisches System offenbaren. Allerdings hat sich Arendt auch niemals dafür interessiert, ein solches System zu schaffen. Die Wendung, die vielleicht am besten ausdrückt, was sie als Philosophin erstrebte, stammt von ihr selbst: »dem nachzudenken, was wir eigentlich tun«. Und im Nachdenken über das, »was wir tun«, erhellte Hannah Arendt den dreifachen Charakter menschlicher Tätigkeit – das Arbeiten, Herstellen und Handeln. So wie ihre Unterscheidung zwischen den Revolutionen, die auf eine Lösung »der sozialen Frage« abzielen, und solchen, die eine »neue Ordnung der Zeitalter« begründen wollen, sind auch diese Unterscheidungen in der konkreten sozialen Analyse schwer aufrechtzuerhalten. Gleichwohl bleiben sie eine unauslöschliche Erfahrungsdimension des menschlichen »In-der-Welt-Seins«.
Bleibt die Frage,
was eine junge Studentin von Martin Heidegger befähigte, die Kategorien des
»In-der-Welt-Seins« und des »Mitseins« in eine Bejahung von Pluralität,
Weltlichkeit und der »Enthüllung der Person im Handeln und Sprechen« zu
überführen. Der Grund lag gewiss in ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der
Politik des 20. Jahrhunderts. Durch diesen in Vita activa vollzogenen Übergang
gehörte Hannah Arendt – so wie Ludwig Wittgenstein vor ihr und Jürgen Habermas
nach ihr – zu jenen Philosophen des vergangenen Jahrhunderts, die unsere
Aufmerksamkeit zu Recht auf die Verflechtung von Reden und Handeln sowie auf die
Bedeutung der menschlichen Pluralität für das Verstehen der sozialen Welt
gelenkt haben. Das »Gewebe menschlicher Bezüge« nannte Arendt all das, was den
Philosophen seit Platon als »der unbeständige Bereich menschlicher
Angelegenheiten« galt und was aus Erzählungen, Sprechakten sowie aus Taten
gebildet wird, die dann als Geschichten überliefert werden.
In diesem paradigmatischen Wechsel vom denkenden Ego zum aktiven Selbst, das in
das Gewebe der Erzählungen eingebunden ist, sehe ich Arendts interessantesten
Beitrag zur Philosophie.
Aus dem Englischen von Karin Wördemann
Seyla Benhabib
ist Professorin für Politische Theorie und Philosophie an der Universität Yale
in den USA. Zuletzt erschien von ihr im Suhrkamp Verlag als erweiterte
Neuausgabe: »Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne«
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Erscheinungsdatum 02.10.2006
Christine Pries
Treue zum Feigling
Antonia Grunenberg über "Hannah Arendt und Martin Heidegger"
Antonia Grunenberg
Hannah Arendt und Martin Heidegger
Geschichte einer Liebe
Piper Verlag, München / Zürich 2006, 480 Seiten, 41 Abb., 22,90 Euro.
Die Zeitläufte
haben sie zu einem der berühmtesten Liebespaare der Philosophiegeschichte
gemacht: Von der legendären Beziehung zwischen Hannah Arendt und Martin
Heidegger war in den letzten Jahren allerdings vor allem aus der
Schlüssellochperspektive die Rede. Spätestens mit der Veröffentlichung ihres
lückenhaften Briefwechsels 1998 trat mehr und mehr die Frage in den Vordergrund,
ob die jüdische Denkerin je von dem großen Philosophen losgekommen ist, mit dem
sie als junge Frau eine heimliche Liebesbeziehung begann - bevor der
Nationalsozialismus sie ins Exil trieb und Heidegger sein umstrittenes Rektorat
an der gleichgeschalteten Universität Freiburg übernahm. Schlimmer noch: Nahmen
sie die Beziehung in vollem Umfang wieder auf, als sie sich 1950
wiederbegegneten, womöglich im Wissen von Heideggers Frau Elfride? Wie in
Catherine Cléments Romanfantasie Martin und Hannah (1999) wurde manche
Informationslücke durch wüsteste Spekulationen gefüllt, die Phantasie vieler
Nachgeborener trieb wilde Blüten. Noch die Veröffentlichung von Elfrides Briefen
an Heidegger im letzten Jahr gab Anlass zu einem Seitenblick darauf, ob Arendt -
bei all den Affären Heideggers, die nun öffentlich wurden - tatsächlich die
große Liebe seines Lebens gewesen war, für die sie selbst sich immer gehalten
hatte.
Obwohl auch sie vor romantisierenden und letztlich spekulativen Formulierungen
gelegentlich nicht gefeit ist, versucht Antonia Grunenberg in Hannah Arendt
und Martin Heidegger von Anfang an, einen sachlicheren Ton anzuschlagen. Ihr
geht es neben den persönlichen auch um die theoretischen Verflechtungen der
beiden. Sie unternimmt den Versuch, beider Leben und Werk aus einem gemeinsamen
geistigen Milieu heraus zu entwickeln, aus dem die hochbegabte Studentin und der
schon in jungen Jahren berühmte Philosoph stammten, der sein Gebiet und die
Universität im ganzen revolutionieren wollte. Als Dritter im Bunde wird Arendts
Doktorvater und Heideggers zeitweiliger "Mitrevolutionär" Karl Jaspers
ausführlich in die Darstellung einbezogen.
Durch die Schilderung dieser "gemeinsamen Welt" der 1920er Jahre, " in der
kommunistische, messianische, jüdische und christliche, zionistische,
nationalistische und rassistische Traditionen gleichzeitig gegen-, in- und
miteinander wirkten, sich abstießen und beeinflußten", gelingt es Grunenberg,
nicht nur den radikalen Bruch, den der Nationalsozialismus bedeutete, in all
seiner Härte darzustellen. Sie findet auch einen Schlüssel dafür, warum unsere
Protagonisten, ob Opfer oder Täter, auch in der Nachkriegszeit nicht einfach
voneinander lassen konnten. Denn das eigentliche Skandalon, das die Beziehung
zwischen Arendt und Heidegger noch heute umgibt, ist ja nicht Arendts knapp
anderthalbjährige Affäre mit ihrem verheirateten Professor, sondern warum sie,
die streitbare politische Denkerin, als Jüdin und Opfer des Nationalsozialismus
nach dem Krieg die Freundschaft zu Martin Heidegger wieder aufnehmen konnte,
obwohl sich dieser von seiner zeitweiligen Einlassung mit dem
Nationalsozialismus niemals eindeutig distanzierte, weder Schuld eingestehen
wollte, noch sich zu seiner Verantwortung bekannte.
In aller Ausführlichkeit beschreibt Grunenberg Arendts schwankende Gefühle
gegenüber Heidegger. Obwohl es vordergründig so aussah, als wäre die alte
Verbundenheit wieder hergestellt - sie sah ihn bei fast allen ihrer Besuche in
Deutschland und setzte sich in den USA für die Übersetzung und Verbreitung
seiner Schriften ein -, blieb sie doch misstrauisch, zumal er - wie auch in der
Auseinandersetzung mit Jaspers - der direkten Konfrontation mit der
Vergangenheit auswich. Sie hielt ihn nach wie vor für einen genialen
Philosophen, aus dessen Werk sich für die Schülerin, die sich nach dem
Traditionsbruch, den der Nationalsozialismus in ihren Augen auch für das Denken
bedeutete, nicht mehr als Philosophin verstehen wollte, auch für ihre eigenen
Überlegungen viele Anknüpfungspunkte ergaben. Politisch hielt sie ihn jedoch für
einen "Feigling", was sich bis zu ihrem Tod 1975 nicht ändern sollte. Geradezu
ergreifend ist, wie Arendt selbst sich diese "Treue" erklärt, deren Alternative
für sie nicht Untreue, sondern die Auslöschung von "Wahr-gewesenem" gewesen
wäre. Wie auch im Streit etwa mit ihren ehemaligen zionistischen Mitstreitern
deutlich wird, war Arendt in der Lage, sachliche Differenzen von persönlicher
Freundschaft strikt zu trennen.
Spektakulär Neues erfährt man aus Grunenbergs Studie nicht. Weitergehend
Interessierte werden auch nach der Lektüre dieses Buches um die
Standardbiografien von Elisabeth Young-Bruehl über Arendt und Rüdiger Safranski
über Heidegger sowie um philosophische Spezialuntersuchungen nicht herumkommen.
Grunenbergs Buch besticht durch die Zusammenschau der vielen Details, die sie
akribisch zusammengetragen hat, vorsichtig interpretiert und wo nötig auch von
zwei konträren Seiten beleuchtet. Sie malt ein Sittenbild, in dem auch den
Nebenfiguren in den persönlichen und professionellen Netzwerken ungewöhnlich
viel Raum gegeben wird. Großartig etwa ihre Schilderung des Milieus um die
Partisan Review, an der Arendt zeitweilig mitarbeitete. Grunenberg hat kein
philosophisches Buch und auch keine bloße (Doppel-)Biographie, sondern eine
Kulturgeschichte geschrieben.
Sie entwirft das Panorama einer heute bereits entrückten und immer weiter
entrückenden und daher kaum mehr vorstellbaren Zeit - des Vorkriegs, in der der
existentielle Aufstand gegen die Schulphilosophie mit einer elitären
Grundhaltung durchaus vereinbar war, erhitzte politische Diskussionen einem
letztlich apolitischen Verhalten nicht im Wege standen; und der ersten 30 Jahre
nach dem Krieg, in denen das Ringen um Schuld und Verantwortung von heute aus
gesehen unübersichtliche Fronten zeitigte. Arendts Auseinandersetzung mit dem
Zionismus und die Fragen, die ihr skandalumwittertes Eichmann-Buch aufwarfen,
haben mit Blick auf die Lage im Nahen Osten nichts von ihrer Aktualität
eingebüßt.
Man mag darüber streiten, ob Grunenberg, die stark mit Arendt sympathisiert,
sich gegenüber Heidegger, den sie gerade ab 1945 zunehmend durch Arendts
ambivalente Brille betrachtet, in ihrem Urteil nicht zu sehr zurückhält; ob sie
ihn durch die Verortung seines Denkens im Vorkriegsmilieu und ein gewisses
Verständnis etwa für seine Furcht vor dem Kommunismus, das durch die Zeilen
schimmert, nicht letztlich vorschnell ,entschuldet'. In gewisser Weise gibt sie
die Frage, wie viel Verantwortung Menschen tragen, die aus einem elitären und
letztlich unpolitischen Universitätsmilieu stammen und Radikalisierungen wie
z.B. der nationalsozialistischen Propaganda "geistig entwaffnet"
gegenüberstehen, an den Leser zurück. Abgesehen davon, dass sich diese Frage
historisch - und aktuell - immer neu stellt, hat Arendt, so viel wird bei
Grunenberg allenthalben klar, die Verantwortung übernommen, die ihr Schicksal
ihr aufzwang; Heidegger aber hat sich zeitlebens davor gedrückt. Das Geheimnis
ihrer Liebe lüftet auch Antonia Grunenberg nicht. Aber das spricht nicht gegen,
sondern für dieses Buch.

Artikel erschienen am 14.10.2006
Geschichte
Diese Liebe geht uns nichts an
Die Studentin und ihr Professor: Antonia Grunenberg beschreibt die philosophische Affäre des Jahrhunderts.
Von Natan Sznaider
Antonia Grunenberg: Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe. Piper, München. 466 S., 22,90 EUR.
Warum ein Buch über die Geschichte einer Liebe? Muss Liebe verteidigt werden? Auch wenn die Liebenden Arendt und Heidegger heißen? Was lernen wir dabei? Über uns oder über ihre Philosophie? Freilich wissen wir schon seit Platon, dass Eros und Philosophie aus derselben Quelle stammen.
Aber geht es in diesem Buch wirklich um Eros? Am Ende der Lektüre weiß man mehr über Hannah Arendt und über Martin Heidegger - oft auch "Martin und Hannah" genannt, als wollte die Autorin ihr intimes Verhältnis zu beiden mehr als nötig betonen. Kontroversen werden von Antonia Grunenberg bewusst umgangen - so weiß man nie so richtig, ob Heidegger nun überzeugter Nazi, ein Deutschnationaler oder einfach nur ein fehlgeleiteter Idealist war.
Was kommt außer Voyeurismus bei diesen Fragen noch heraus? Die Affäre, die Heidegger und Arendt verband, gehört längst der Öffentlichkeit. Jeder Arendt-Kenner weiß, dass sie als Studentin in den zwanziger Jahren etwas mit Heidegger hatte und dass sie Heidegger nach dem Krieg, als sie schon in den USA lebte, immer noch manchmal traf. Warum soll es heute jemanden interessieren, weshalb eine junge jüdische Studentin mit ihrem Lehrer ins Bett ging? Hat das damit zu tun, dass er seine Beziehung zu den Nationalsozialisten nie wirklich in Frage stellte? Auch das ist nichts Schlimmes mehr: Berühmtere Leute als Heidegger kokettieren mit ihrer Nazivergangenheit. Doch in diesem Fall geht es um mehr als nur um die Körper von Arendt und Heidegger. Auf dem Spiel steht nicht nur die Liebesbeziehung einer jungen jüdischen Studentin, die zu den wichtigsten politischen Theoretikern des 20. Jahrhunderts gehörte, mit dem wichtigsten Vertreter all dessen, was faul ist am deutschen Geiste. Hier geht es anscheinend um das deutsch-jüdische Verhältnis an sich: Wenn Arendt Heidegger verzeihen kann, dann kann es doch nicht ganz so schlimm um Deutschland und die Deutschen stehen? Vielleicht kann die deutsch-jüdische Symbiose doch noch gerettet werden?
Das wären ja teilweise ganz interessante Fragen. Schade nur, dass sie in diesem Buch keinen Platz fanden. Hannah Arendts Kritiker sehen in ihrem Denken eine Projektion ihrer offenbar nicht überwundenen Liebe zu dem Nazi Heidegger: Nur so lasse sich erklären, warum sie gegenüber den jüdischen Opfern in ihrem berühmtesten Buch "Eichmann in Jerusalem" so unsensibel war.
Wir leben in psychologischen Zeiten. Gefühle sind alles: Es gibt kein privates Selbst mehr. Alles wird öffentlich, und die Schranken zwischen dem Politischen und Privaten werden abgeschafft. Just dagegen dachte Hannah Arendt an. Sie war eine in der Antike verankerten Denkerin - die Privatsphäre galt für sie nicht nur als abgeschiedener Bereich, sondern mehr noch: als minderwertig. Sie verstand das Politische auch als Kunst, sich vor dem Privaten zu schützen. Liebe, Mitgefühl und andere Emotionen sollten doch besser aus dem öffentlich-politischen Diskurs herausgehalten werden. Jene Form der Neugier, die sie durch ihre Liebe zu Heidegger verstehen will, wäre ihr tief zuwider. Sie würde sie als therapeutischen Versuch verstehen, sich selbst in Szene zu setzen, Misstrauen zu säen, Biografie als Schicksal zu verstehen. Ein voyeuristisches Buch über ihre Liebe würde sie zutiefst verabscheuen.
Hannah Arendt wehrte sich auch gegen den Versuch, die Verbrechen zu normalisieren, die die Deutschen an den Juden begingen. Dieser Normalisierungsversuch war auch mitunter das Verdienst von Heidegger. Leider wird in Antonia Grunenbergs Buch nur gezeigt, warum wir Arendts Liebe zu Heidegger verstehen sollen. Dass es um viel mehr geht, wird ausgeklammert - dabei ist Nachdenken über Heideggers Schweigen zum Nationalsozialismus selbst schon eine kleine akademische Industrie geworden. Eigentlich war seine Stimme aber deutlich zu hören: Was die Deutschen den Juden antaten, sei auch nicht schlimmer als das, was die Russen mit den Deutschen getan hätten - hieß es in einem Brief an seinen ehemaligen Schüler Herbert Marcuse von 1948.
Nun will sich Grunenberg gar nicht auf die Frage einlassen, ob Heidegger ein authentischer Nazi oder nur für kurze Zeit vom Nazismus verblendet war (es scheint, Hannah Arendts Liebe zu ihm besäße mehr Legitimation, wenn er nur verblendet gewesen wäre). All das wird leidenschaftslos nacherzählt, ohne Heideggers Einfluss auf die Vergangenheitspolitik Deutschlands zu beleuchten.
Gleich nach dem Krieg schrieb Heidegger seinen "Brief über den Humanismus", eine Schrift, die bis heute großen Einfluss auf das kritische Denken hat. Man könne im Namen des Humanismus den Antihumanismus nicht verurteilen, so Heidegger, denn es sei der Humanismus in Gestalt der Technologie selbst, der zur Gewalt verführe. Nur die sogenannte Wahrheit des Seins sei Antipode der Gewalt. Gemäß dieser Metaphysik kann der Völkermord an den Juden mit den Atombomben, den Vertreibungen Deutscher, der Bombardierung von Städten in Zusammenhang gebracht werden. Es ist gut, dass Antonia Grunenberg auch Karl Jaspers erwähnt, den Dritten im Arendt-Heidegger-Bunde - denn es war Jaspers der unterscheiden wollte: zwischen kriminellen Staaten und Staaten, die kriminelle Handlungen begehen.
Hannah Arendt mag sich von Überlegungen wie jenen Heideggers hingezogen gefühlt haben, aber sie dachte zu politisch, um sich davon verführen zu lassen. Am Ende bezog sie Stellung - und zwar für ihre jüdische Verantwortung. Grunenberg zitiert beinahe triumphierend Hannah Arendts Kritik am Zionismus; die Jüdin Arendt versteht sie dabei nicht. Ihr Denken war der jüdischen Verantwortung und den Konsequenzen des antijüdischen Genozids gewidmet. Alles andere geht uns eigentlich nichts an. Grunenberg will zwar die Geschichte einer Liebe erzählen, aber wie Hannah Arendt selbst oft sagte: Eine Geschichte kann nur erzählt werden, wenn sie zu Ende ist. Doch die Geschichte dieser Liebe ist noch lange nicht zu Ende - und darum ist es gut, dass wir nichts von ihr erfahren.
![]()
29-12-2006
Passion zweier Leben
ANDREAS DORSCHEL
ANTONIA GRUNENBERG: Hannah Arendt und Martin
Heidegger. Geschichte einer Liebe. Piper Verlag, München und Zürich 2006. 469
Seiten, 22,90 Euro.
Um den
Jahreswechsel 1924/25 begegnen einander in Marburg an der Lahn der
Philosophiedozent Martin Heidegger, 35 Jahre alt, und die Studentin Hannah
Arendt, 17 Jahre jünger als er. Heideggers Briefe an Arendt, und aus dieser Zeit
scheinen nur seine sich erhalten zu haben, sind Zeugnis einer passionierten
Liebe. Sie sind in einer zwischen später Romantik und Expressionismus
schwankenden Sprache des Überschwangs gehalten, über die sich lustig zu machen
ebenso leicht wäre wie es billig sein dürfte. Die Beziehung des verheirateten
akademischen Lehrers zu der jungen Frau ist unmöglich, und wird es keineswegs
erst, als jener sich für den Nationalsozialismus engagiert und diese als Jüdin
Deutschland verlassen muss. Beide trennen sich schon 1926, drei Jahre später
heiratet Arendt den von Heidegger verachteten Günther Stern (Günther Anders).
Nach der Niederlage des nationalsozialistischen Deutschland erscheint Heidegger
Arendt nicht nur als Verbreiter „törichter Lügnereien” mit „pathologischem
Einschlag”, sondern auch, im Hinblick auf sein Verhalten dem alten Edmund
Husserl gegenüber, als „potentieller Mörder”. Weit tiefer als diese
Etikettierung trifft aber die im selben Brief Arendts an Karl Jaspers aus dem
Jahr 1946 ausgesprochene Einsicht, „daß das wirklich Irreparable oft fast –
täuschend – wie ein Akzident auftritt, daß manchmal aus einer unscheinbaren
Linie, die wir gelassen überschreiten, im sicheren Bewußtsein, daß es darauf nun
auch nicht mehr ankommt, jener Wall sich aufrichtet, der Menschen wirklich
scheidet”. Akzident, schwankend zwischen dem Akzidenz der metaphysischen
Substanzenlehre und dem englischen „accident”, „Unfall”, trifft den Schein, den
Arendt durchschaut.
Unwahrscheinliches Vertrauen
Trotz allem, das
dagegen spricht, trifft Arendt Heidegger 1950 wieder. Die Wiederbegegnung
entfesselt durch Einbeziehen Elfride Heideggers die Tragikomik bürgerlicher
Ehedramen. „Und er, der doch notorisch immer und überall lügt, wo er nur kann,
hat ebenso offenbar, d.h. wie sich aus einem vertrackten Gespräch zu dritt
ergab, nie in all den 25 Jahren geleugnet, daß dies” – seine Liebe zu Arendt –
„nun einmal die Passion seines Lebens gewesen sei. Die Frau, fürchte ich, wird
so lange ich lebe, bereit sein, alle Juden zu ersäufen. Sie ist leider
mordsdämlich”, schreibt Arendt am Tag nach der Wiederbegegnung. Ungeachtet ihrer
grotesken Züge rührt diese an alte Gefühle. In den 1960er Jahren gelang es
Arendt und Heidegger, ihre unmögliche Liebe in etwas wie Freundschaft zu
überführen. Das mit ihrer Geschichte Unwahrscheinlichste scheint möglich
geworden zu sein, etwas Unwahrscheinlicheres als Liebe: Vertrauen.
Was kann man von einem Buch über dieses Thema erwarten? Kann es einen
philosophisch weiterbringen? Fördert und fordert es Denken? Die den
philosophischen Werken Heideggers und Arendts gewidmeten Partien von Antonia
Grunenbergs Geschichte einer Liebe sind nicht die stärksten, eher weitläufige
Paraphrasen als Eindringen in und Durchdringen des Gedankengangs. „Ein
vernichtendes Urteil!”, kommentiert Grunenberg einen Passus aus Heideggers
Nietzsche-Buch, an dem das ohnehin jeder merkt. Welches aber an dieser Stelle
der in Heideggers Einwand gegen Jaspers artikulierte Gedanke ist, analysiert sie
nicht.
Ginge es vor allem um Gedanken, so fragt sich ja, wozu genau die
Liebesgeschichte präsentiert würde? Wenn aber die Liebesgeschichte, eröffnet
diese dann die Kammerdienerperspektive auf die großen Denker? Für den
Kammerdiener gibt es keinen Helden, doch nicht, weil dieser kein Held, sondern
weil jener ein Kammerdiener ist, sagt Hegel in der Phänomenologie. So wenig
Heidegger ein Held gewesen sein mag, so gründlich darf man sich für ihn die
Kammerdienerperspektive verbitten. Und in dieser Hinsicht zeigt sich eine von
mehreren Stärken des Grunenbergschen Buches. Sie hat der Gefahr, die Denker
durchs Schlüsselloch zu zeigen, ins Auge geblickt und sie souverän gemieden. Am
Ende ihrer Vorbemerkung stehen zwei Fragen und eine Antwort: „Wie stehen die
Protagonisten am Ende da? Entlarvt, beschädigt, rehabilitiert? Wenn es gelungen
wäre, images wie diese zu unterlaufen, hätte das Buch einen Zweck erfüllt”.
Grunenberg weiß, dass das moralische Gütesiegel unter der Geschichte bloß die
Umkehrung des Demaskierens wäre, und so wenig aufschlussreich wie dieses.
An Stelle beider Verfahren tritt historische Differenzierung. Sie setzt Maßstäbe
in der Darstellung dessen, wie sich Heidegger vor und nach dem
Nationalsozialismus verhielt, und wie nach dem Nationalsozialismus an seiner
Universität mit ihm verfahren wurde. Nichts wird beschönigt. Aber ein
Gerechtigkeitssinn, der in der Literatur zu diesem Thema rar war und ist,
bewahrt Grunenberg jeden Moment vor den Versuchungen des Decouvrierens
einerseits und der Apologetik andererseits. Ihr Schreiben ist bemerkenswert frei
von manipulativen Zügen. Sie will ihren Lesern nicht aufdrängen, wie sie
Heidegger und Arendt zu sehen hätten. Das mag so Grunenbergs Art sein, könnte
aber noch an etwas Speziellerem liegen: Dass sie selbst bis zuletzt neugierig
blieb auf ihren Stoff.
Sprachlich hat diese Neugier sich nicht in letzter Konsequenz durchgesetzt.
Vielmehr durchsetzt Stereotypes den Text. „Die Namen der Hörer von Heideggers
Vorlesungen und Kollegien nehmen sich aus wie ein Who is who? der Denkschulen
des 20. Jahrhunderts”, heißt es mit Blick auf das Marburg der 1920er Jahre, und
über das Freiburg der 1930er Jahre schreibt Grunenberg: „Die Liste von
Heideggers Studenten in diesen Jahren liest sich wie ein Who is who? der
nächsten Generation der akademischen und politischen Intelligenz”. Abgesehen
davon, dass kein gescheiter Mensch in ein „Who is who?” blicken wird, treten an
einem Beispiel wie diesem gestanzte, allzu vorhersehbare Züge an Grunenbergs
Sprache hervor. Aber man tut gut daran, das Wort nicht für die Sache zu nehmen.
Grunenberg will es wissen, schöpft aus den Quellen, und macht die Dinge nicht
einfacher als sie sind.
In der gemeinsamen Welt
Diese
Historikertugend kommt auch Grunenbergs Darstellung der 1920er Jahre zugute. Ihr
gelingt es, das Vertrackte, Verfahrene, Verworrene, manchmal aber auch fruchtbar
Verschlungene einer historischen Situation exemplarisch zu Bewusstsein zu heben,
das sich Spätere bequem als seit jeher fein säuberlich getrennt und
entgegengesetzt vorzustellen belieben. „Was den Nachgeborenen so klar geschieden
scheint (der Lehrer als Täter – die Kollegen und Schüler als Opfer), war
seinerzeit eine gemeinsame Welt, in der kommunistische und messianische,
jüdische und christliche, zionistische, nationalistische und rassistische
Traditionen gleichzeitig gegen-, in- und miteinander wirkten, sich abstießen und
beeinflußten”.
Das Genre Biographie tendiert zu dem Vorurteil, mit ein wenig freihändiger
Psychologie ließen sich solche Anziehungen und Abstoßungen hinreichend klären.
Auch von diesem Vorurteil ist Grunenberg in reflektierter Weise frei;
eingelassen in die Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts gewinnen die
Lebensgeschichten der Individuen, um die es geht, erst rechte Kontur.

April 29, 2010
HEIDEGGER
The Introduction of Nazism Into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935
By Emmanuel Faye
Translated by Michael B. Smith
436 pp. Yale University Press. $40
STRANGER FROM ABROAD
Hannah Arendt, Martin Heidegger, Friendship and Forgiveness
By Daniel Maier-Katkin
384 pp. W. W. Norton & Company. $26.95
Yet by the time of his 80th birthday, in 1969, Heidegger had largely succeeded in detaching his work and reputation from his Nazism. The seal was set on his absolution by Hannah Arendt, in a birthday address broadcast on West German radio. Heidegger’s Nazism, she explained, was an “escapade,” a mistake, which happened only because the thinker naïvely “succumbed to the temptation . . . to ‘intervene’ in the world of human affairs.” The moral to be drawn from the Heidegger case was that “the thinking ‘I’ is entirely different from the self of consciousness,” so that Heidegger’s thought cannot be contaminated by the actions of the mere man.
The history of Heidegger scholarship over the last 20 years has been the gradual demolition of this forgiving consensus endorsed by Arendt. On the one hand, Heidegger’s self-portrait as a misguided idealist turned dissident has been shown to be sheer fabrication. The philosopher, it is now clear, was a committed National Socialist for many years, an admirer of Hitler who purged Jewish colleagues, presided over a book-burning (though it seems rain may have prevented any books from actually being burned) and — unlike genuine dissidents — continued to teach, publish and travel throughout the Nazi period. At the same time, and more significantly, the alleged division between the man and the work has been thoroughly undermined, as scholars have examined the deep affinity of Heidegger’s thinking with the irrationalist and chauvinist ideas of the interwar German right.
What distinguishes Emmanuel Faye’s “Heidegger: The Introduction of Nazism Into Philosophy,” which was published to loud controversy in France in 2005, is that it takes these critiques of Heidegger to their logical extreme. Most readers would agree that Heidegger was a Nazi, and that this matters to his philosophy; it has remained for Faye to argue that Heidegger was a Nazi philosopher, which is to say that he was no philosopher at all, and that his books are positively dangerous to read. In fact, he comes very close, on the book’s last page, to saying that Heidegger’s collected works should be banned from libraries: “They are . . . as destructive and dangerous to current thought as the Nazi movement was to the physical existence of the exterminated peoples. . . . Hitlerism and Nazism will continue to germinate through Heidegger’s writings at the risk of spawning new attempts at the complete destruction of thought and the extermination of humankind.”
Faye, an authority on Descartes, is driven to this pitch of accusation by his study of the seminars, till now untranslated or unpublished, that Heidegger taught during 1933-35, in the first flush of his Nazi enthusiasm. In these classes, Faye proves beyond doubt, we do witness “the introduction of Nazism into philosophy,” the outright transformation of Heidegger’s thought into a tool of Nazi indoctrination. The more familiar a reader is with Heidegger’s work, the more shocking it will be to see him employ his key terms — being, existence, decision — as euphemisms for nationalism and Führer-worship. Thus we find him, in the winter of 1933-34, declaring that “the question of the awareness of the will of the community is a problem that is posed in all democracies, but one that of course can become fruitful only when the will of the Führer and the will of the people are identified in their essence.” At the same time, Heidegger tells his students — “many of whom,” Faye points out, “were to become combatants at the beginning of the following decade on the Eastern front” — that “to a Semitic nomad,” the “nature of our German space” is inherently foreign.
Faye’s achievement is to demonstrate, in these texts, the very fusion of man and thinker that Heidegger was later so concerned to deny. Yet the seminars and speeches Faye analyzes date mainly from the period 1933-35 — that is, the year of Heidegger’s rectorship and just afterward, when his Nazism was flagrant. To show that he remained a Nazi until 1945, or even for the rest of his life, would require finding similar kinds of propaganda in Heidegger’s work throughout those years. But unlike the seminars Faye has unearthed, Heidegger’s writing from that later period is well known; and aside from a few notorious instances, overt Nazi rhetoric simply isn’t there.
In order to bolster his case, then, Faye must resort to some dubious methods. Quoting a memorandum written by Hitler in December 1932, Faye suggests that its language and ideas resemble Heidegger’s. Since “it appears materially impossible that the Führer could have written entirely by himself” all his speeches and memos, Faye goes on, and since “we do not know precisely what Heidegger’s activities were from July 1932 to April 1933” — well, Faye doesn’t quite spell it out, but he is clearly implying that Heidegger was functioning as Hitler’s ghostwriter.
But the weakness of this inference only underscores the problems with Faye’s overall case. What Faye really wants is not to make us think about Heidegger differently, but to excuse us from having to think about him at all, by expelling him from the ranks of the philosophers into the cesspool where Nazi ideologues like Alfred Rosenberg dwell. “In the work of Martin Heidegger,” Faye concludes, “the very principles of philosophy are abolished.”
If this judgment were to become generally accepted, it would have serious consequences for the reputation of Hannah Arendt, whose name is so intimately linked with Heidegger’s. Arendt was not just the elderly Heidegger’s defender; as an 18-year-old student, she had been his lover, and he was a formative influence on her thought as well as her emotional development. It makes sense, then, that in “Stranger From Abroad,” his readable but unprobing account of their relationship, Daniel Maier-Katkin, a professor of criminology at Florida State University, should effectively minimize Heidegger’s political and philosophical sins. “Heidegger’s embrace of the Nazis stands among innumerable other acts of accommodation by leading citizens,” he writes, for whom “optimism and opportunism formed a basis for entente.”
He is led to this judgment in part by his uncritical admiration for Arendt. For if Heidegger was merely an opportunist on an “escapade” — that bizarrely inappropriate word, which Maier-Katkin borrows from Arendt — then Arendt was right to vouch for him in 1969. More, she was justified in resuming their friendship in 1950, after not speaking to Heidegger since the Nazi takeover in 1933, when she was forced to flee the country. “This evening,” she wrote her old teacher after their reunion, was “the confirmation of an entire life.” If she had not reached out to him, she said, she would have committed “the only really inexcusable act of infidelity . . . out of pride, that is, sheer crazy stupidity. Not for reasons.”
This is one of many moments in Maier-Katkin’s book when his subjects deserve to be put under greater pressure than he is willing or able to apply. For the truth is that Heidegger was much more than a “leading citizen” who “accommodated” the Nazi regime; and Arendt had good reasons to apply to him a standard of judgment at least as unforgiving as the one that she notoriously used when finding European Jewish leaders responsible for enabling the Holocaust (in “Eichmann in Jerusalem”).
Least convincing of all is Maier-Katkin’s suggestion that Heidegger is to be understood as just a brainier Adolf Eichmann, “motivated less by racial ideology than by careerist opportunities, combined with thoughtlessness about others.” Arendt would be appalled by such a characterization of the man she herself called the “secret king in the empire of thinking.” For what makes Heidegger’s Nazism a challenge — as opposed to merely a scandal — is the fact that he did not drift into evil, but thought his way into it. And once we acknowledge the powerful attraction of his work, we are morally and intellectually bound to explore what part of that attraction is owed to ideas with a potential for evil. Neither Faye nor Maier-Katkin embarks on that more difficult questioning, which asks us to confront not just Heidegger but ourselves.