Startseite, hier
ELIAS CANETTI
(1905 - 1994)
![]()
July 23, 2005
Bedding Miss
Murdoch
In a memoir just translated into English, the late Nobel laureate Elias Canetti delivers a scathing critique of Iris Murdoch’s powers as a writer — and as a lover
YESTERDAY, the thick philosophical tome by Iris Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals, with her name on the cover in huge letters. I, unfortunately, sat down with it for a few hours. My antipathy against her has grown so strong that I must say something about her here.
I don’t think there is anything that leaves me quite so cold as that woman’s intellect. She is a passionate schoolgirl, of the kind that likes nothing better than studying systems. And then she’s the schoolmarm who likes to explain these systems. Of course, she’s desperate to avoid any misrepresentations. So she faithfully reproduces everything. She’s over 70, so she has a wonderful collection of systems. The whole thing is topped off with morality; she is passionate in the way she sticks up for traditional morality.
She also has something quite different to stick up for: and those are her 24 novels. These contain all the Oxford gossip she has heard in half a century. All her characters are Oxford born and bred. In her time she has been in love with innumerable men (not to mention many women). There really were all sorts: a theologian, an economist, an ancient historian, a literary critic, an anthropologist, and also a philosopher and a writer. But all these men she has taken into her, they’re all metamorphoses of herself. Her characters spring from the discussions she’s had with all these men.
She keeps everything she hears, and, provided it didn’t have prior expression as philosophy, it becomes her anonymous booty. She listens to everything, again and again, as long as people can stand to repeat it, she offers herself in exchange for more, calmly listens to stories, confessions, ideas, despair. She strikes me as being like a housewife on a shopping expedition. She forgets nothing.
You could call Iris Murdoch the bubbling Oxford stewpot. Everything I despise about English life is in her. You could imagine her speaking incessantly, as a tutor, and incessantly listening: in the pub, in bed, in conversation with her male or female lovers. I can’t take her seriously any more. That’s to do with the fact that I’ve known her so well. I know how she came about, she assembled herself practically before my eyes, a kind of all-in-one parasite from Oxford, itself an — attractive — excrescence of humanity. Iris never got Oxford out of her system. I will now do for once what she always does: I will describe her, describe Iris.
I WAS STRUCK by her way of listening, the very first time I saw her with Franz Steiner. She was listening like a deaf person, who, to hear at all, tries to soak up everything. After Steiner’s death, for which she felt partly responsible, she would often come to me, to rail at herself. She was mourning Steiner, but she kept a sharp eye on me, to see whether, in offering her comfort, I would try to make an approach.
She was supposed to go back to Oxford, it was getting late, it was foggy, I asked her if she wanted to stay the night. She could lock herself into the room where we were presently sitting, I would sleep somewhere else. I said this out of respect for her grief; she wasn’t to suppose for a moment that I was trying to make an approach to her, not when she’d spent hour after hour talking about Steiner. She looked at me with a doubtful expression, I thought it might be uncertainty, but actually it was surprise and disappointment. She didn’t take up my offer, and went back to Oxford, I walked her as far as the Finchley Road Tube station, went down the steps with her, and left her sitting on a bench with the book in her hand I had just given her: The Lyrebird, an account of a woman’s friendship with one such bird in the Australian desert, it danced and sang for her.
This magical book, which I had only recently discovered myself, I gave her, she understood the significance of it, it was a sort of baptism, which indicated that she was accepted among the writers. At that time, early 1953, there were no books by her. I left her in the fog, waiting for her train. I vanished up the steps, the fog was very thick, I looked back and couldn’t see anything, the fog had swallowed her up, I thought of her pain-filled face, and felt concerned for her, I stopped and went back down the stairs, and suddenly stood in front of her; she was sitting on the bench, happily leafing through the book I had given her. Her face of sorrow had become a beam of happiness, touched with light amazement at this book.
The train came, she got up, and in a trice she had disappeared into the fog, doubly disappeared. I walked back to my flat in a state of some confusion, and was happy, happy at the thought of her happy face looking at the book. She visited again in the course of that winter, she was always talking about Steiner, and we kissed.
The extraordinary thing happened as soon as we had kissed. The couch I always slept on was to hand. Quickly, very quickly, Iris undressed, without me laying a finger on her, she had things on that didn’t have anything remotely to do with love, it was all woollen and ungainly, but in no time it was in a heap on the floor, and she was under the blanket on the couch. There wasn’t time to look at her things or herself. She lay unmoving and unchanged, I barely felt myself enter her, I didn’t sense that she felt anything, perhaps I might have felt something if she had resisted in some form. But that was as much out of the question as any pleasure.
No sooner was it finished, she was still lying flat on her back, than she became animated and started to talk. She was caught in a peculiar dream: she was in a cave with me, I was a pirate, I had snatched her away and dragged her back to my cave, where I had flung her down and ravished her. I sensed how happy she was with this pretty commonplace story, she got a little redder still, and felt hot to the touch. She wanted to see me as a brigand, who brutally forced her.
I didn’t show her how amused I was. Any way to loving her was blocked off by this dream. It would be impossible to imagine anything further from my mind than this ravishing. Perhaps, if things had happened very differently, I might have been able to love her.
As it was, though, it remained an embarrassingly one-sided story, which I accepted against my better judgment, and observed dispassionately. Her inevitable dreams did not have the least distinctiveness, she was only telling me — something I didn’t understand till much later — that she wanted to see herself as the pirate. She had a — buried — robber’s nature, and her aim was to rob each one of her lovers not of his heart, but more of his mind.
This went on — with lengthening intervals — for a couple of years. She invited me to Oxford, and met me at the station. She was wearing grotesque sandals, which showed off her large flat feet to terrible disadvantage. I could not ignore the ugliness of her feet. She had a bear-like walk, but it was a repulsive bear, crooked and purposeful at once. Her upper body was delicate and well-proportioned, and the face at moments — including some sexual moments — as beautiful as that of a Memling Madonna. She walked with me from the station into town, pushing a bicycle with one hand, stopped at a dingy shop to buy some wretched provisions — ends of cheese, bread — for lunch, and set it in front of me in the little flat where she was staying. Anything less hospitable, more dismally puritanical, more tasteless than such a meal is impossible to imagine. What was supposed to be the frugal ways of a young scholar was in reality mean and petty bourgeois; the seductiveness of a woman asking one to take a meal was beyond her.
Afterwards she made it clear that there was a couch handy, and she laid herself down on it promptly. While her lack of hospitality may have chilled me, her love never did, for the simple reason that it wasn’t love, it was an indifferent act, endowed with a baffling significance for her.
Extracted from Party in the Blitz by Elias Canetti (Harvill, £17.99)
Brief lives
Elias Canetti was born in Bulgaria in 1905. When he was 30, he wrote a remarkable novel about the slow destruction by the outside world of a reclusive scholar, Die Blendung, later translated into English as Auto-da-Fé. He came to Britain in 1939, and in 1962 published a social and psychological study, Crowds and Power. He was awarded the Nobel prize in 1981, and died in 1994.
Iris Murdoch was born in 1919, and met Canetti in 1952. Two years later, her first novel, Under the Net, brought her instant fame, and she went on to write many other novels that explored the morals of personal relationships in richly romantic settings. The Sea, The Sea (1978) won the Booker Prize. She married the literary critic John Bayley, who wrote a moving book, Iris, about their marriage and her decline into Alzheimer’s. She died in 1999.

Artikel erschienen am Sa, 23. Juli 2005
Canettis Antipathie gegen jedwedes Spezialistentum ist bekannt. Eine Aufzeichnung von 1943 ist viel zitiert worden, in der er behauptet, sein ganzes Leben sei "nichts als ein verzweifelter Versuch, die Arbeitsteilung aufzuheben und alles selbst zu bedenken, damit es sich in einem Kopf zusammenfindet und darüber wieder Eines wird. Nicht alles wissen will ich, sondern das Zersplitterte vereinigen." Obwohl es beinahe sicher sei, daß ein solches Unternehmen nicht gelingen könne, sei schon die geringe Aussicht allein jede Mühe wert. In jedem einzelnen stecken mehr Möglichkeiten, als sich in einem kurzen Leben realisieren lassen; ein zentraler Begriff aus dem "System' Canetti schließt hier an, die "Verwandlung". Er wolle "alles in mir fühlen, bevor ich es denke", der Dichter habe "der Hüter der Verwandlungen" zu sein. Er sollte sich zum einen das "literarische Erbe der Menschheit zu eigen machen, das an Verwandlungen reich ist." Und die Dichter sollten sich selbst verwandeln, ununterbrochen, um in einer Welt der Spezialisierung, der Arbeitsteilung und der angehimmelten "Produktion" zu zeigen, daß es menschliche Vielfalt überhaupt noch gibt. Gewiß hat Canetti seinen Begriff von "Verwandlung" nur umkreist, ihn nie hart definiert; aber die Schwierigkeit, Canetti gerecht zu werden, könnte tatsächlich darin liegen, daß sein eigentlicher, kaum beschreibbarer Kern "Verwandlung" war, die nach Canettis Auffassung den Menschen vom Tier unterscheidet: "Ich glaube, der Mensch ist das Verwandlungstier. Er ist so zum Menschen geworden, weil er die Begabung zur Verwandlung entwickelt hat."
In Canettis Hauptwerk zeigt sich seine Verwandlungslust am deutlichsten - nicht in der "Blendung" oder in "Masse und Macht", sondern in den "Aufzeichnungen". Die zwei Bände der Gesamtausgabe, 1000 Druckseiten, umfassen vielleicht ein Zehntel der geschriebenen Aufzeichnungen, sie sind hart ausgelesen und zeigen längst nicht alle Verwandlungsmöglichkeiten ihres Verfassers. Er hat seit 1942 fast jeden Tag Aufzeichnungen geschrieben, mehr als 50 Jahre lang, und auch die früheren, lückenhafteren Notizen seit Mitte der zwanziger Jahre sind von beträchtlichem Umfang. Canetti ist wahrscheinlich der Autor des 20. Jahrhunderts, der sich am meisten reflektiert hat - und alles an Welt, was er in sich "aufgenommen' hat. Er hat sich heftig gegen jeden Versuch zur Wehr gesetzt, die eigene Verwandlungslust einzuengen; weder Begriffen noch Systemen noch eben auch Menschen scheint das gelungen zu sein, soweit wir wissen.
All dies macht prima vista plausibel, daß der Mann auch in seinen privaten Beziehungen etwas gegen Paarbindungen gehabt haben muß, schon aus sozusagen weltanschaulichen Gründen. Die Fixierung auf eine einzige Partnerin hätte seine proteischen Leidenschaften eingeschränkt, ganz abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit einer dauerhaften Bindung. Vielleicht ließen sich Canettis Verhältnisse mit Niklas Luhmann als Sonderform romantischen - paradoxen - Weltverständnisses beschreiben: "Erfahrung der Steigerung des Sehens, Erlebens, Genießens durch Distanz. Der Abstand ermöglicht jene Einheit von Selbstreflexion und Engagement, die im unmittelbaren Genuß verlorengehen würde." Das "Identischbleiben beim Aufgehen im Anderen" würde am besten funktionieren, indem es bei einer imaginären Vereinigung bliebe, die das Einmalige, Ungewöhnliche freigäbe und keine Vorkehrungen für einen Alltag träfe, er fände einfach nicht statt. An seiner Stelle gäbe es immer Neues, auch neue Lieben - ein romantisch-hysterisches Konzept des dauernden Wandels, das gar nicht erst versucht, Ehe und Liebe zu versöhnen. m so erstaunlicher ist nun, daß Elias Canetti verheiratet war, von 1934 bis zu ihrem Tod 1963 mit Venetiana (Veza) Taubner-Calderon, und von 1971 bis zu ihrem frühen Tod 1988 mit Hera Buschor. Im folgenden soll der Verlauf dieser Ehen knapp skizziert werden, unter Berücksichtigung von Canettis paarkritischen Aufzeichnungen. Seine erste Ehe ist geradezu ein Musterbeispiel für eine optimale Verwandlungskonstellation; mit einem geläufigen Bild von Ehe hatte sie freilich nichts zu tun. Veza Taubner war acht Jahre älter als er, kennengelernt hat er sie in der 300. Vorlesung von Karl Kraus in Wien (1924), die Begegnung ist in der "Fackel im Ohr" beschrieben. Bis zu einem Besuch bei ihr in der Ferdinandstraße dauerte es ein Jahr, seit 1925 dürften sie auch ein Liebespaar gewesen sein. Veza Taubner war literaturkundig und hat sich zweifellos als literarische Mentorin des Chemiestudenten Canetti betätigt; in seinen Notizblöcken der Zeit finden sich etliche Bemerkungen seiner ersten Leserin, die gelegentlich seine Skizzen kommentierte. Sie scheint in dieser Zeit nicht selbst literarisch gearbeitet zu haben. Die Beziehung war sicher einigermaßen offen, 1928 und 1929 reiste Canetti einige Wochen lang ohne seine Freundin nach Berlin und war dort mit einer anderen Freundin zusammen, mit der ungarischen Lyrikerin Ibby Gordon; von Vezas Eifersucht ist sehr schief und indirekt in der "Fackel im Ohr" die Rede, das wirkliche Verhältnis zu Gordon muß man sich zusammenreimen. Nachdem die "Blendung" im Manuskript beendet war - sie hieß zu diesem Zeitpunkt nicht "Kant fängt Feuer", wie Canetti angibt, sondern "Brand fängt Feuer" -, veränderte sich die Beziehung grundlegend. Im ersten Halbjahr 1932 muß Veza Taubner ein Kind verloren haben; und das wohl nicht zum ersten Mal, einigen Andeutungen im zugänglichen Teil des Nachlasses nach zu schließen. Sie entschied, daß das nun das letzte Mal gewesen sein sollte. Beide verstanden ihr Verhältnis zwar als "unlöslich", aber das "dürrste in unserer Beziehung" sollte getrennt werden. Veza Taubner hat das Elias Canetti in einen seiner Notizblöcke geschrieben, im November 1932, im Wissen auch um seine Seitensprünge und den Altersunterschied, den sie stark empfand. Ihre Interessen hätten sich verlagert; sie hatte selbst angefangen zu schreiben - von einer "Unwälzung" ist in ihrem Brief die Rede -, ihre erste Erzählung wurde im Juni 1932 unter dem Pseudonym "Veza Magd" gedruckt. Damit war sie kurzzeitig erfolgreicher als ihr späterer Mann, von dem zu diesem Zeitpunkt noch nichts gedruckt vorlag. Sie war - über ihr literarisches Wissen - zwar auch seine Lehrerin gewesen, nun aber, als Schriftstellerin angeregt von der "Blendung", war sie auch seine Schülerin. Das wußte niemand in der Wiener Bohème, in der sich beide bewegten, höchstens ein paar enge Freunde wie Ernst Fischer und Ruth von Mayenburg. Für den ohnehin eifersüchtigen Canetti muß das eine schwer erträgliche Situation gewesen sein, in der ihm die Freundin nun auch noch die sexuelle "Zuhandenheit' aufkündigte; Ende 1932 fangen denn auch seine Notizen über "Paare" an, die er nicht mehr sehen konnte. Selbst alles andere als autonom, begann er (vergeblich), sich zu maßregeln: "Vergiß auf ein Jahr, daß es Männer und Frauen gibt. Vergiß alle Paare. Wenn du ein Paar doch siehst, dann reiße die beiden auseinander. Höre die Worte nicht, die sie aneinander richten. Zieh ihnen die Haut ab, daß ihre Körper nicht zueinander finden. Befreie dich von den Paaren. Verbanne deine Weiber. Verbanne dich Mann. Daran wende deine Leidenschaft." Noch wenige Jahre später sah er die Erde "überzogen, überwachsen, vergiftet mit Paaren". Erschwerend mag noch dazugekommen sein, daß die paargebundenen "Weiber", von denen in diesen frühen Aufzeichnungsblöcken die Rede ist, der Pan-Sexualität seiner Phantasie nur noch eingeschränkt zur Verfügung standen. 1933 zog Canetti zu Veza Taubner und ihrer Mutter in die Wiener Josephstadt, 1934 heirateten die beiden, ohne ein Indiz, daß sich die Bindung vorher noch einmal grundsätzlich verändert hätte. Die Ehe war also eine Bohemièn-Ehe, mit freigestellten sexuellen Verhältnissen; allerdings war Veza Canetti stets über die Freundinnen ihres Mannes informiert, und sie konnte schon kräftig intrigieren, wenn ihr die eine oder andere nicht paßte. Nach dem Umzug in die Grinzinger Himmelstraße kam Frieda (Friedl) Benedikt dazu, als Schülerin - die "Blendung" war 1935 erschienen - und Geliebte Canettis, die das Exil mit ihrem Meister teilen wollte. Daß Veza Canetti sie toleriert hat, wird nicht zuletzt durch die Figur "Hilde" in ihrem Roman "Die Schildkröten" deutlich (entstanden 1939, veröffentlicht postum 1999), ein freundliches Porträt Friedl Benedikts. Im englischen Exil lernten die Canettis die Malerin Marie-Louise von Motesiczky kennen; sie wurde zur dritten Frau und vermittelte den beiden ein bombenberuhigtes Quartier in der Nähe von London. Diese Konstellation blieb einige Zeit stabil. Canetti empfand seine Frauen als künstliche Familie. Seine eigene hatte er verloren, nur der jüngste Bruder Georg war ihm geblieben; der mittlere, Nissim, bedeutete ihm nicht viel, weiter entfernte Mitglieder der Familie lebten auf viele Länder verstreut. Veza, Friedl und Marie-Louise waren eine neue Familie aus "falschen Frauen und Schwiegermüttern, aus Kindern, die nicht seine eigenen sind, aus Mahlzeiten, faulen Reden, Gehässigkeiten und alten Briefen." Bürgerliche Lebensverhältnisse waren ihm ein Greuel geblieben: "Drum nimmt er sich mehrere Frauen und weist jeder die Rolle eines anderen Familienmitglieds zu. Diese ist Mutter, jene ist Schwester, die dritte Tochter. Jede hält sich außerdem auch für die Frau. Er will ja keine Familie haben." Um keinen Ehe-Alltag zulassen zu müssen, wohnte er meistens allein; Veza und Elias Canetti waren schon auf getrennten Wegen nach England gekommen, sie war zunächst einige Monate bei ihrem Bruder in Surrey geblieben. Auch nachdem sie sich wieder getroffen hatten, im Sommer 1939, behielten sie die meiste Zeit getrennte Wohnungen. Sie sahen sich jeden Tag, manchmal nur auf eine Stunde, zum Tee. Erst seit 1954 lebten sie wieder ständig zusammen, in der Thurlow Road in London, als Veza zu kränkeln begann und ihre bis dorthin gescheiterte Schriftsteller-Existenz beendete. Canetti hatte also ein Bedürfnis nach komplizierten, äquilibristisch hoch anspruchsvollen Konstellationen, die eine gleichmäßige Paarbeziehung verhinderten und jederzeit (kurzfristig, kurzzeitig) erweiterbar waren; und sie wurden in Krisensituationen umsortiert, besonders nach dem Tod nahestehender Menschen. Er hat seine Mitkegelinnen und Mitkegel selbst mehrfach in der Weise umgruppiert, wie er das 1942 einer anonymen Entität zugeschrieben hat: "Am ehesten gleichen wir Kegeln. In Familien stellt man uns auf, es sind ungefähr neun. Kurz und hölzern stehen wir da, mit den Mitkegeln wissen wir nichts anzufangen. Der Schlag, der uns niederwerfen soll, ist lange vorgebahnt; blöde warten wir ab; im Fall reißen wir so viele Mitkegel um, als wir nur können... Es heißt, daß man uns wieder aufstellt. Doch wenn dem so ist, so sind wir im neuen Leben genau dasselbe, nur unter den Neun, in der Familie, haben wir den Platz gewechselt, selbst das nicht immer, und hölzern und blöde warten wir auf den nächsten Schlag." Zu diesem Zeitpunkt hatte er erst einmal umsortiert, 1937, nach dem Tod seiner Mutter. 1953 besetzte er die Positionen neu, nachdem Friedl Benedikt gestorben war; und ein letztes Mal 1963, nach dem Tod von Veza Canetti. Wie eingangs schon angedeutet, ist Canettis Paar-Haß nicht auf ein rein biographisches Phänomen zu reduzieren. Er erstreckt sich ebenso auf Abstraktionen und deren Gegensätze. Kurz nach dem Abschluß von "Masse und Macht", nach mehr als zwanzig Jahren intensiver Arbeit, bemerkt er, er habe darin zu wenig über den Haß nachgedacht. "Das ist aber ungeheuer wichtig und außer den Gemeinplätzen über Liebe und Hass, die mich an andere nichtssagende Paare wie Geburt und Tod, Tag und Nacht u.s.w. erinnern, habe ich noch nie etwas über Hass gelesen, das mir Eindruck gemacht hätte." Den Sprung zwischen Begriffen und Personen vollzieht er in dieser Aufzeichnung selbst: "Es ist mir schon immer aufgefallen, daß der Gegenstand meines Hasses wechselt, aber nicht zu rasch und zu häufig. Der Hass braucht Zeit, in der er alles an sich zieht, das ist sehr leicht zu begreifen. Aber wie kommt es zu diesen erstaunlichen Sprüngen im Hass? Warum heute diesen und nächstes Jahr jenen? Am besten - das ist unleugbar - eignen sich dazu Leute, die man gut kennt. Man hebt sie aus einem Geflecht der Gewohnheiten heraus, man isoliert sie. Ihre Bedrohlichkeit gibt man ihnen selbst. Es kommt gar nicht darauf an, daß sie wirklich bedrohlich sind." Nach Veza Canettis Tod wiederholte Canetti die letzte Reise nach Griechenland, die er mit ihr zusammen zwei Jahre zuvor unternommen hatte. Im Haus eines englischen Freundes in Katounia, auf der Insel Euböa nördlich von Athen, notierte er: "Ich lebe nur noch, um ihren Namen unsterblich zu machen. Es darf nie wieder etwas von mir erscheinen, ohne ihren Namen zu tragen. Es darf nie ein Mensch je von mir erfahren, ohne zu wissen, daß sie das Beste an mir war und ist." Alle Lebendigen, die ihn und Veza gekannt hatten, wurden abgewertet, seine tote Frau wurde fast zu einer angebeteten Ikone. Keine Spur mehr von den Distanz-, auch Überdruß-Äußerungen, die es zu ihren Lebzeiten zuhauf gegeben hatte. Nachdem die wirkliche Paarbildung nicht mehr erfolgen kann, wird eine literarische institutionalisiert, obwohl alle Zweifel in Kraft bleiben. Einen Tag später heißt es: "Es ist mir unbegreiflich, was Menschen für einander sind. Wer verwickelt sich in wen? Wie sehr? Warum? Alle großen Beziehungen sind mir ein Rätsel." Aus all der Veza-Glorifizierung mag man eine Note von Wiedergutmachung herausspüren, die er während ihrer Lebenszeit versäumt hatte; auch seinen beginnenden Erfolg hat sie nicht mehr erlebt, die dritte deutsche Ausgabe der "Blendung" - und die erste erfolgreiche - erschien wenige Wochen nach ihrem Tod. anz unabhängig von der Veza-Fiktion, an der Canetti in den nächsten Jahren und Jahrzehnten arbeiten wird, geschieht mit dem immerhin knapp 60jährigen etwas Denkwürdiges. Seit Mitte der fünfziger Jahre kannte er Hera Buschor, eine 1933 geborene Restauratorin, die in der Werkstatt eines seiner Nachbarn in Hampstead arbeitete. Sie können sich nicht allzu oft getroffen haben, das aber mit wachsender Zuneigung; etwa Anfang der sechziger Jahre müssen sie sich ihre Liebe gestanden haben, ohne daß sie schon ein Verhältnis eröffnet hätten. Hera Buschor hat auch Veza Canetti noch kennengelernt. Um die Jahreswende von 1963 auf 1964 hat Canetti Depressionen, seinem Freund H. G. Adler hat er später erzählt, er habe schon einen festen Termin zur Ausführung seines Selbstmord-Vorsatzes gehabt. Hera habe ihn gerettet, weil sie unangekündigt zu Besuch kam; jetzt erst wird aus den beiden ein Liebespaar. Seit 1960 arbeitete sie in Zürich, im Kunsthaus; Canetti wird in den nächsten Jahren zwischen London und Zürich pendeln, nach der Geburt seiner Tochter 1972 immer seltener die Londoner Wohnung in Anspruch nehmen. Zum ersten Mal in seinem Leben unterzieht er sich einer traditionellen Paarbindung, heiratet, wird Vater, diesmal ausdrücklich ohne Nebenverhältnisse; er hat diesen Umbruch als Wunsch seines 1971 gestorbenen Bruders Georg rationalisiert. Auch ihn hatte Hera Buschor noch kennengelernt, und er soll sich von seinem Bruder die Gründung einer Fortpflanzungsfamilie gewünscht haben. Daß Canetti mit allen früher vorgebrachten Lebensmaximen brach, mußte er wenigstens mit einem patriarchalischen Diktum tarnen; das romantische Konzept vom Einzigartigen, Offenen war auf Dauer zu stellen. Er muß erkannt haben, daß seine Emotionen plötzlich doch nicht so singulär waren, wie sie ihm immer vorgekommen waren, daß er mit dieser Frau als Paar zusammen leben wollte. Das war nun wieder für den eigenen Originalitätsanspruch schwer zu verkraften, es gibt deshalb Aufzeichnungen, die Paarbildung als ein Privileg imaginieren, das nur ihm allein zukomme. Es sei "etwas Beleidigendes an diesen Paaren, die dasselbe tun wie Hera und ich". Aus dieser Stimmung heraus entwarf er eine Machtphantasie: "Ein Machthaber beschließt, daß er allein lieben darf. Allen Anderen ist Liebe verboten. Er läßt sie bewachen, sie werden erbarmungslos bestraft. Paare, die vor ihn gebracht werden, verhört er persönlich. Ihre Übertretung empfindet er als furchtbares Verbrechen." Dieser Staat erhält sich durch künstliche Befruchtung, in der höchsten Form des Lebens liebe eben nur einer für alle - eine Art Insektenstaat also. Canettis Gegenreaktionen beruhigten sich, die Beziehung konsolidierte sich, er empfand, er habe sein "Gewölbe' gefunden und versuchte sogar, seine Kontroll- und Eifersuchtsanfälle in den Griff zu bekommen. Diese "Verwandlung' ist kaum zu überschätzen; sie umfaßt alle Bereiche, Canettis Lebensrhythmus ebenso wie seine tägliche Arbeit. Er konnte ein regelmäßiges Pensum bewältigen, von den Arbeitsschwierigkeiten vorangegangener Jahrzehnte ist nichts mehr zu spüren. Es gelang ihm sogar, über den Krebstod von Hera hinaus diese Regelmäßigkeit zu erhalten, der Zwang zur neuen Kegel-Sortierung blieb aus. In den Jahren seiner zweiten Ehe schrieb er seine erfolgreichsten Werke, die entgegen der zahlreichen Widmungen keineswegs in erster Linie dem Andenken Vezas zugewandt waren, sondern seiner neuen Familie die Geschichte der ersten Lebensjahre erzählten, ein bißchen sicher auch "für wenn ich tot bin'. Überlegungen, die eigene Kindheitsautobiographie niederzuschreiben, gibt es zwar bereits seit 1941; umgesetzt hat er diesen Plan aber erst nach einer Schiffsreise der schwangeren Hera donauabwärts, bis zu seiner Geburtsstadt Rustschuk. Sie schrieb oder telegraphierte ihm von jeder Station, fand auch das Geburtshaus, obwohl sie nur wenige Stunden Aufenthalt hatte. Allein die Vorstellung, daß sie sich an den Orten seiner Kindheit aufhielt, setzten einen flow an Erinnerung bei ihm frei. Am deutlichsten wird Canettis "Verwandlung' an den Charakterskizzen "Der Ohrenzeuge". Das Bändchen ist seiner Frau und seiner Tochter gewidmet: "Für Hera und Johanna", und es ist sein heiterstes Werk. Die meisten der kuriosen Charaktere können ihrem Wahn nur frönen, wenn sie dabei wahrgenommen werden; sie können nicht mehr für sich allein verrückt sein. Hera Canetti hat ihren Mann bis ins Werk hinein sozialisiert; sie muß eine erstaunliche Frau gewesen sein.
Von Sven Hanuschek erschien zuletzt "Elias Canetti. Biographie" (Hanser, München. 800 S., 29,90 EUR.).

Artikel erschienen am Sa, 23. Juli 2005
Die Welt: Elias Canetti wird hundert Jahre alt. Was ist Ihrer Meinung nach das Bleibende an seinem Werk?
Robert Menasse: Was von Canetti bleibt, ist sicher sein Anspruch, mit den Mitteln der Literatur sein Jahrhundert bei der Gurgel zu packen. Und gleichzeitig hat Canetti als Mensch und Autor den Anspruch erhoben, einfach nicht zu sterben. Wobei er eben bereit war, gemeinsam mit dem Tod einen Kompromiß zu finden. Da niemand ewig leben kann, hat Canetti dem Tod angeboten, 90 Jahre alt zu werden. Das wird heute in der Diskussion um Canetti gern vergessen. Ich finde aber, genau diese Position ist das Wichtige: Ich als Autor habe dem Tod etwas entgegenzuhalten, etwas, das mich sogar in eine Verhandlungsposition bringt.
Die Welt: Canetti hat einmal geschrieben: "Ein Dichter braucht Ahnen." Was haben Sie von Canetti für Ihr eigenes Schreiben gelernt?
Menasse: Für mich war sicher Canettis Anspruch als Schriftsteller wichtig. Das ist der Anspruch, die größtmögliche Form von literarischer Totalität herzustellen. Deshalb steht sein Werk als erratischer Block in der deutschsprachigen Literaturlandschaft und läßt viele Werke seiner Kollegen wie kleine Kieselsteine erscheinen. Das zeigt sich besonders in der österreichischen Literaturszene nach 1945, deren Vertreter die sogenannte Caféhaus-Literatur reinszenierten und ihrem Staatspreis entgegen dämmerten. Ein österreichischer Autor meiner Generation hatte eigentlich nur die Wahl zwischen dem selbstgefälligem Kleingeist und zwei wirklich bedeutsamen Autoren: Canetti und Heimito von Doderer, die beide auf völlig verschiedene Weise literarisch aufs Ganze gingen.
Die Welt: Es gibt etwas, was Canetti aus der österreichischen Kunstsprache geschöpft hat: den Sprachwitz, das Satirische in der Nachfolge von Johann Nestroy und Karl Kraus. Was zeichnet einen Satiriker à la Canetti aus?
Menasse: Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff "Satiriker" auf Canetti zutrifft. Ich glaube vielmehr, daß er eine besonders ätzende Form der Ironie entwickelt hat. Robert Musils Satz über die Ironie besagt folgendes: Ironie ist, wenn man einen Kardinal so beschreibt, daß sich ein Bolschewik betroffen fühlt. Canetti hat diesen Musilschen Anspruch noch radikalisiert. Gerade in Roman "Die Blendung" ist etwa der Unterschied zwischen dem Wiener Hausmeister und Hitler nur ein gradueller.
Die Welt: Im zweiten und dritten Teil von Canettis Autobiographie wird fast ausschließlich vom Wien der Zwischenkriegszeit erzählt. Es ist das "rote Wien" als Enklave innerhalb der erzkonservativen Ersten Republik. Eine Stadt, in der Canetti Karl Kraus, Hermann Broch, Robert Musil, Alma Mahler-Werfel und vielen anderen Künstlern begegnet. Nun hat Canetti diese biographischen Teile in den achtziger Jahren verfaßt. Ist das nicht ein Anachronismus?
Menasse: Wenn man Canettis Autobiographie liest, dann sollte man eine Stelle aus seiner Studie "Masse und Macht" vor Augen haben: Der Herrscher ist deswegen groß, weil er alle anderen überlebt. Er überblickt das Schlachtfeld voller Leichen und herrscht ab jetzt mit noch größerer Macht. Unter dieser Perspektive keucht geradezu Canettis Lebensbeschreibung vor Befriedigung darüber, daß alle, die darin vorkommen, bereits tot sind - entweder physisch oder was ihre künstlerische Bedeutung betrifft. Das ist die neurotische Energie, mit der Canettis Autobiographie aufgeladen ist: Ich lebe, aber ihr seid tot. So gesehen war Canetti ein Kotzbrocken. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß es nur einen einzigen Leser gibt, der Canetti für einen sympathischen, liebeswürdigen Menschen hält. Man muß Canetti hassen, um seinen literarischen Anspruch verstehen zu können.
Die Welt: Als Canetti 1981 den Literaturnobelpreis erhielt, hat Österreich ganz offen versucht, ihn einzugemeinden. Ist er der geheime Übervater der österreichischen Literatur?
Menasse: Elias Canetti ist sicher ein Beute-Österreicher. Aber es gibt da eine ganz andere, viel wichtigere Geschichte. Canetti war nämlich der Verhinderer des ersten wirklich österreichischen Nobelpreisträgers. Was wenig bekannt ist, aber heute als wissenschaftlich überprüft und gesichert gilt, ist die Tatsache, daß auf Canettis Initiative Heimito von Doderer 1965 nicht den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Als bekannt wurde, daß auf der letzten Short-List der Akademie Doderers Name stand, sah sich Canetti durch sein Nahverhältnis zur österreichischen Kultur zum Handeln gezwungen. Er schrieb einen Brief an die königlich-schwedische Akademie, in dem er sie informierte, daß Doderer NSDAP-Mitglied gewesen war. Canetti hat sogar Doderers Mitgliedsnummer recherchiert und bekannt gegeben. Natürlich war die Akademie Canetti äußerst dankbar, weil er sie vor einer anscheinend großen Peinlichkeit bewahrt hatte. Und damit war Canetti selbst zu einem preiswürdigen Autor avanciert. Was Canetti an die Akademie aber nicht geschrieben hat, ist der Umstand, daß Doderer aus Verblendung in die NSDAP zu einem Zeitpunkt eintrat, als diese in Österreich verboten gewesen ist. Nach dem "Anschluß" Österreichs an Hitler-Deutschland ging Doderer im Angesicht des Nazigreuels auf klare Distanz und konvertierte zum Katholizismus. Doderer hat durch seine NSDAP-Mitgliedschaft zu keinem einzigen Zeitpunkt einen Vorteil gehabt. Nach 1945 hatte er sogar einige Jahre Schreibverbot. Und deswegen ist es letztlich durchaus richtig, Canetti als ersten österreichischen Nobelpreisträger zu führen, nämlich als Statthalter Doderers.
Die Welt: Canetti hat sich in sehr vielen Gattungen probiert, die Genres aber immer rasch gewechselt. Ist er ein Unbehauster, der als sephardischer Jude die Rolle des schreibenden Ahasver übernommen hat?
Menasse: Wenn man bedenkt, daß Canetti zwanzig Jahre an "Masse und Macht" gearbeitet hat, ist es ein wenig kühn zu behaupten, er sei etwas rastlos gewesen. Andererseits stimmt es, daß Canetti bei keiner Form geblieben ist, sobald er meinte, sie mustergültig zu beherrschen. Dazu kommt noch, daß Canetti vielleicht als einziger Autor einen Gedanken Adornos realisiert hat. Nämlich, keinen anderen Autor neben sich gelten zu lassen. Canetti tilgt ja sogar in seinem Werk die Spuren derer, denen er etwas zu verdanken hat. Canetti schreibt über Massen, aber in "Masse und Macht" kommt kein einziger Massentheoretiker vor, der bislang über dieses Phänomen geschrieben hatte. Canetti hat sie aber alle gelesen. Und Ortega y Gasset, Marx und Freud fehlen einfach. Es gibt sie nicht, es gibt nur Canetti! Und im ersten großen Interview zu "Masse und Macht" sagte er dann: "Ich verdanke alles den Buschmännern." Dieser Canetti ist doch ein widerlicher Kotzbrocken. Andererseits: Welcher große Autor, außer mir selbst, ist schon sympathisch? Canetti ist durch sein Werk ein erratischer Block. Und man braucht eigentlich einen Preßlufthammer, um mit diesem Werk adäquat umgehen zu können.
Die Welt: So wie Sie Canetti beschreiben, ist er aber dann doch ein Unbehauster, einer, der ganz allein da steht.
Menasse: Ja, in gewisser Weise stimmt das. Irgendwie ist Elias Canetti ein Untoter. Seine Person und sein Werk sind ganz solitär. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir erfahren würden, daß Canetti in seinen letzten Lebensjahren auf die Frage "Wie geht es Ihnen?" geantwortet hat: "Danke, es ist sehr einsam hier oben."
Die Fragen stellte Andreas Puff-Trojan
N Z Z Online
Neue Zürcher Zeitung, 23. Juli 2005, Ressort Literatur und Kunst
Von Franz Haas
Elias Canetti: Werke, Band 10: Aufsätze – Reden – Gespräche. Verlag Carl Hanser, München 2005. 395 S., Fr. 49.60.
Elias Canetti: Aufzeichnungen für Marie-Louise. Aus dem Nachlass herausgegeben und mit einem Nachwort von Jeremy Adler. Verlag Carl Hanser, München 2005. 119 S., Fr. 23.70.
Helmut Göbel: Elias Canetti. Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005. 160 S., Fr. 15.80.
Vor kurzem ist der Schlussband der gesammelten Werke Elias Canettis erschienen, der indes nicht viel Neues enthält. Aber der Autor hat zu Lebzeiten für seinen Nachruhm gesorgt und die staffelweise Freigabe von Teilen aus dem Nachlass angeordnet. So sind nun die «Aufzeichnungen für Marie-Luise» aus Londoner Kriegstagen zu lesen.
Er war nicht nur ein Experte von Masse, Macht und Unsterblichkeit, Elias Canetti studierte auch die Mechanismen von Erfolg und Ruhm. In einer der bisher unbekannten Aufzeichnungen von 1942 heisst es: «Wer den Erfolg anbetet, ist auf jeden Fall verloren», zumal in kommerziellen Zeiten. Früher «hiess der Erfolg noch Ruhm; vielleicht war er damals schöner». Er aber habe «nie auf den Ruhm hingearbeitet», sagt dreissig Jahre später der noch nicht Weltberühmte in einem Interview. In seiner Sammlung «Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere» von 1974 gibt es auch den «Ruhmprüfer», eine spöttische Miniatur über die Eitelkeit der Rivalen und zugleich ein spöttisches Selbstporträt: «Täglich durchfliegt er die Zeitungen nach neuen Namen (. . .). In allen vorhandenen Lexika schlägt der Ruhmprüfer nach und findet den Gesuchten zu seiner Zufriedenheit nirgends.» Wie wichtig dem Ungläubigen ein ruhmreiches Leben nach dem Tod war, zeigen Canettis testamentarische Anordnungen zu seinem Nachlass. Er wollte noch lange Geheimnisse haben – erst im Jahr 2024 sollen gewisse Schriften zugänglich werden, soweit er sie nicht vorsorglich vernichtet hat.
So wird der zehnte und letzte Band der Werkausgabe, die eben erschienenen «Aufsätze – Reden – Gespräche», noch lange nicht das Letzte von Canetti sein – und er enthält auch nicht viel Neues. Von den 37 hier versammelten Texten sind ganze 6 Erstdrucke. Das Glanzstück darunter ist der Aufsatz «Proust – Kafka – Joyce», den Canetti sich 1948 abringt für einen Vortrag in London, nach Jahren der schlimmsten Schaffenskrise, angetrieben von den fürsorglichen Drohungen seiner Frau Veza. Zur gleichen Zeit geht gerade sein früher Geniestreich «Die Blendung» zum zweiten Mal in einer deutschen Ausgabe unter, die englische Übersetzung folgt erst im Jahr darauf. Er ist sich trotzdem seines literarischen Wertes bewusst und will den drei grossen Romanciers als ihresgleichen gegenübertreten. Mit blitzender Gescheitheit, ganz «König der Klugen», inspiziert er die Jahrhundertromane der Kollegen. Canetti tritt einen Schritt zurück und betrachtet die Riesenwerke aus der Distanz des Eingeweihten. Vor allem beschreibt er das Verhältnis der Autoren zu ihren Familien – und zwischen den Zeilen steht das Desaster mit der eigenen Verwandtschaft. Bei Proust schätzt er die Zärtlichkeit für die Mutter und «die Wissenschaft der Erinnerung», die ihm die Vergangenheit erschliesst. Bei Kafka fasziniert ihn der Kampf mit dem Vater und «seine scheinbar privaten Schlachten mit der Zukunft». An Joyce gefällt ihm die Unerbittlichkeit, mit der er sich von der Familie und von Dublin trennte, um die Stadt in ihrer ganzen Gegenwart und «Simultaneität» im Roman wieder aufzubauen. Mit staunender Bewunderung umkreist er diese Vorbilder, die vielleicht doch nicht so leicht zu erreichen sein werden.
So verschieden die drei Autoren in ihrem Blick auf Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sind, gemeinsam ist ihnen, so Canetti, der «autobiografische Charakter» ihrer Werke, die auch alles über ihr Leben enthalten. «Biografien, die später von anderen Autoren geschrieben wurden, haben dem nichts Wesentliches oder Unentbehrliches hinzugefügt.» Das ist ein Ideal von Literatur, das er – Canetti ahnt es – nicht erfüllen wird. Zwanzig Jahre sind vergangen seit der Idee zu seinem riesigen Projekt einer «Comédie Humaine an Irren», von der 1935 nur ein kleiner Teil als «Die Blendung» erschienen ist, und weitere Jahrzehnte wird er sich vergeblich mit einer Fortsetzung abmühen. Im Aufsatz über Proust, Kafka und Joyce blitzt noch viel Hoffnung für sich selbst auf. In der Autobiografie wird er im Alter versuchen, das «Wesentliche» über sich zu sagen und wird trotz Welterfolg nicht ganz davon überzeugt sein.
In den nun erstmals versammelten Aufsätzen, Reden und Gesprächen kommt Elias Canetti nicht gern auf sein unterbrochenes Prosawerk zu sprechen, trotzdem sind sie ein beredter Querschnitt durch seine Welt. Zum Beispiel der schöne, anerkennende Brief an den Autor Hans Günther Adler («Jenseits von Groll und Bitterkeit») oder die Huldigung an den Bildhauer Fritz Wotruba – mit dem er später in den geheimen Aufzeichnungen verbittert abrechnet, ganz in diesseitig grollender Menschlichkeit. Viele Texte beziehen sich auf «Masse und Macht», sind Kommentare oder beherzte Rechtfertigungen dieser enormen Studie, die das literarische Werk unterbrach. – Ein völlig anderer Canetti wird in den diversen Dankreden sichtbar. Diese stehen in ihrer feierlichen Milde in krassem Gegensatz zu den Aufzeichnungen und zum «Dialog mit dem grausamen Partner» in den geheimen Tagebüchern, in denen er Hohn in alle Richtungen versprüht. Vor der «Dankrede für den Preis der Stadt Wien» 1966 muss er ziemlich viel Kreide gegessen haben. Da rühmt der liebenswürdige Herr «die Schönheit dieser Stadt» und erinnert sich gerührt an den Wurstelprater, an Nestroy und Kraus. Kein Wort von Mord und Vertreibung, von arischen Peinigern und jüdischen Opfern. Akrobatische Diplomatie betreibt Canetti auch bei der «Grazer Rede» 1975, wo er der dortigen neuen Literatur und ihren «Förderern» schmeichelt – aber im Geheimen notiert er dazu eine «Floskel» von Ilse Aichinger und bewertet Alfred Kolleritsch als «peinlich glatt». Knapp und ehrlich hingegen ist sein «Dank in Stockholm», wo er sich vor «vier Männern» verneigt (Kraus, Kafka, Musil, Broch) und damit moniert, dass diese, wie so viele Grössen, niemals den Nobelpreis bekommen haben.
Selbstbewusst war schon der junge Canetti, der weder Ruhm noch Erfolg hatte und in einem Interview 1937 über das moderne Theater, die Regisseure und das Publikum herzieht und nebenbei eine Theorie zu den eigenen Dramen liefert. Verdienstvoll ist der Neudruck des berühmten Gesprächs mit Theodor W. Adorno von 1962, jene würdevolle Begegnung zweier Berggipfel, die einander höflich belauern. Canetti hat es gar nicht goutiert, dass Adorno ihm oft ins Wort fiel und wiederholt mit der Frage bohrte, ob manche Theorien von «Masse und Macht» sich nicht auch schon in den Werken von Le Bon und Freud fänden, «die ja doch auch sehr bekannt sind». – Bei anderer Gelegenheit definiert Canetti öffentlich Freuds Ausführungen zum Todestrieb als «eine wirklich etwas lächerliche Sache». Und einen «Karpfen» nannte er Adorno für sich in den geheimen Notizen.
Im «Werkstattgespräch» mit Horst Bienek sagt Canetti 1965 wieder einmal, dass er an einem zweiten Roman schreibe, von dem jedoch jede Spur fehlt. Sonst erwähnt er in den zahlreichen Interviews selten seine Vergangenheit als Romancier. In dem nun erstmals gedruckten Gespräch mit Heinz-Klaus Metzger (1967 im Radio DRS) ist wie selbstverständlich immer nur von «Masse und Macht» die Rede («das Buch», «Ihr Buch»). Ein Jahr später gesteht er aber auch seinem ehemaligen Zürcher Lehrer Friedrich Witz, dass ihn ein neuer Roman beschäftige, der «soll eigentlich dasselbe Gewicht haben wie ‹Die Blendung›». Und 1972 reibt ihm ein Gesprächspartner unter die Nase, was Canetti ohnehin weiss, dass er ein berühmter Mann sei, «weniger als Autor von ‹Masse und Macht›, wohl aber als Romancier». Da war sein einziger Roman schon vier Jahrzehnte alt. Doch Canetti hat auch wiederholt einen zweiten Band von «Masse und Macht» angekündigt. Da kamen ihm dann die Autobiografie und der Weltruhm dazwischen. – Aus weniger glorreichen Zeiten stammen die «Aufzeichnungen für Marie-Luise», die jetzt aus dem Nachlass herausgegeben wurden und (wie schon «Party im Blitz», 2003) den Autor im Gespräch halten sollen. Canetti hat diese Sammlung von Aphorismen im September und Oktober 1942 für seine Geliebte Marie-Luise Motesiczky geschrieben, eine der offiziellen Nebenfrauen, die ihn finanziell unterstützte, in deren Haus er fünfzig Jahre lang ein Arbeitszimmer zur Verfügung hatte. Er hat die Texte als Geschenk in Schönschrift kopiert und die Blätter feierlich mit einer goldenen Schnur zusammengebunden. Nun sind sie auch als Faksimiles zu sehen, trotzdem bleibt das Buch in mancher Hinsicht eine dünne Sache – keine dreissig Seiten Text –, die aber durch das grossartige, mehr als doppelt so lange Nachwort von Jeremy Adler an Substanz gewinnt. Adler schreibt mit viel Sympathie für Canetti und mit souveränem Wissen über dessen Londoner Lebenswelt, doch hat er keine Scheu, auch die Schwächen des grossen Mannes zu bezeichnen («sein Humor, der sich gerne in Geschmacklosigkeiten ergeht»). So ist dieser Band ein erhellendes Zeugnis aus finsteren Zeiten.
Elias Canetti hatte schon mit zwanzig begonnen, regelmässig Aufzeichnungen zu machen, veröffentlicht hat er aber nur die ab 1942 entstandenen. Mehr noch als in den bisher bekannten Notizen aus jenem Jahr ist die politische Gegenwart in diesen «Aufzeichnungen für Marie-Louise» präsent. Die einleitenden, dominierenden und abschliessenden Stichworte sind: der Krieg, die Opfer, der Tod, das Töten, das Sterben. Dazwischen gibt es auch andere bekannte Canetti-Themen wie chinesische Verse («sie sind alle wie beim Fischen gedichtet, an sehr ruhigen Gewässern»), die Tiere, das Feuer und Gott, den es eigentlich nur in der Bibel gibt oder «als Politiker» in seiner «Diktatur über die Erde». Manchen dieser Eintragungen sieht man sehr ihren Anlass und Hintergrund an, die nicht ganz erwiderte Liebe einer Frau: «Sie lebt in einer Wüste von Erwartungen.» Manche verwischen die Grenzen zwischen banaler Verliebtheit und allzu männlichem Balzen («Er ist eifersüchtig auf ihre abgeschnittenen Fingernägel»), oder sie glänzen durch gefällige Selbstkritik an seiner «tonnenschwere(n) Eitelkeit». – Canetti hat sehr wohl gewusst, warum er diese Seiten nicht zu Lebzeiten in das Allerheiligste, in die publizierten Aufzeichnungen «Die Provinz des Menschen», aufgenommen hat.
Erstaunlich war bisher das Fehlen einer Rowohlt-Bildmonographie, dieses Indikators von Klassizität und Wertschätzung in der Populärgermanistik. Die Lücke hat jetzt der Göttinger Germanist Helmut Göbel mass- und sinnvoll gefüllt. Sein «Elias Canetti» ist ein gelungener Kompromiss zwischen wissenschaftlichem Anspruch und jargonloser Verständlichkeit. Das kompakte Buch gibt einen sehr guten Einblick in das umtriebige Leben und das vielschichtige Werk von Canetti, dem Göbel sich mit Hochachtung, aber nötigenfalls auch mit Kritik nähert. Manchmal hätte etwas mehr Auskunft nicht geschadet, etwa wenn es in den Anmerkungen so oft heisst «Mitteilung an den Verf.», dann hätte der Leser doch gerne gewusst, wo und wann Canetti sich mitgeteilt hat, ob brieflich, telefonisch oder persönlich. Aber das liegt auch an der vorgegebenen Kürze dieser Reihe. Zudem ist dieses Bändchen im Schatten einer grossen Konkurrenz erschienen, der monumentalen Canetti-Biografie von Sven Hanuschek (NZZ 17./18. 4. 05), der vorläufig nichts «Wesentliches» hinzugefügt werden kann.
Einen sehr praktischen Aspekt hat Helmut Göbel aber mehr beachtet als Hanuschek (der auch nicht das Privileg von «Mitteilungen» Canettis hatte), nämlich das finanzielle Problem. So erfährt man, dass die Canettis eine Zeit lang ganz gut leben konnten vom «Verkauf des Hauses in Manchester und mehr noch von der Lebensversicherung» des 1912 früh verstorbenen Vaters. «Immerhin ist so viel Geld doch vorhanden», dass die Mutter mit ihren drei Söhnen noch 1919 «in einem Grandhotel» im Berner Oberland Ferien macht, wundert sich Göbel, der jedoch die Geldverhältnisse der folgenden Jahrzehnte auch nicht enträtseln kann. «Rätsel hinterlassen, oder du stirbst wirklich», ermahnte sich Canetti 1982 und trug mit dieser Strategie auch auf ganz profanem Gebiet zu seiner Unsterblichkeit bei.

Text: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27.02.2005, Nr. 8 / Seite 28
Der
Menschenfresser
Zu seinem 100. Geburtstag erscheint die erste große Biographie über den
manischen Bücher- und Frauenfreund Elias Canetti
VOLKER WEIDERMANN
Sven Hanuschek: "Elias Canetti. Biographie". 790 Seiten. 29,90 Euro.
Elias Canetti: "Aufzeichnungen für Marie-Louise". Hrsg. von Jeremy Adler. 120 Seiten. 12,90 Euro.
Elias Canetti: "Bilder aus seinem Leben". Hrsg. von Kristian Wachinger. 173 Seiten. 24,90 Euro.
Alle Bücher: Carl-Hanser-Verlag 2005.
27. Februar 2005 Elias
Canetti war ein Einzelner. Mit Martin Walser war er ein wenig befreundet, über
die "Blechtrommel" von Grass hat er mal ein nettes Wort gesagt, die "Jahrestage"
von Johnson hat er gelesen und geschätzt, Thomas Bernhard hielt er eine kurze
Weile für einen möglichen Geistesverwandten, mit Erich Fried verband ihn aus der
England-Zeit eine Freundschaft. Aber er lebte in anderen Welten. In anderen
Bücherwelten, die kein Kanon erreichte. Er war einer der wenigen wirklich
unabhängigen Geister der deutschen Literatur.
Im Juli ist es hundert Jahre her, daß er auf die Welt kam, und aus diesem Anlaß beginnt der Hanser-Verlag in dieser Woche einen wahren Canetti-Bücherreigen. Ein Band mit zum großen Teil bislang unbekannten Aufzeichnungen erscheint. Ein Buch mit Bildern aus seinem Leben und die erste große Biographie. Und wenn man sich so durch die Bilder blättert, die Lebensbilder, von denen einige noch nie zu sehen waren, da ist man vor allem überrascht, wie sehr Elias Canetti von Anfang an Elias Canetti gewesen ist. Der Nobelpreisträger. Der sehr kleine Herr mit sehr großer Brille, sehr großer Frisur und tiefen Stirnfalten. Ein Mann, der jeden Fotografen mit strengem Blick zu prüfen scheint. Um Haltung bemüht. Ein Leben lang. Und auf den dieser Satz, den Susan Sontag über ihn geschrieben hat, so wunderbar zu passen scheint: "Er ist ganz davon in Anspruch genommen, jemand zu sein, den er bewundern kann."
Elias Canetti wird als Sohn sephardischer Juden im bulgarischen Ruschtuk, unweit von Bukarest, geboren. Die Eltern, die in Wien eine höhere Schulbildung genossen hatten, sprechen Deutsch miteinander, wenn die Kinder es nicht verstehen sollen. Elias lernt Spaniolisch, das altmodische Spanisch, das sich die sephardischen Juden seit ihrer Vertreibung von der Iberischen Halbinsel bewahrt haben, und Bulgarisch. Als er sechs ist, zieht er mit seinen Eltern nach England, wo er die englische Sprache lernt. Kaum drei Jahre später, sein Vater ist inzwischen gestorben, zieht er mit der Mutter nach Wien und lernt in rasender Geschwindigkeit unter der Gewaltherrschaft der Mutter seine wahre "Muttersprache", wie er sie nennt: Deutsch.
Von Beginn an hat er ein manisches Verhältnis zur Sprache und zur Schrift. So hat er, der Mythomane Canetti, es sich zumindest später ausgeschmückt. Doch vielleicht war es auch so: Seine Cousine Laurica, das war noch in Ruschtuk, hatte ihn wochenlang gequält. Nicht etwa damit, daß sie ständig mit ihm Schule spielen wollte. Nein. Sie hatte sich geweigert, dem kleinen Elias das Schreiben beizubringen. Dadurch schließlich zur Weißglut gebracht, schnappte sich der Lernwütige eine Axt und verfolgte die erschrockene Cousine mit dem Schlachtruf "Agora vo matar a Laurica!" - "Jetzt werde ich Laurica töten!" In letzter Not sei der Großvater dazwischengegangen und habe Elias eindringlich über die Endgültigkeit des Todes aufgeklärt. Canetti war diese Geschichte immer Urgrund für seinen lebenslangen, wahnsinnigen, heroischen Kampf gegen den Tod. Es ist aber natürlich vor allem eine Geschichte über die Schreib- und Wissensgier des kommenden Schriftstellers. Der übrigens seinen Angriff schwer büßen mußte, als ihn Laurica kurz darauf in einen großen Topf mit kochendheißem Donauwasser stieß, der vor der Wohnungstür zum Abkühlen stand. Er wäre an den Verbrennungen fast gestorben.
Canetti war ein Geschichtenfanatiker. Ein Menschenfanatiker. "Menschenfresser", wie er sich selber nannte. Er suchte Geschichten überall, war interessiert an den abseitigsten Dingen und konnte selbst einen banalen Fahrraddiebstahl zu einem Ereignis mythischer Qualität empordichten. Alles war wichtig. Alles schrieb er auf. Unendlich vieles hat er gelesen. Der Sinologe Kien, der Held seines ersten Romans "Die Blendung", der 1931 zum ersten Mal erschien und ihm später, sehr viel später zu Weltruhm verhelfen sollte, ist auch ein Selbstbildnis, eine Selbstkarikatur. Der Herr, der nur in Büchern lebt, in seiner unendlichen Bibliothek ein selbstzufriedenes Leben führt, in einem geschlossenen System, aus dem ihn "das Leben", in diesem Fall: die hinterhältige Haushälterin, mit billigen Tricks entführt. Er ist dem Leben da draußen, den Menschen, den Betrügern, nicht gewachsen und rettet sich endlich in seine Bibliothek zurück, in der er mit all seinen Büchern verbrennt.
Canetti war ein manischer Bücherfreund wie dieser Kien. Aber Canetti war auch ein manischer Frauenfreund. Mit wie vielen Frauen hat er seine Lebensliebe, seine erste Frau, die Schriftstellerin Veza Taubner, betrogen. Meistens ganz unheimlich, manchmal im verborgenen. Im Zweiten Weltkrieg, als sie nach England geflohen waren, hatte er drei Geliebte gleichzeitig. Er fühle sich eben als Orientale, der aus "der Summe seiner Frauen besteht", erklärte er und überlegte, ob seine starken Leidenschaften womöglich vom Kriegsverlauf herrührten: "Seine Lust an den Frauen wächst mit jeder zerstörten Stadt. Ach, er kann sie nicht wieder bevölkern. Was will er von sich allein", philosophiert er über seine Lage. Die Aufzeichnungen, die er in diesen Jahren einer seiner Geliebten, der Malerin Marie-Louise, die auch seine Mäzenatin war, 1942 in Schönschrift festlich übergab und die nun erstmals erscheinen, wissen vom Krieg wenig, doch von der Liebe sehr viel. Der Krieg ist eine lächerliche Träumerei: "Alle Waffen werden abgeschafft und im nächsten Krieg ist es nur noch erlaubt zu beißen." Und eine Botschaft womöglich direkt an die Adressatin, die fast ein Leben lang darauf hoffen wird, von Canetti geheiratet zu werden: "Sie lebt in einer Wüste aus Erwartung."
Und in der blieb sie auch. Trotz Schecks und Verführungskraft. Oft genug brachte Canetti sich in dramatische Liebesschwierigkeiten, mit Abtreibungen, Väter schalteten sich ein, appellierten an Vernunft und Verantwortung des Dichters, Veza versank immer tiefer in Depressionen, drohte immer wieder mit Selbstmord. Und in der Mitte Canetti, der sich hilflos gab und lebensfroh. Als Veza 1963 starb, war er, trotz aller Nebenlieben, tief verzweifelt. Sie war das Zentrum gewesen. Jetzt wollte er auch von den Geliebten nichts mehr wissen. Das schrieb er in diesem unfaßbaren Notat: "Ich hab sie alle stehen gelassen, alle, alle, Ursula, Kathleen, Veronica, Iris, Priaulx, Natalie, Christine, Jolanda, Dea, Edith, Erika, Ruth, Susi, Jill, Martine, Kim, Kae, Lavinia, Hetta, Lucy, Helga, Eileen, Britta, Judy, Pat, Vanessa, Anthea, Elisabeth, Anna, Bernadette, Helen, Debora, Barbara, Claudie, Joan, Kiki, Ilse, Elli, Eva, alle, - weil sie Veza Veza Veza Veza Veza überlebt haben."
Eine übrigens ließ er, bei aller Liebe, bei aller Trauer, nicht stehen. Hera Buschor, mit der ihn schon vor Vezas Tod ein Verhältnis verband, wurde seine zweite Frau. Mit der er, im hohen Alter, sogar ein Kind bekam. Bevor er sich dafür entschied, fertigte er eine Liste an. Ob das zuträglich sein könne, seinem Dichterbild. In welcher Tradition er damit stehe: "Keine Kinder hatten: Kafka, Musil, Karl Kraus . . ." und so weiter. Der Dichter erschrickt ob dieser "unheimlichen Liste". Doch er strengt sich an und sucht und sucht, und schließlich finden sich auf der "Kinder-Seite" mit Männern wie Dostojewskij, Tolstoi, Goethe noch genug gewichtige Größen, um sich doch auf ein Kind einlassen zu können.
Es sind diese Geschichten, die das Lesen im Leben von Elias Canetti zu einem großen Erlebnis machen. Auch seine Feindschaften, sein ungerechter, großer schrecklicher Haß, gegen einstige Förderer wie Stefan Zweig oder gegen Marcel Reich-Ranicki, gegen Thomas Bernhard und Max Frisch. Ein Monomane von größter Selbstbezogenheit und Selbstbegeisterung. Leider wirkt die Biographie Sven Hanuscheks unkonzentriert. Am Anfang muß man auf fünfzehn Seiten lesen, warum Canetti eigentlich etwas gegen Biographien hatte, dann wird berichtet, welches Lesevergnügen seine Kindheitserinnerungen seien und was das alles mit Stendhal zu tun habe, bevor dem Leser diese Kindheit erst mal vorgestellt wird; Nebensachen werden häufig wiederholt, Hauptsachen wie Hochzeiten zunächst ganz verschluckt und später nebenbei erwähnt. Erst in der zweiten Hälfte wird es konzentrierter. Aber vermutlich hätte man auf der Hälfte der Seiten leicht ebensoviel erfahren können.
Das hat der Hanser-Verlag, der in der Biographie - zu Recht - immer und immer wieder für sein Canetti-Engagement gelobt wird, also knapp danebengesetzt. Aber Canettis Leben ist viel zu interessant, um es mit einer verplauderten Biographie wirklich uninteressant zu machen.

Title
Party in the Blitz
Author
Elias Canetti tr by Michael Hofmann
Publisher
266pp, Harvill, £17.99
ISBN
1843432048
The enemy within
(Filed: 27/07/2005)
Alex Clark reviews Party in the Blitz by Elias Canetti.
To what extent memoir can be the revelation of a personality is a vexatious subject, and probably unresolvable; in the case of a committed and serial autobiographer, whose greater ambition is to portray his setting and its inhabitants, the question takes on an added significance. During the course of these posthumously published and fragmentary pieces on 40 years' residence in England, Elias Canetti declares, gesturing to the massed evidence around him, that "I was always a spy"; but, however shrewd, penetrating and sometimes shocking his dispatches are, what they leave one with is the overwhelming impression of having somehow started - but ultimately failed - to apprehend the man himself.
He was, almost by definition, elusive. Born in Bulgaria and initially brought up speaking the Sephardic Jewish language of Ladino (he later wrote in German, works such as the magisterial Crowds and Power and the grotesque masterpiece Auto da Fe, both of which contributed to him winning the Nobel Prize), Canetti's first emigration to Britain came when he was six; later, there were lengthy periods in Zurich, Frankfurt and Vienna, whence he arrived in London at the beginning of the second world war. It is striking that, despite a title that puckishly unites conviviality and catastrophe, Party in the Blitz is obsessively concerned with the nature and the status of the guest. For Canetti, evidently, guests and exiles were frequently subject to the same pressures, and gifted the same privileges. To be invisible was one; to be insulted another.
It must have been more difficult than he makes it sound, but Canetti's thorough infiltration of English literary and artistic circles seems almost effortless. Although he often writes elliptically, ushering characters into his prose as if he himself is the host of some great party on the page, the rigorousness of his gaze is that of an anthropologist, with the party as his field of observation. "One could write a book about English parties," he writes. "I never got used to them. They strike me as senseless and heartless, every bit in keeping with such cold people. The idea, after all, is not to get too close… Sometimes you wouldn't even know who you had been talking to. Those were the ideal cases in these ritualised celebrations of non-contact." (One bridles slightly when Canetti writes with almost slack-jawed horror of "the most astounding goings-on" at a rather fruity Blitz party, although he specialises in having it both ways.)
Few of the many indigenous parties he attends meet with approval (gatherings with fellow exiles are exempt). The hospitality on offer at the critic William Empson's is the exception: "There was no fuss made of the person of the guest. He was not dragged around in that 'European' way and introduced to everyone, nor was he left in a mysterious nimbus of privilege and arrogance."
Arrogance, in all its subtle and deceptive manifestations, is the quality most frequently ascribed to the English in these pages, the flipside to the wartime stoicism that so impresses Canetti and on which he pronounces with characteristically connoisseurial delicacy: "An enemy wasn't just an enemy: you also had to take cognisance of him. There was something in that conferral of the status of enemy that was then immovable." His reading of the psyche of the English under attack - later updated to include a fascinating portrait of the population's "helpless dreams of the past" during the Falklands conflict - is tantalisingly subtle.
On individuals he is often less than subtle. He describes a woman who loses a child to a Doodlebug as "close to madness. It took a long time, half a year or more, before she recovered from the blow, and adopted a couple of coloured babies." Six months and not yet better. Imagine!
The woman in question was a virtual stranger, but Canetti's friends and, indeed, lovers, fare little better. The most celebrated of the latter was Iris Murdoch, who dedicated her novel The Flight from the Enchanter (which features a monstrous, controlling central figure) to her sometime lover. She is excoriated here as schoolgirlish and schoolmarmish by turns, the possessor of unalluringly large feet and, frankly, a rubbish line in the bedroom arts. Allowed neither her intelligence ("an all-in-one parasite from Oxford") nor her literary triumphs ("a vulgar success that swept the nation"), one wonders how she managed to fool so many people for so long.
Ditto the poet Kathleen Raine, of whom Canetti writes briskly - and seemingly without irony - that "among the people I knew for many years without ever really liking, is the poet Kathleen Raine. I always listened to her; each time she told me her tear-bedewed story, I listened. I don't know where I got the patience from. Her complaints were invariably boring." Meanwhile, Murdoch's intimate, Franz Baermann Steiner - whom Canetti did like - is described as "uncommonly ugly... a less attractive person one could scarcely imagine". That these words appear under a photograph of a perfectly inoffensive-looking man - even allowing for personal preferences - discombobulates the mind for a moment or two.
Perhaps the most damning character assassination is reserved for T S Eliot. "It will be difficult to describe Eliot as the quite abysmal character he was", writes Canetti. Chief among his complaints is that Eliot painstakingly constructed a hierarchy of poets in order to establish himself at the top. As utterly captivating as the pen portraits of Party in the Blitz are - and arresting and convincing much of its social commentary - it is hard to resist remarking, "takes one to know one".
Prize-winner with a poisoned pen
(Filed: 27/07/2005)
John Gross reviews Party in the Blitz by Elias
Canetti.
Elias Canetti won the Nobel Prize for Literature in 1981. In the English-speaking world - he wrote in German - his fairly limited fame rests mainly on two books.
One, Auto da Fe, is a dark hallucinatory novel about a scholar who burns down his own library. (It has just been reissued by the Harvill Press.). The other, Crowds and Power, is a savagely pessimistic study of politics and mass-psychology. But Canetti deserves to be remembered at least as much for the three powerful volumes of memoirs in which he described his early years in Switzerland, Germany and Austria (he was a Bulgarian Jew by origin), and in particular his encounters with leading writers in the Berlin and Vienna of the 1920s and 1930s.
In 1939, when he was 34, he and his wife Veza came to Britain. He remained here for over 40 years, but in the 1980s - Veza had meanwhile died - he moved to Zurich. It was there, at the age of 85, that he started work on a fourth volume of memoirs, an account of his time in England. He didn't live to finish it, but after his death the drafts and notes which he left were pieced together by his German publisher. The fascinating sketchbook which they form has now been translated, very stylishly, by Michael Hofmann, under the title Party in the Blitz.
Canetti was prickly, demanding and self-obsessed. He loved establishing a hold over people and eliciting their secrets. He could be arrogant and cruel. These are not necessarily drawbacks in an autobiographer, however - not, at least, when they are coupled with intelligence and powers of observation - and they lend his writing an undoubted edge.
The most ill-natured pages in the book - the ones for which it is likely to remain notorious - are those devoted to Iris Murdoch. Canetti was the guru and emotional tyrant whose spell Murdoch tried to exorcise, or at any rate explain, in The Flight from the Enchanter and other novels. He had first come into her life in 1952. Within three years or so he had been supplanted by John Bayley. But his affair with her, while it lasted, was not only tense and highly charged, but marked by complicated displays of power.
When she came to his flat to have sex with him, for instance, it was Veza who opened the door for her, and Veza who made a meal for all three of them afterwards.
The portrait of her which he drew in his old age is almost unremittingly hostile. Partly it is in a vein of harsh physical caricature. We hear about her "huge flat feet", her big legs and her "grotesque sandals". (That at some moments her face had the beauty of a Memling Madonna doesn't seem sufficient consolation.) We are told that she had the walk of "a repulsive bear, crooked and purposeful at once". There's a fondly detailed account of her excitement at having dinner with the grandson of a duke, and of her unavailing attempt to beguile him by wearing a see-through blouse.
At the same time Canetti assails her character and achievements. She was mean, petty bourgeois, opportunistic, an eternal schoolgirl (and schoolmarmish too), "a bubbling Oxford stewpot". Most damning of all, she was an "illegitimate" writer, who never suffered from having to write.
In his excellent biography of Murdoch, Peter Conradi puts down Canetti's animus against her to jealousy - residual jealousy from the days of their love-affair; jealousy of her fame and fluency as an author. (He himself never wrote another novel after Auto da Fe.) Perhaps; but whatever his motives, the attack rebounds on the attacker. It is too plainly the product of a grudge.
The only passages in the book where his hostility burns even more brightly are when he lets fly at T. S. Eliot. But here his rage is literary or cultural rather than personal. (He barely knew Eliot.) His other portraits are more nuanced, though he usually finds room for a sharp word. He can be particularly hard on women, not least women to whom he had good reason to be grateful - C. V. Wedgwood, for instance, who translated Auto da Fe and did more than anyone else to help get it published.
For all his egoism, Canetti conveys a solid sense of the world in which he moved. He hoped to emulate Aubrey's Brief Lives - he had an exceptionally strong feeling for English literature - and if he falls short of his model he still provides rewarding character studies of some personalities (the Chinese scholar Arthur Waley, for example), tantalising glimpses of others (the photographer Lee Miller, "a strikingly blonde woman with a lascivious expression, who always seemed debauched"), and some gripping set-pieces: an intimate dinner with Bertrand Russell, a poetry-reading in William Empson's basement, a conversation with Enoch Powell.
As Jeremy Adler points out in a fine introductory essay, very few fellow-refugees turn up in the memoirs (though there is a sympathetic account of a close friend, the anthropologist Franz Steiner, and a lively sketch of Kokoschka). On the other hand Canetti reports on a wide range of English figures, going well beyond the Hampstead intelligentsia which was his natural beat. You wonder how he met them all, and for that matter how he managed to support himself when he had virtually no income. But the answers to these and many other questions will have to wait for a biography.
Meanwhile he takes his leave of us with a series of generalisations - often contradictory ones - about England. He praises the country's past, falls out of love with it, takes a certain sardonic satisfaction in what he regards in its decline, anatomises the varieties of English arrogance, ends with some routine Thatcher-bashing. But it isn't the judgments themselves which detain us, but the man who makes them. It is easy to dislike him, and tempting to mock him as a little tin god, but there is something about his bristling intensity that always makes you read on.
John Gross's books include 'The Rise and Fall of the Man of Letters' (Penguin)
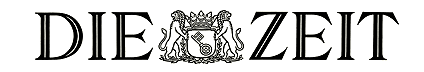
31/2005
Sven Hanuschek: Elias Canetti
Biographie; Carl Hanser Verlag, 2005; 800 S., 29,90 €
Elias Canetti: Aufzeichnungen für Marie-Louise
Aus dem Nachlaß herausgeben und mit einem Nachwort von Jeremy Adler; Carl Hanser Verlag, 2005; 119 S., 12,90 €
Penka Angelova: Elias Canetti
Spuren zum mythischen Denken; Paul Zsolnay Verlag, 2005; 318 S., 25,90 €
Wohin rennst du so fleißig?
Elias Canetti, vor hundert Jahren geboren, zeigt sich im Spiegel einer neuen Biografie als Verwandlungstier und Todesfeind
Von Dieter Borchmeyer
Als »Hüter der Verwandlung« hat Elias Canetti sich in seiner Rede Der Beruf des Dichters anlässlich seiner Münchner Ehrenpromotion 1976 bezeichnet. Der Dichter müsse alle dogmatischen Verkrustungen aufbrechen, indem er die »Vorstellung von der Variabilität menschlicher Sitten und Möglichkeiten« wachhalte. Der große Lehrmeister der Verwandlung – eine der wichtigsten Vokabeln im Weltbild Canettis – ist der Mythos, sind zumal die Metamorphosen des Ovid. Schon sein Erstlingsbuch, der Roman Die Blendung (1936) – der ohne die üblichen Schwächen einer literarischen Erstgeburt wie Athene mit voller poetischer Rüstung dem Kopf des Dichters entsprang – demonstriert die Folgen wahnhafter, sich der Verwandlung verweigernden Fixierung. Elias Canetti (1905-1994) auf dem Friedhof von Hampstead, London 1977Foto: Cornelius Meffert / Stern / Picture Press aus: «Elias Canetti. Bilder aus seinem Leben», Hanser Verlag, München 2005 BILD
Ein »Verwandlungstier« wollte Canetti sein. Nun geht Sven Hanuschek in der ersten Biografie des großen, erst spät, seit dem Büchnerpreis 1972 und vor allem natürlich seit dem Nobelpreis 1981 zu Weltruhm gelangten Dichters den Metamorphosen dieses proteischen Künstlers nach. Gerade seine Metamorphosen machen eine Lebensbeschreibung riskant, so weiß der Biograf, denn wo ist Canetti zwischen all den Rollen, die er durchspielt hat, zu fassen? Zu den Vorzügen dieser ganz vorzüglichen Biografie, die man jedem als Pflichtlektüre verordnen möchte, der sich in Zukunft in diesem Genre versucht, gehört die Skepsis des Verfassers gegenüber der Gattung der Lebensbeschreibung, eine Skepsis, die ihn »sein« Autor selbst gelehrt hat. Dieser hegte eine tief verankerte Abneigung gegen Biografen und Biografien, verbot überhaupt testamentarisch, eine Lebensbeschreibung von ihm in den ersten zehn Jahren nach seinem Tod zu veröffentlichen.
Diese Zehnjahresfrist ist nun gerade rechtzeitig zu seinem hundertsten Geburtstag am 25. Juli abgelaufen. »Die Bücher sollen Zeit haben, sich ohne die Kenntnis privater Umstände des Autors zu bewähren.« Wie Recht Canetti damit hat, zeigt die modische Flut von Künstlerbiografien, die oft das Kunstwerk kurzschlüssig zum bloßen Spiegel des erlebten Lebens profanieren. Den wahren Künstler aber zeichnet nach einem schönen Wort Richard Wagners das »zweite Gesicht« für das Nieerlebte aus. Der gegenwärtige Umgang mit dem Werk von Thomas Mann ist das abschreckende Beispiel für die biografistische Reduzierung des Autors aufs Allgemeinmenschliche, damit man sich nur ja mit ihm identifizieren kann. »Denn wenn ein Tausendstel von ihm anders war als das Übliche, so waren 999 Tausendstel wie bei jedem anderen«, so Canetti. »Diese sind es aber, die man sucht und findet und zur Bestätigung des Üblichen verwendet.«
Canetti hat es einem zukünftigen Biografen nicht leicht gemacht. Wie soll man eine Biografie schreiben, wenn der betrachtete Autor selbst eine dreibändige Selbstlebensbeschreibung der ersten Hälfte seines Lebens vorgelegt hat, die jetzt schon zu den klassischen Autobiografien der Weltliteratur gehört? Und dann: Ein Großteil des ungeheuren, ein Mehrfaches des veröffentlichten Werks umfassenden Nachlasses ist bis 2024 gesperrt, erst danach wird eine wirklich umfassende Biografie möglich sein. Weite Teile der Aufzeichnungen sind in einer kaum zu entziffernden Kurzschrift verfasst. Ein weiteres Hindernis sind die Vielsprachigkeit des kosmopolitischen Autors und die Verschollenheit seiner Muttersprache Ladino. Wann immer eine Biografie geschrieben wird: »Canetti wird sich nicht fassen lassen.« So Hanuschek lakonisch. Und man möchte ergänzen: Das ist auch gut so.
Canetti selbst wäre mit dieser Biografie hoch zufrieden
Was hätte Canetti selbst wohl zu dieser Biografie gesagt? Ich bin sicher: Er wäre hoch zufrieden mit ihr gewesen. Was er vor allem befürchtete: seine »Übersetzung in Germanistik« – hier ist sie nicht eingetreten. Hanuschek schreibt nicht nur ein elegantes, federndes Deutsch, das keine abgegriffenen, modischen Floskeln, Subjektivismen und Betroffenheitsattitüden kennt, er verliert sich nie in gängigen Theorievokabeln, da gibt es keinen »Diskurs«, der Canetti auf die Palme brachte, und nicht einmal einen »Text«, den er auch nicht leiden konnte. Und trotzdem spürt man in jeder Zeile dieser durch und durch professionellen Biografie, dass Hanuschek mit allen Wassern der Philologie gewaschen ist.
Streng versagt sich der Autor quellenmäßig nicht zu stützende Spekulationen, sucht »Kurzschlüsse« und »Kategorienfehler zwischen Leben und Werk« zu vermeiden. Nie wird aktualisiert oder mit besserwisserischer Gönnermiene »hinterfragt«, kaum je wird irgendetwas in dieser Vita geheimnisträgerisch interessant gemacht. Das hat schon einige auf spektakuläre Enthüllungen erpichte Leser verstimmt. Für den durch die Schiller-Biografien dieses Jubiläumsjahres Leidgeprüften ist die Lektüre von Hanuscheks Dokumentarbiografie ein Labsal.
»Von sich abzusehen« ist das erklärte Ziel des fast allzu bescheidenen Biografen. Und gegen diesen Vorsatz verstößt Hanuschek nie, ohne dass dadurch sein Buch an Lebendigkeit verlöre. Nur einmal rastet er förmlich aus, erlaubt er sich einen Stilbruch, den ihm der Lektor hätte streichen müssen, den ihm der Leser aber verzeiht. Wer die beste Zeit seines Lebens einem Autor opfert, darf sich wohl auch einmal einen Wutausbruch gönnen, wenn er sieht, dass jener jahrzehntelang einer Marotte aufsitzt, die ihn den grotesken, der Verwandlung unfähigen Gestalten in seinem eigenen Œuvre annähert. Diese Marotte ist die Tod-Feindschaft Canettis, seine absurde Unternehmung, »die Unsterblichkeit von den Göttern zurückzufordern«. Folgendermaßen schmält Hanuschek (nicht ganz zu Unrecht): »Canettis jahrzehntelange Bemerkungen ›gegen den Tod‹ gehen einem auf die Nerven. Sie sind unklar, manchmal wirken sie wie glatter Unsinn.« Freilich konzediert er, dass Canetti seine fixe Idee bisweilen selbst eisenfresserisch vorgekommen ist. »Erst Gott, dann Freud, dann Marx hast du dich verweigert, und immer schon dem Tod. Wohin rennst du so fleißig davon, Kaninchen?« Merkwürdig, dass ein so mythenkundiger Dichter wie Canetti nicht von den Mysterien des Todes angeweht worden ist.
Hanuschek kann und will Canettis Autobiografie nicht verdoppeln, geschweige denn mit ihr konkurrieren. Die vom Autor selbst erzählte Vita taucht er behutsam ins Gegenlicht seiner Recherchen und ergänzt sie, wo sie sich ausschweigt. Dazu besteht durchaus Anlass, denn Canettis Lebensgeschichte ist nur im ersten Band echte Autobiografie. »In den Folgebänden verschwindet das autobiographische Subjekt mehr und mehr zugunsten eines beinah allwissenden Wahrnehmungszentrums, über das wir so viel gar nicht erfahren.« Hanuschek sucht immer wieder kontrapunktisch die von ihm recherchierten Lebenslinien Canettis gegenüber der Subjektivität der Erinnerung des Autobiografen zur Geltung zu bringen, sich vom Bann seiner »fiktionalisierenden Erzählstrategien« zu lösen und der geradezu klassischen Komposition dieser Lebensgeschichte entgegenzusteuern.
Bemerkenswert ist, dass kaum ein Bruch entsteht, wenn Hanuschek schließlich nicht mehr auf die Autobiografie seines Autors als Widerlager zurückgreifen kann. In den Kapiteln über die Freundschaften und Bekanntschaften kann er sich ohnehin nicht auf die Stimme Canettis verlassen, da braucht er die Gegenstimmen der Anderen, und so gelingen ihm einprägsame Porträts der menschlichen Beziehungen des von unersättlicher anthropologischer Neugier getriebenen Menschenjägers und – aus seiner eigenen Sicht unfehlbaren – Menschenkenners Canetti, der ein ebenso scharfsinniges wie scharfzüngiges Urteil über andere hatte. In der Haut so manches Berühmten wie Adorno oder Reich-Ranicki möchte man angesichts der Fallbeilverdikte über ihren Charakter nicht stecken.
Die Diskretion des Buches muss Voyeure enttäuschen
Viele Seiten füllt natürlich Canettis Verfallenheit an Karl Kraus und seine rigorose Lösung von ihm, als er nach 1933 ausgerechnet bei Dollfuß politischen Unterschlupf suchte. Unfassbar: Mit Hitler hat er Kraus gar mehrfach verglichen. Und da sind die vielen, kaum zu überschauenden Frauenbeziehungen: in erster Linie natürlich seine vergötterte erste Frau Veza Taubner-Calderon, deren eigenes Schriftstellertum er in seiner Autobiografie merkwürdigerweise gänzlich verschwiegen und deren literarische Renaissance, ja Naissance er in seinen letzten Lebensjahren beglückt verfolgt hat. Nach dem Tod ihres einzigen Kindes haben Elias und Veza Canetti wohl eine Art Josephsehe geführt, die erklärt, dass Veza die Liebesbeziehungen ihres Mannes – zumal zu Friedl Benedikt und Marie-Louise von Motesiczky – großmütig tolerierte, wenn nicht förderte. Nach ihrem Tode erlebte Canetti dann noch eine überaus glückliche zweite Ehe mit Hera Buschor, die ihm deren früher Krebstod von der Seite riss. Canettis erotische Beziehungen werden von Hanuschek, wie könnte es bei diesem noblen Biografen anders sein, mit der voyeurtumsfreien Diskretion geschildert, die in der Zeit des »Outings« nicht mehr üblich ist. Das mag manchen enttäuschen.
Anders als die lebenssüchtigen Biografen, welche die Vita ihres Autors als Ersatzlektüre für dessen eigene Werke anbieten, stellt Hanuschek das Œuvre Canettis in den Mittelpunkt seiner Darstellung: zumal seine Theaterstücke, den Roman wie natürlich die Autobiografie, das von Canetti selbst als opus magnum angesehene Hauptwerk Masse und Macht (1960), das der Biograf auf seiner Indifferenzbahn jenseits von Literatur und Wissenschaft kundig verfolgt, und schließlich das »Zentralmassiv« der Aufzeichnungen, von denen nur ein Bruchteil veröffentlicht ist. Die Gattung der aphoristischen Aufzeichnungen sieht Hanuschek zu Recht als das eigentliche, das Herz-Genre Canettis an, da es seine lebenslange Opposition gegen geschlossene Systeme artikuliert. Man möchte da an Nietzsche denken, aber von der »Rohheit« seiner Aphoristik hat Canetti sich aufs schärfste abgegrenzt: Nichts als ein Chaos, das sich zum Gott formen wolle, war Nietzsche für ihn. Nein, seine Lehrmeister waren die chinesischen Philosophen, die Vorsokratiker, Lichtenberg und die französischen Moralisten.
Gerade rechtzeitig zum Jubiläum ist ein bisher unbekanntes Konvolut von Aufzeichnungen Canettis ans Licht getreten, das er 1942 in England seiner Geliebten Marie-Louise von Motesiczky geschenkt hatte. Der Londoner Germanist Jeremy Adler, mit Canetti schon über seinen Vater H. G. Adler bekannt und befreundet, hat sie vorbildlich mit einer vollständigen Reproduktion des handschriftlichen Originals ediert und mit einem Essay versehen, der behutsam das biografische Ambiente dieser Aufzeichnungen ausleuchtet und sie profund in den Traditionszusammenhang europäischer und nicht nur europäischer Aphoristik stellt. Das Aufzeichnungswerk Canettis steht neben Masse und Macht auch im Zentrum einer neuen theoretisch anspruchsvollen Monografie von Penka Angelova, welche die Spuren zum mythischen Denken in Canettis Œuvre, die Grundbegriffe seines Antisystems systematisch untersucht.
Doch noch einmal zurück zu dem Mittelstück in diesem Triptychon neuer Canetti-Bücher, zu Hanuscheks Biografie. Sie schließt naturgemäß mit der letzten Lebenszeit des Autors, der zunehmend den Schatten des sein Leben lang befehdeten Todes auf sich zukriechen sah. Und doch: Ihnen setzte er bis zur letzten Minute seine ungebrochene geistige Kraft entgegen, den Freunden immer neue Werke ankündigend. Der Tod freilich hat sich nicht für die Feindschaft des Dichters gerächt, sondern ihn in der Nacht vom 13. auf den 14. August 1994 unverhofft und überaus sanft aus dem Leben genommen. Hanuschek schließt sein Buch mit einem Epilog, in dem er das letzte Wort seinem Dichter gönnt, einer vermächtnishaften Liebeserklärung an seine zweite Frau und ihre gemeinsame Tochter Johanna. Ein Wort der Segnung, das aus dem Munde dieses Dichters, der Menschen so oft recht gnadenlos im Zerrspiegel seiner anthropologischen Beobachtungsmanie eingefangen hat, besonders bewegt. Hera und Johanna mögen ihm, so sehnt er sich, über die Lebensgrenze hinaus »aufspielen«, und er wolle sie segnen »für alle Töne und alle Worte«.

HARVILL £17.99 (266pp) £16.99
Elias Canetti was a genius and a monster. His greatest works - his novel Auto da Fé, his three volumes of autobiography - can still compel our astonished admiration. But nothing less than his genius will do, and alas his genius is absent from Party in the Blitz, except in brief flashes. The book was unfinished at Canetti's death, and it was a disservice to him to publish it, especially with errors (there are 39, not 37, articles of the Anglican faith, for example) and repetitions uncorrected.
Nevertheless, here it is, and let's put it to some use. Canetti's raging egotism, his envy, his taste for betrayal, are all in the Nobel Prize-winning writer's memoir of "the English years". He judges everyone by how they respond to him; he sticks the knife into old friends, especially women (Iris Murdoch, C V Wedgwood, Kathleen Raine), and anyone more famous than himself (T S Eliot). But Canetti's nastiness is well known. I shall play devil's advocate, and speak for his other side.
Canetti was a larger-than-life hater, but he was also a larger-than-life lover, and there are loving portraits here too: of his fellow émigré Franz Steiner, for example, with his hopeless dream of founding a family; of Aymer Maxwell, probably Canetti's closest friend; of Friedl Benedikt, his lover from Viennese days, whom he also admired and encouraged as a writer.
Indeed, though Canetti reserved his worst cruelties for women, the women in his life were all artists in their own right, whose work, at least, he did not destroy: his wife Veza, his mistresses Friedl Benedikt and Marie-Louise von Motesiczky, and Iris Murdoch herself. If Canetti had only hated the human race, his books would not hold us; and if he had only hated women, he would not have held them either. He also loved them, equally extremely, equally mythically, as he had mythically loved and hated his mother. It was this combination of extreme, mythical love and hate that made him seem more like a god to them than a man.
This mythical love-hate is the true subject of Party in the Blitz: not love-hate for Iris Murdoch, or for anyone, but for England. In this, Canetti speaks for every Jewish refugee from Hitler to mid-20th century Britain - and probably for every other refugee to Britain as well; exaggeratedly, as he says, but not less truthfully, since in its purity and concentration literature always exaggerates.
It can only be love-hate, because for Canetti and his kind the best things in England are also intolerable. He is hot in everything, especially his opinions, while the English are cool and moderate. He admires their moderation immoderately, and knows it is the reason why Britain alone in Europe is non-Fascist and free. But nothing could be more alien to him. He craves attention and praise, while in England praise is embarrassing, and attention-seeking the ultimate sin. His leitmotif is arrogance, but the English are more arrogant than him. He can enslave some of their women; but Englishmen, and Englishness, mock and defeat him as nothing else will ever do but death itself.
What this is, of course, is unrequited love. Canetti loves the English Parliament, upper-class Englishwomen, the whole population of Britain during the war; above all, he loves English words and English literature. Best of all for this book, he loves cultured English eccentrics. The literary scholar Arthur Waley dismisses Dickens and Tolstoy out of hand, the inventor Geoffrey Pyke proposes artificial icebergs for the Normandy landings, Canetti's landlords are practically barking - all are unquestioned members of the Establishment, which could only happen in England.
These are the great portraits of this book, together with Enoch Powell, the rabid Englishman - revealed here as utterly un-English, erudite, immoderate, polyglot, without an ounce of irony. In these English portraits, Canetti briefly lives up to his model, John Aubrey. Read Party in the Blitz for them; forget Iris Murdoch.
Carole Angier's biography 'Primo Levi: the double bond' is published by Penguin
An angry old
man
Noble Laureate Elias Canetti's memoirs, Party in the
Blitz, are irrepresibly bitchy, says Tim Adams, especially when it comes to TS
Eliot
Sunday August
7, 2005
The Observer
Party in the Blitz
by Elias
Canetti
Harvill £17.99, pp208
When he began these memoirs of his life in London the Nobel Laureate Elias Canetti was 85. He worked on them, on and off, up to his death four years later in 1994.
Never shy to face up to the truths of life, schooled as he was in the major political upheavals of the century, he nevertheless discovered extra license in his advanced age. The book seems to have been intended as a parting shot at the society he entered in England; a nicely calculated piece of sniping at the liberals who welcomed him, stiffly, when he escaped from Vienna after his writings had been banned by the Nazis in 1939.
The title suggests a kind of wartime bonhomie that the writer seldom experienced. The home front parties Canetti describes, mostly Hampstead literary events, are 'senseless and heartless, every bit in keeping with such cold people'.
They are thrown by the poet and critic William Empson, or at the smart home of Canetti's English editor Veronica Wedgwood. The author moves among these soirees with consummate Austrian glumness knowing no one and, worse, no one knowing him, despite the fact that his great book Auto da Fé was already behind him. From time to time he was asked in a disinterested way, by a Toynbee or a Percy, if he had known Kafka, since he came from over that way, but mostly he was awkwardly ignored.
Fifty years on, these slights recalled, Canetti obviously rather fancied the idea of getting his own back. The result is a series of memorable, pointed vignettes of the intellectual figures of wartime and after. Canetti is never less than dry, and frequently venomous, a tone captured perfectly in Michael Hofmann's translation. The author reserves special scorn for the social 'dictatorship' of TS Eliot, often the star guest at these evenings, and occasionally called on to recite poems that are invariably, to Canetti's ears, 'spittoons of failure'; (he defiantly loves Dylan Thomas for having the presence to undermine Eliot's stifling authority).
If the men, Eliot and Empson in particular, suffer in these pages for their arrogance, and for their desiccated misogyny, the women fare little better. Canetti remained wonderfully angry to the end, for example, at the number of evenings he had wasted listening to the Blakean ins and outs of the poet Kathleen Raine's love life.
He is often even less charitable toward his own numerous lovers. The most celebrated of these, Iris Murdoch, is treated with an astonishing disgust in his memory, an embarrassingly supine conquest who in the bedroom took off layer upon layer of things 'that didn't have anything remotely to do with love, it was all woollen and ungainly' before lying 'unmoving and unchanged... [so that] I barely felt myself enter her ... perhaps I might have felt something had she resisted in some form. But that was as much out of the question as any pleasure ...' Things got worse when the novelist departed the boudoir, her flat feet in 'grotesque sandals', walking like a 'repulsive bear'.
In among this London society, Canetti reckoned he had one single reader who had the German and the wit to have read his Auto Da Fé. That that person is the great sinologist Arthur Waley is no particular comfort to him. Canetti recounts a conversation between his wife, the somewhat long-suffering Veza and Waley, which founders on questions of taste. Thomas Mann couldn't write, Waley asserts, Dickens was 'no good at all' and so on, until the enthusiasms of Mrs Canetti are snobbishly crushed one by one.
'When I think of England I always think of people with whom I had detailedly insipid conversations,' Canetti suggests, but his recollections of these conversations are anything but insipid. If his book was mostly inspired by bitterness, it is salvaged by his great sense of history and humanity, and the exactness of his prose.
Despite the bitchiness, and because of it, Canetti proves himself a pre-emiment authority of that perennially curious social gathering, the London literary evening, his thesis a nice little coda to his life's work on Crowds and Power. And you are left in no doubt that he was, as he well knew, always the life and soul of the party.
more Elias Canetti, here