
6-6-2017
TRANSITGESCHICHTEN, de Lilli Brand
|
NOTA DE LEITURA
Comprei este livro já há alguns três ou quatro anos, mas na altura não tinha conhecimentos de Alemão para o ler. Peguei nele há dias e tive a satisfação de o ler com poucas consultas de dicionário em dois dias. O “trânsito” do título é a emigração (neste caso de jovens mulheres) de um país para outro para melhoria de vida. Lilli Brand nasceu em 22 de Julho de 1974 em Kasatina, na Ucrânia, com o nome de Ludmila Nikolajewna Ischtschuk. A sua mãe era engenheira dos caminhos de ferro e o seu pai, condutor de locomotiva. Os seus pais separaram-se pouco depois do nascimento dela. Saiu de casa, após os estudos liceais. Em 1991, obteve um diploma de parteira na Faculdade de Medicina de Winniza. No semestre de 1993/1994, passou para Kiew, com a intenção de aí estudar Medicina. Tinha grandes dificuldades de dinheiro, pois os seus pais não tinham possibilidades de a sustentar nos seus estudos. Nessa altura, frequentou os pretos que estudavam em Winniza e recebiam altas mesadas de seus pais ou de seus Governos. Como muitas outras raparigas, decidiu partir para a Alemanha. As raparigas que vinham do Leste tinham duas soluções para sobreviver e obter documentos legais para permanecer na Alemanha: ou iam cuidar de crianças como au pair (ou baby sitter) ou entravam na prostituição. Neste último caso, o meio mais seguro de obter a autorização de residência era fazer um casamento de conveniência com um alemão (Schneemann) a quem pagavam uns milhares de marcos para isso. Foi assim que ela encontrou um Senhor Brand, com quem casou e de quem teve o nome dali em diante. Não vou aqui referir a vida dela como prostituta. Em 1999, conheceu ela uma pessoa que, desde então, tem sido muito importante na vida dela, o jornalista Helmut Höge (n. 18-10-1947, agora reformado) que escrevia no Tageszeitung. É ele que escreve o postfácio deste livro. Sobretudo, foi ele que corrigiu e possivelmente ajudou a redigir os artigos que ela publicou no Tageszeitung até 2004, cuja lista coloco a seguir. Esses artigos foram depois reproduzidos no livro quase ipsis verbis. De facto, seria impossível para ela escrever tão bem o livro sem a ajuda dele, tanto mais que o jornalista diz que ela falava um Alemão quase perfeito. Este facto levanta a questão de saber por que é que o livro não aparece como escrito em co-autoria: foi generosidade do jornalista ou este não quis misturar o seu nome com a vida dos bordéis? O livro fala de um Mundo Cão da exploração sexual das raparigas do Leste que mais cedo ou mais tarde passam pelo inferno da droga, tal como sucedeu à autora. Transcrevo a seguir dois artigos do Tageszeitung que são posteriores à publicação do livro. O último é de 27-11-2016, e assinado pelo jornalista, mas na sua maior parte transcrevendo entre aspas texto de Lilli Brand. Quer isto dizer que ela vive ainda em Berlim, terá deixado a prostituição e encontrado modo de se sustentar, afinal ela ainda só tem 42 anos.
Textos publicados no Tageszeitung:
(a) Esta crónica está transcrita no livro nas págs. 128-130 NB. O Suddeutsche Zeitung de 27-4-2004 (fim de semana), publicou a crónica "Ein Mann, eine Braut, zwei Koffer und jede Menge Heroin", que não se encontra na Internet, mas estará reproduzida total ou parcialmente no capítulo do livro "Zwei naive Frauen". |

13-3-2007
Benzodiazepine (Benzos): Wegen des versuchten Verkaufs von drei Tabletten bekam ich einmal 400 Euro Strafe wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Eine Pille kostet am Kottbusser Tor 1 bis 2 Euro. Manche Apotheken fordern ein BTM-Rezept, eine 20er-Packung kostet bei ihnen 10–12 Euro. Diese „Beruhiger“ (Tranquilizer) wirken nicht beruhigend, im Gegenteil: Man macht damit verrückte Sachen, die man sich sonst nicht traut. Sie heißen deswegen auch „Klau-Pillen“.
Antidepressiva (Doxies – kurz für Doxepin):
Auf dem Schwarzmarkt zahlt man für 100 Milligramm 1–2 Euro. Sie machen blöd, indem sie den Geist ausschalten – je nach Mittel mehr oder weniger komplett. Dafür wird man immer träger und dicker und kann 24 Stunden durchschlafen. In Gefängnissen wird den Drogenabhängigen gerne „Aponal“ verabreicht, um sie zu beruhigen. Ich habe zu Hause einmal mal 6 Pillen à 25 mg genommen und dann stundenlang abgewaschen – immer ein und denselben Teller, bis das Spülbecken überlief und der unten drunter lebende Nachbar hochkam, um sich über die feuchte Decke zu beschweren, woraufhin ich mein Hemd auszog und es ihm ins Gesicht warf. Das weiß ich aber alles nur von meinem Mitbewohner. Wenn man süchtig nach Doxies ist, wird man mit der Zeit paranoid.
Ersatzopiate (Meta oder Pola – kurz für Methadon bzw. Polamedon):
Für den legalen Erwerb muss man an einem Substitutionsprogramm teilnehmen – das kostet je nach Dosierung 10–20 Euro im Monat. Weil vielen Opiatabhängigen das zu umständlich ist, kaufen sie ihre Metas oder Polas am Zoo oder am Leopoldplatz. Dort kostet ein Milliliter meist einen Euro, das macht in der Regel täglich 10 Euro für auch noch gepanschtes Zeug. Im Programm bekommt man die Mittel unter Aufsicht zum Trinken. Nicht selten verkaufen die Meta- bzw. Pola-Dealer das Zeug, das sie im Substitutionsprogramm bekommen, um sich von dem Geld Heroin zu kaufen.
Kokain (Koks/Koka):
Muss leicht gestreckt verkauft werden. 1 Gramm kostet 80–100 Euro. Als Streckmittel wird meistens eine kleine Prise Strychnin (Rattengift) verwendet, aber nach mehreren Todesfällen 2006 wird es nun immer öfter durch Lidocain ersetzt, ein Lokalanästhetikum aus Zahnarztpraxen. Wenn man das damit gestreckte Kokain fixt, verursacht es starke Krampfanfälle, weshalb es in der Scene auch Schüttelzeug heißt. Eine Bekannte vor mir biss sich dabei einmal ein Stück ihrer Zunge ab. Kleine gemeine Dealer (Ratten) strecken das Kokain auch mit Milch- bzw. Puderzucker oder sogar mit Mehl, was beim Spritzen Thrombosen verursachen kann. Große Kokainschnupfer meinen nach einiger Zeit, alle ihre Ideen sind brillant und jedes Geschäft verläuft reibungslos. Wenn es mit ihnen abwärts geht, greifen sich auch auf billigere Aufputschmittel zurück.
Amphetamine (Speed/Ecstasy/Smarties)
Diese Tanz- und Partydroge wird oft in Diskotheken, im Sommer auch an Badeseen verkauft. Japanische Touristen sind ganz wild danach. Eine Pille kostet 5–20 Euro. Viele Dealer, die Geschäfte mit harten Drogen machen, nehmen Speed, das macht es ihnen leichter. Ähnliches gilt für die Frauen in der Porno- und Bordell-Szene. Außerdem nehmen übergewichtige Frauen gerne Amphetamine, weil sie ihnen den Appetit nehmen und sie auf Trab halten.
Halluzinogene (LSD, Pilze, Mescalin etc.):
LSD kam früher nach Westberlin aus der Humboldt-Universität – und war ziemlich gut. Heute ist der Stoff oft mit billigen Amphetaminen versetzt. Es wird groß in den Osten geschmuggelt, wo es einen Nachholbedarf an „LSD-Erfahrungen“ gibt. Hier kostet ein „Trip“ etwa 20 Euro, in Kiew 50 Dollar. Der LSD-Markt ist überwiegend in deutschen Händen, für pflanzliche Halluzinogene (Pilze/Mescalin etc.) gibt es praktisch keinen Markt: Man bekommt das Zeug nur durch Zufall und Beziehungen. Der normale Junkie oder Polytoxikomane (Allesfresser) verschmäht sie zwar nicht und experimentiert auch gerne mit ihnen (in Form von Drogencocktails), aber bisher sind die Halluzinogene vorwiegend nur für Liebhaber. Ähnliches gilt für Morphium. Weil immer mehr Kranken im Endstadium (HIV, Krebs usw.) Morphium verschrieben wird, kommt seit 2005 auch immer mehr von diesem Zeug in den Handel. Eine Morphium-Tablette kostet 3–5 Euro. Es gibt bereits regelrechte Fankreise dafür.
Tiledin (Valoron z. B.)
Ein Schmerzmittel, das gerne von Jugendlichen genommen wird: Sie nehmen es u. a. vor Prügeleien, weil das Mittel aggressiv macht und man Verletzungen nicht so schnell spürt. Zunächst hatte es auch noch eine stark euphorisierende Wirkung, diese wurde jedoch vom Hersteller mit dem Wirkstoff Naloxon gedämpft. Auf dem Schwarzmarkt kostet ein Fläschchen rund 45 Euro, er beschränkt sich jedoch auf Gegenden, wo es viele Jugendgangs gibt. Ältere Menschen kriegen es z. B. bei Rückenschmerzen verschrieben, einige verkaufen es dann weiter.

27-11-2016
Verkaufshit Stilles Wasser aus der Türkei: Wie eine ukrainische Chefverkäuferin einen Lebensmittelladen im Wedding zum Brummen brachte.
Helmut Höge
Mahmoud Al-Zein, der „Pate von Berlin“, ein libanesisch-kurdisch-türkischer „Drogenbaron“, wurde kürzlich wieder von einer Polizeirazzia überfallen. Zuvor hatte man ihn bereits zu vier Jahren Haft im offenen Vollzug verurteilt. Und davor hatte er wahllos Bäckereien, Cafés, Lebensmittelläden usw. erworben, die er auf andere Namen überschrieb.
Die Läden wuschen zwar sein Schwarzgeld und schufen Arbeitsplätze für Mitglieder seines „Clans“, aber nie klappte es mit dem Warennachschub, dem Bezahlen von Stromrechnungen, Sozialabgaben und Steuern. Schlösser wurden über Nacht ausgetauscht, Tageskassen verschwanden.
Für seinen Lebensmittelladen in der Soldiner Straße stellte Mahmoud schließlich die Ukrainerin Lilli Brand als Verkaufsstellenleiterin ein. Sie erzählt: „Am Anfang kamen nur wenige Kunden, es war ihnen alles zu teuer. Das brachte mich auf die Idee, ein Plakat ins Schaufenster zu hängen: ‚Zur Neueröffnung 50 % Rabatt auf Reis‘. Das interessierte die Leute. Einige kauften gleich mehrere 5-Kilo-Säcke: Ich nahm an dem Tag über 800 Euro ein.
Ich dachte mir daraufhin etwas Neues aus: ‚Beim Kauf von vier Packungen Halwa – zu 1.50 Euro – eine Packung umsonst‘. Auch das funktionierte. Gewürze, Oliven und Tees, die mir zu teuer schienen, setzte ich ebenfalls herab. Schon bald wollten die Kunden alles zu einem niedrigeren Preis haben. Ich erklärte ihnen, dass es immer nur einige wenige Waren billiger gebe. So mussten sie täglich nach Sonderangeboten vorbeischauen.
Nach zwei Wochen fing ich an, einigen Kunden Kredit zu geben, etwa einer Jugoslawin, die täglich vorbeikam. Sie war bald meine Botschafterin: Sie erzählte allen in der Soldiner, was es ‚bei der Russin‘ wieder Neues gebe. Manchmal schleppte sie sogar eine ganzen Trupp Frauen an, die alle bei mir einkauften.
Wenn viele Kunden auf einmal im Laden waren, verlor ich manchmal den Überblick beim Abrechnen, zumal viele Frauen ihre Kinder mitbrachten, die mich mit ihren Süßigkeitswünschen durcheinanderbrachten, während die mit großen, weiten Gewändern angetanen Mütter irgendetwas einsteckten.
Zwar waren die Telefonnummern der Lieferanten verschwunden, aber die kamen bald von selbst und brachten Fladenbrote, Joghurt, Milch, Butter, türkische Wurst. Nur der Gemüsemann wollte mir nichts liefern, weil Mahmoud ihm noch Geld schuldete und mir gesagt hatte, ich solle keine Außenstände begleichen. Ich kaufte deshalb selber Gemüse beim Händler um die Ecke, das ich dann etwas teurer verkaufte. Ich muss hinzufügen, dass auch ich mich großzügig aus der Kasse bediente. Niemand kontrollierte mich oder die ‚Bücher‘. Ich nahm etwa 300 Euro am Tag ein.
Was ich am meisten verkaufte, war stilles Wasser in Flaschen aus der Türkei. Selbst den ärmsten Soldinern war das deutsche Wasser aus der Leitung nicht rein genug, deswegen kauften sie täglich mindestens einen Sechserpack.
Mahmoud kam nur selten vorbei, und wenn, dann verschwand er gleich in seinem Büro, wo er manchmal auch schlief. Einmal kam er mit seiner Frau und seinen drei Kindern – und veranstaltete ein kleines Kinderfest vor dem Laden.
Ich begleitete meine jugoslawische Dauerkundin Mara, die mir inzwischen ans Herz gewachsen war und sogar Diebstähle im Laden verhinderte, an einem Freitag in die Moschee, die sich gleich nebenan befand. Weil ich dafür keine passende Bekleidung besaß, lieh sie mir ein grün-goldenes Kopftuch und dazu ein langes dunkelgrünes Kleid mit arabischem Stickmuster. Mir war anfangs etwas bange. Mara beruhigte mich: ‚Tu einfach alles, was auch die anderen Frauen machen, ich bin bei dir.‘
Der Gottesdienst dauerte fast zwei Stunden, aber ich war – im Gegensatz zu den alten Frauen um mich herum – schon nach einer halben Stunde so fertig vom vielen Niederknien, dass ich nicht mehr hochkam. Und am nächsten Tag hatte ich einen solchen Muskelkater, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte und der Laden geschlossen blieb.“

16-10-2004
Echte Beutekunst
VON DETLEF KUHLBRODT
Lilli Brand: „Transitgeschichten“. Erzählungen. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2004, 157 Seiten.
Das Buch „Transitgeschichten“ von Lilli Brand ist ein schönes, interessantes und in vielem auch sehr komisches Buch; eine Art literarisch-journalistische Autobiografie, die aus dem ereignisreichen Leben der Autorin erzählt, die 1974 unter dem Namen Ludmilla Nikolajewna Ischtschuk in einer ukrainischen Kleinstadt geboren wurde, wegen hoher Schulden zunächst in Warschau als Nackttänzerin arbeitete und dann mit Hilfe einer so genannten Schlepperbande nach Deutschland fuhr.
Hier arbeitete sie bis 2001 hauptsächlich als Prostituierte in verschiedenen Etablissements verschiedener Städte zwischen Freiburg und Berlin, machte eine Sexarbeiterinnenausbildung in Kaiserslautern, ehelichte einen gewissen Herrn Brand, verfiel zeitweise den Drogen, lebte mit verschiedenen Männern und Hunden zusammen, verliebte sich häufig mit allen Konsequenzen in Gangster unterschiedlicher Nationalität, gescheiterte Philosophen und andere so genannte gesellschaftliche Außenseiter, verbrachte ein paar Monate in Gefängnissen wegen Bagatelldelikten. Lilli Brand scheiterte in vielen Unternehmungen. Vor vier Jahren begann sie dann Texte vor allem in der taz zu veröffentlichen. Dabei wurde sie von Helmut Höge unterstützt, der als „Ghosteditor“ für zahlreiche migrantische AutorInnen, unter anderem auch Wladimir Kaminer, tätig ist. Die Zusammenarbeit mit Höge bestand darin, dass die Autorin erzählte und Höge aufschrieb und redigierte.
Die „Transitgeschichten“ sind interessant in vielerlei Hinsicht. Das Autobiografische zum Beispiel. Normalerweise ist es ja nicht so, dass Menschen, die solche Dinge erlebt haben, ein Buch schreiben. Über sie wird ja eher geschrieben. Und in den Texten, die über sie in bester Absicht geschrieben werden, sind Prostituierte mit Migrantenhintergrund fast immer Opfer; naive junge Frauen, die, vom Schein des Westens geblendet, sich in die Hände skrupelloser Schleuser begeben, mit Drogen willenlos gemacht, in den Kellern übler Bordelle gefangen gehalten und von Puff zu Puff verkauft werden, wo sie dann Freiern, die nicht Freunde sein dürfen, sondern irgendwie als minderwertig gelten, zu Willen sein müssen.
Von solchen Migrantenschicksalen erzählt Lilli Brand auch. In einem Kapitel ihres Buches werden gefangene Prostituierte aus Weißrussland aber nicht von der Polizei, sondern von russischen Gangstern befreit. Aber es geht Lilli Brand nicht darum, etwaigen Klischees über die Migrantenprostitution andere entgegenzusetzen, sondern darum, ihre eigene Geschichte zu erzählen.
Die literarisch gebildete, vielsprachige, eher geistes- als naturwissenschaftlich orientierte Heldin, eine sehr gute Schülerin und hervorragende Tischtennisspielerin, kennt den Preis, den es kostet, aus der Ukraine in den Westen zu kommen. Und sie ist bereit, ihn auch zu entrichten. Das hat für uns hier etwas Anstößiges. Zumal Lilli Brand sich ja nicht nur die Freiheit genommen hat, als Prostituierte zu arbeiten, um hier bestehen zu können, sondern darüber auch noch sehr humorvoll schreibt. Dabei spricht sie nie schlecht über die Menschen, denen sie begegnete. Dass es in diesem Schreiben auch darum geht, sich von dem Beschriebenen zu lösen, kennzeichnet viele autobiografische Geschichten.
Die existenzielle und auch aufklärerische Dimension der schreibenden Arbeit am Selbst besteht ja in dem Versuch des beschädigten Ichs, sich selbst zu reparieren, dem Chaotischen Form und sich selbst vielleicht Halt zu geben in der Welt. Faszinierend ist die Fülle der Details in Lilli Brands Texten. Während viele klassisch literarische Werke ja oft so gehen, dass die Autoren wenig erlebt haben und viel darüber schreiben, ist es hier eher umgekehrt.
Es gibt ein ständig übersprudelndes Mehr an Geschehen, Geschichten, Verwicklungen, Personen, Orten und es ist ganz erstaunlich, wie knapp, lapidar und mit kurzen Sätzen die Autorin so viele Ereignisse schildert und miteinander verknüpft. Von der Jugendclique, mit der sie in der Ukraine immer herumhing, bis ins Bordell. Vom Heroin, das 1989 ein Junge mit reichen Eltern in der ukrainischen Kleinstadt einführte, zu den Opiaten, die sie selber später nahm als Prostituierte. Von der einäugigen Mutter, einer überzeugten Kommunistin, zu ihrem dritten, einäugigen Hund Max, der am liebsten Kiwis und Klementinen isst. Von diesem zu jenem Geliebten.
Seltsam bei all dieser Detailfülle, dass lebensgeschichtlich entscheidende Dinge ganz knapp nur und immer eher von außen beschrieben werden, als gäbe es da eine Sperre, sich selber genauer zu erforschen. Über einen Selbstmordversuch verliert Lilli Brand zum Beispiel gerade mal zwei Sätze.
Die Kapitel dieses Buches enthalten genug Beobachtungen für mehrere Romane. In einem dieser Romane würde es um die Entstehung und das Auseinanderbrechen einer Jugendclique in einer ukrainischen Kleinstadt gehen; in einem anderen um Drogen- und Medikamentensucht; im nächsten um Prostitution in Deutschland. Dann gibt es wieder sehr lustige Erzählungen, die von den vergeblichen Versuchen handeln, mithilfe von zwielichtigen Wahrsagern oder Preisausschreiben sein Glück zu machen.
„Man bekommt immer nur ganz kleine und oftmals nutzlose Dinge“, erkennt die Autorin am Ende ihrer Gewinnspielsucht. Lilli Brand möchte als Autorin nicht mehr aufs Rotlichtmilieu festgelegt werden. Die einzige Schwäche des Buchs besteht darin, dass es viel zu kurz ist.
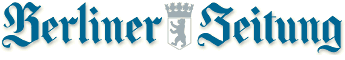
.
11-4-2002
Die Ukrainerin Lilli Brand schreibt über ihr Leben zu Hause und in Deutschland: Das Bordell im Blick
Lilly Brand: Transitgeschichten. dva, Frankfurt 2004. 150 S.
Das ist ein atemloses Buch. Die ukrainische Autorin Lilli Brand hat in nur 30 Jahren so viel erlebt wie andere nicht in drei vollständigen Leben. Schon ihre Berufe muss man notieren, um sich zu merken: Krankenschwester, Hebamme, Medizinstudentin, Kioskbetreiberin, Nackt-Tänzerin, Dolmetscherin, Prostituierte, Journalistin und Schriftstellerin. Außerdem sammelte sie Erfahrungen als Häftling und Junkie. Dabei kam sie von Kasatin bis Berlin und Pirmasens. Die Männer, die für Lilli Brand wichtig waren, können nicht vollständig aufgeführt werden. Leser mit einer netten kleinen Familie und nur einem einzigen Beruf können sich schnell bieder vorkommen bei der Lektüre, wenngleich die fremden Erlebnisse selten zum Ausprobieren anregen. Insbesondere die genau beschriebenen Bordell-Erlebnisse machen wenig Lust zum Nachturnen.Lillis Leben fängt ganz sowjetisch an - mit einer friedlichen Kindheit in einem Plattenbau, mit Ferien bei den Großeltern und in Pionierlagern. Aber schon als Schwesternschülerin zieht es Lioudmilla Nikolajewna Ischtschuk zu Fremden, zu afrikanischen Studenten. Bei ihnen übersteht sie einen Selbstmordversuch aus Liebeskummer und einen Schwangerschaftsabbruch aus Vernunft. Beide Vorgänge finden Erwähnung nur auf wenigen Zeilen, als hätten sie keine weitere Bedeutung für ihr Leben. Auch erste Engagements als Table-Tänzerin in Warschau, wohin es sie nach einer Anhäufung von Schulden treibt, später als Prostituierte in Berlin, schildert Lilli Brand seltsam kühl, fast unbeteiligt. Obwohl es sich um eine Autobiografie handelt, blickt sie wie von außen auf ihr Leben. Als fürchte sie, undankbar zu wirken, hält sie sich an Fakten, vermeidet in ihren kurzen Sätzen die Beschreibung von Gefühlen. Manchmal steht man den lakonischen Schilderungen ratlos gegenüber und fragt sich, wie sie ihr Leben eigentlich aushält. Wenn sie aus dem Knast kommt (Bagatellegründe), wenn ihre Wohnung geräumt wird, wenn ihre Scheinehe (mit Herrn Brand) scheitert, finden sich aber auch solche Sätze: Ich lag nur noch im Bett, nahm Methadon und Psychopharmaka. Lilli Brand hält das Leben also doch nicht immer aus, sie ist nur sehr hart gegen sich. Wenn sie Qualen leidet, etwa beim Auspeitschen durch einen Freier, schreibt sie: Es tat so weh, dass ich das Ganze abbrach. Für den kalten Entzug im Gefängnis wählt sie einen Drei-Wort-Satz: Ich litt sehr. Ihr Innerstes behält die Autorin für sich. Einmal verliebt sie sich in einen Freier und trifft ihn privat. Der Mann will, dass sie ihren Job als Prostituierte aufgibt, "das konnte ich jedoch nicht." Mehr erfährt man dazu nicht, auch nicht, wie ihr Leben heute aussieht.Im Nachwort zitiert Helmut Höge, der Lilli Brands Texte lektorierte, seinen Zögling mit folgenden Worten: "Womit habe ich dieses Glück bloß verdient?" Sie sagt das mit Blick auf ihre alten Freunde in der Ukraine. Auch dafür eignet sich das Buch - eigenen Sorgen eine andere Perspektive zu geben.
|
|
|
|
|
22-4-2002
"Transitgeschichten" von Lilli Brand
Auf Lilli Brand trifft die Plattitüde zu, sie erzähle Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Denn die Geschichten der Ukrainerin, die vor 30 Jahren als Ludmila Nikolajewna Ischtschuk in der Kleinstadt Kasatin geboren wurde und vor zehn Jahren als Bardame, Tänzerin und Prostituierte nach Deutschland kam, diese Geschichten eines sehr bewegten Leben, wären nichts ohne dessen turbulenten Stoff. Es sind Milieugeschichten. Und es sind am eigenen Leib erfahrene Geschichten.
Bei den Waren, die in ihnen gehandelt werden, handelt es sich um Sex, um Drogen
und immer wieder um Papiere, Visapapiere, Aufenthaltspapiere, Arbeitspapiere,
Heiratspapiere, Krankenversicherungspapiere etc. Und auch die Scheinheirat ist
in diesem Milieu eine begehrte Ware. Die Autorin selbst heiratete einen gewissen
Herrn Brand und kam so zu ihrem deutschen Nachnamen. Bei den Orten, an denen die
Geschichten spielen, handelt es sich um die klassischen Topoi der Halbwelt,
Bordell, Bar, Straße, Hinterzimmer, aber mindestens genauso relevant um die
Schreibstuben und Schreibtische deutscher Behördendemokratie einschließlich
Polizei und Gefängnis.
Lilli Brands persönlicher Kampf gegen die
Windmühlen des Staates nimmt ein bedeutsames Stoffvolumen ihrer Erzählungen ein.
Sie brachte aus der Ukraine nicht nur Attraktivität, Geldnot und gehörige
Abenteuerlust mit, sondern Denkvermögen, einen hohen Schulabschluss und Bildung.
Man kann darin die Vorraussetzung für eine Art anarchische Autarkie sehen, die
Lilli Brand kultivierte und die sie wohl davor bewahrte, im Netz rabiater
Menschenhändler, brutaler Bordellbesitzer und hemmungsloser Zuhälter unterging.
Diese anarchische Autarkie ist ein Kennzeichen
des Schelmenhaften und des Schelmenhaften und eben dessen Gattung versteckt sich
hinter dem einfachen, sachlichen Stil von Lilli Brands Geschichten, die sie, wie
man dem Nachwort entnehmen kann, mit Hilfe des Berliner Autors und
taz-Mitarbeiters Helmut Höge in Form und zu Papier brachte. Denn auch die
Kreuzberger taz-Redaktion gehört zu den Stationen, die Lilli Brand im Lauf ihrer
Deutschlandjahre passierte, ohne an irgendeiner Station, in einer Ehe, einer
eheähnlichen Gemeinschaft je hängen zu bleiben. Sie kennt die Nervenklinik von
innen und das Gefängnis, sie hat sexuelle Orgien mitgemacht und in schmierigen
Puffs gearbeitet, sie hat die Wohnung mit einem netten alten Türken und ihr Herz
mit einem Afrikaner geteilt. Sie war mondän und verschwenderisch ebenso wie
bettelarm und hoch verschuldet. Aber was immer sie erlebte, sie kann sich davon
wieder befreien.
Dies, dieses schelmenhafte Talent zum
improvisatorischen Leben, zur vagantischen Existenz ist das eigentliche Thema
der Geschichten. Deren Heldin und Erzählerin, also Lilli Brand selbst, ist wie
der Schelm, der sich durch die Zeitgeschichte schmuggelt, von ihr mit nimmt, was
er gebrauchen kann und sich ungreifbar macht, weder Verliererin, noch Siegerin,
weder Opfer noch Täterin. Sie ist beides.
"Als das Zusammenleben mit Oran immer
komplizierter wurde und ich immer mehr Opiate und Antidepressiva nahm, machte
ich mich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Es sah aber schlecht aus mit
eine eigenen Wohnung. Beim Sozialamt sagte man mir, ich müsse mir selbst eine
Einzimmerwohnung suchen, sie würden dann für die Miete aufkommen. Aber kein
Vermieter wollte einen Sozialhilfeempfänger. Auf elf abgeschickte
Bewerbungsbriefe erhielt ich nur Ablehnungen, und bei den Vorstellungsgesprächen
wurden meine Wohnungswünsche nicht ernst genommen. Ich rutschte tiefer und
tiefer in das Verzweiflungsloch. Bei einem Picknick am Schäfersee machte Oran
mir dann auch noch eine derartige Eifersuchtsszene, dass ich Hals über Kopf
abhaute - ohne zu wissen warum."
Lilli Brands "Transitgeschichten" folgen fraglos
einem aktuellen Trend des Buchmarktes: dem Trend zur authentischen, lebensechten
Geschichte, die genau genommen einen Zwitter zwischen Sachdokumentation und
literarischer Erzählung darstellt. Nur hat Lilli Brand einfach zu viel erlebt
und vor allem zu viel ironischen Abstand zum Selbsterlebten, um nicht als ein
besonders originelles Exemplar des Trends gelten zu können.
TAZ – blog
31-8-2006
Helmut Höge
http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2006/08/31/duz-konzerne/
................................................................................................................................................
Etwas anders verlief bis jetzt die Berliner Karriere der ukrainischen Journalistin Lilli Brand. Ich lernte sie über Helena und Ira kennen, zwei Prostituierte, die im Friedrichshainer „Lord Gabriel“ anschaffen gingen und sich immer mal wieder bei mir meldeten, wenn sie ein Behördenproblem oder Ähnliches hatten. Helena wollte z.B. ihre Tochter, die in Odessa bei einer Freundin lebte, zu sich nach Berlin holen – auf dem Wege der „Familienzusammenführung“, aber als sie sie endlich mit einem Touristenvisum hier hatte, sagte man ihr, die Tochter werde demnächst schon 16 und damit bestünde keine Notwendigkeit eines permanenten Aufenthalts bei der Mutter mehr. Auch ein hinzugezogener Anwalt konnte da nichts machen. Aus lauter Kummer fing Helena an zu trinken. Und wollte mich nicht mehr sehen – bzw. mir nichts mehr erzählen. Ira hatte ihre Tochter bereits bei sich, aber sie zerstritt sich irgendwann mit ihrem Scheinehemann, bei dem sie – in Hellersdorf – lebte – und verschwand aus Berlin. Zuvor hatten die beiden Frauen mir immer mal wieder Bruchstücke aus ihrem Leben und über ihre Arbeit erzählt. Diese hatte ich dann – u.a. für die Frauenzeitung „Weibblick“ – zu einer Geschichte verarbeitet, in der es u.a. über Schleppenbanden ging, die vor allem Frauen aus Osteuropa brutal in die hiesigen Bordelle verschleppen. Aus den Gesprächen mit Helena und Ira – und später mit Lilli Brand hatte ich dagegen den Eindruck gewonnen, dass die Brutalität gegenüber diesen Frauen eher vom deutschen Staatsapparat und der Polizei ausgeht.
Ira und Lilli waren mit einer Kiewer Schlepperbande nach Berlin gekommen, Helena hatte es jedoch alleine hierher geschafft, obwohl sie, wie sie sagte, im Gegensatz zu Ira und Lilli keine Studierte sei. Aber einfacher hätte sie es jetzt auch nicht: Allein die Geldüberweisungen für ihr Kind kosten jedesmal 90 DM, jedes Paket mit Anziehsachen allein 50 DM Porto und laufend kämen weitere Kosten dazu, kurzum „Meine Mafia ist mein Kind!“ Ira und Lilli mußten auch erst einmal nichts für den illegalen Transit zahlen, sondern nur ihre Pässe einem „Russen“ geben, der sie zusammen mit einigen hundert Dollar einem korrupten Visabeamten bei der deutschen Botschaft in Kiew in die Hand drückte. Dieser bewilligte ihnen daraufhin Touristenvisa. Ein anderer „Russe“ brachte dann die Mädchen mit dem Zug nach Berlin, wo sie in einer Puffpension am Stuttgarter Platz untergebracht wurden. Für Ira und Lilli ging es von dort aus gleich weiter nach Freiburg, wo sie in einem Club tanzen und anschaffen sollten. Vorher bekamen sie von dem „Russen“ noch Geld für neue Klamotten. Obwohl sie danach über 2000 DM Schulden bei ihm hatten, ließ er ihnen die Pässe, denn im Falle einer Razzia konnten sie damit nachweisen, dass sie sich immerhin legal in Deutschland aufhielten. Ohne Papiere wurden die Frauen dagegen oft so lange verhört, bis eine von ihnen die Namen ihrer Schlepper verriet.
Während Ira hier schon beim ersten Aufenthalt einen Ehemann fand, mußte Lilli die Dienste der Kiewer Schlepperbande später noch einmal bemühen, bis auch sie sich verheiraten und damit in Deutschland bleiben und arbeiten konnte. Inzwischen hat sie schon alle möglichen Jobs gemacht – und sprich fast perfekt Deutsch.
Deswegen lag es nahe, dass sie mir die Geschichten sozusagen in die Maschine diktierte. Dadurch war ich nur noch so etwas wie ein Hilfsredakteur. Weil sie beim Geschichtenerzählen merkte, dass sich damit auch Geld verdienen ließ, sah sie darin bald eine Möglichkeit, sich als Journalistin selbständig zu machen. Dazu forcierte sie das Geschichtensammeln derart, dass sie bald nicht mehr zur Arbeit ins Bordell ging. Dafür interessierte sich dann eine renommierte Literaturagentur für ihre Texte. Um Kosten zu reduzieren gab sie zudem ihre teure Wohnung am Kurfürstendamm auf und zog an den Stadtrand zu einem Bekannten. Dort hatte ihr Hund auch mehr Auslauf. Sie trieb sich die meiste Zeit in der Stadt herum – mit einem Aufnahmegerät bewaffnet: nosing-around. So entstanden die meisten Artikel. Irgendwann riefen zwei Beamte von der Polizei bzw. vom BKA bei mir an und wollten sich mit Lilli treffen. Sie lehnte das jedoch kategorisch ab. Kurz zuvor hatte sie gerade eine kleine taz-Reportage über einen brutalen Polizeieinsatz am Leopoldplatz gegen zwei Araber veröffentlicht gehabt. Und dann hatte man sie auch noch verhaftet und für mehrere Wochen eingeknastet, weil sie irgendwelche Schulden nicht bezahlt und auf alle Schreiben nicht reagiert hatte.
Nicht dass sie Auseinandersetzungen mit den Behörden scheute, im Gegenteil: Weil sie ständig irgendwelche Dokumente verlor oder ihr geklaut wurden, war sie sogar laufend damit beschäftigt, ihre Papiere wieder in Ordnung zu bringen – wozu sie immer wieder irgendwelche Formulare ausfüllen und Behördentermine einhalten mußte. So manche Verabredung mit ihr in der taz kam deswegen nicht zustande. Und dann machten ihr auch noch ihre Männer ständig Ärger. Aber es ging voran, wenn auch viel langsamer als geplant. Außerdem veränderte sich das „Thema“ mit der Zeit: weg von Prostitution, Schlepperbanden, Polizeirazzien, Abschiebung und Knast. Stattdessen erzählte sie Geschichten aus ihrer Kindheit – vom Großvater auf dem Dorf, von ihrem Hund, von ihrem wilden Freund Felix und ihrem durchgeknallten Freund Alexander, beides Fixer. Harmlos waren auch diese Geschichten nicht. Dafür beruhigte sich ihr persönliches Hinterland ein bißchen, nachdem sie bei ihrem eifersüchtigen türkischen Rentner ausgezogen bei einem alten deutschen Philosophen eingezogen war. Dort wurde sie nun aber erneut – von fünf Polizisten – verhaftet: Wieder hatte sie eine Rechnung nicht bezahlt – 400 Euro oder so. Außerdem gab es da noch einen Strafbefehl wegen des taz-Artikels vom April 2002 über den „Zwischenfall“ am Leopoldplatz. U.a. wurde ihr in dem Schreiben vorgeworfen, sich dazu unrechtmäßig – mit einem Presseausweis und einem Aufnahmegerät – Informationen beschafft zu haben. Da Lilli Brand zur Zeit immer noch in der JVA-Frauen, Alfredstraße 11, einsitzt, bemühte sich der alte Philosoph um eine Kopie des Strafbefehls, den er an die taz weiterleiten wollte. Das Amtsgericht teilte ihm jedoch schriftlich mit: „Der Strafbefehl konnte hier nicht ermittelt werden“.
Ich befürchtete gleich, dass hier eine harte Journalistin weich geklopft werden soll, die das offizielle Bild von den guten deutschen Polizisten, die uns und die ausländischen Frauen vor den bösen ukrainischen Zuhältern schützen, beschmutzt. Zuletzt polierte das Montagsmagazin Spiegel im Zusammenhang der Friedman-Affäre diese Lüge ganz groß wieder auf, obwohl zuvor auf einem Prostituierten-Kongreß der Gruppe „Dona Carmen“ in Frankfurt von nahezu allen Teilnehmern festgestellt worden war, dass nicht der Frauenhandel das Problem sei, sondern das neue – allzu halbherzige – Prostituiertengesetz, das für die ausländische Frauen überhaupt nichts bringe – inländische es unterdes aber kaum noch gebe, wenigstens in Frankfurt und Berlin.