
4-1-2006
Erika Mann. Eine jüdische Tochter von Viola Roggenkamp

Artikel erschienen am Sa, 31. Dezember 2005
Viola Roggenkamp: Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familia Mann-Pringsheim. Arche, Zürich und Hamburg. 251 S., 19,90 EUR.
Ein beliebtes Gesellschaftsspiel in jüdischen Kreisen ist der Streit um die
Frage, wer und was denn ein Jude, besser noch, was Judentum, beziehungsweise
Jüdischsein, denn sei? Die Gläubigen, und nicht nur die Orthodoxen, haben es
leicht mit der Antwort. Die Agnostiker, besonders wenn sie ihre Zugehörigkeit
nicht von den Feinden der Juden, also vom Antisemitismus her, definiert haben
wollen, tun sich schwerer. Ist man Jude durch die Geburt, die Kultur, die
Erziehung, die Biologie? Kann man Jude werden? Ja, aber nur durch den Glauben,
durch Konversion. Kann man - die heikelste Frage - das Judentum abstreifen, wenn
man als Jude, als Jüdin geboren ist? Durch Taufe, durch Heirat? Oder gar aus
Überdruß? Ist das Judentum ein Klub, aus dem man austreten kann? Wenn nicht,
dann ist es doch eine genetische Sache? Aber wären da nicht die blauäugigen
Juden "weniger jüdisch" als die dunkleren, von den vielen rothaarigen ganz zu
schweigen? Ein Spiel, das seine Reize hat, bei dem es aber keine Gewinner oder
Verlierer gibt. Im Zeitalter des akuten Antisemitismus werden diese
Unterscheidungen weitgehend hinfällig. Wer als Jude verfolgt wird, ist Jude, ob
er will oder nicht.
Deutschlands berühmteste "Mischehe" Viola Roggenkamp, die Autorin des
erfolgreichen deutsch-jüdischen Romans "Familienleben", nimmt sich dieser Fragen
anhand von Deutschlands berühmtester "Mischehe", die der Familie Pringsheim-Mann,
an; eine Familie, die bekanntlich schon viel biografische Aufmerksamkeit auf
sich gezogen hat. Roggenkamp konzentriert sich auf einen Aspekt, den sie für
vernachlässigt hält und nimmt als Fokus, wenn auch nicht als ausschließliche
Protagonistin, Erika, das älteste Kind der Manns. Laut Roggenkamp hat Erika Mann
ihre jüdische Herkunft mütterlicherseits konsequent verleugnet, im Sinne, daß
sie sich nie als Jüdin einstufte, und diese Verleugnung, so folgert sie, kam
einer psychologischen Verdrängung im Freud'schen Sinne gleich, die sich in
Erikas Leben, Schreiben und Denken ungut, oder zumindest belastend, auswirkte.
Man kann dieses oder jenes Detail in dem zügig geschriebenen und polemisch
angelegten Buch anzweifeln, doch die Autorin hat gewiß recht, wenn sie meint, es
müsse doch stutzig machen, wenn eine Tochter aus prominenter und nur teils
assimilierter Familie (Katia Manns Mutter war getauft , der alte Pringsheim war
es nicht) während der großen Judenverfolgung, der sie in Deutschland zum Opfer
gefallen wäre, sich nicht mit ihrem jüdischen Erbe auseinandersetzt, sondern
konsequent so tut, als gäbe es das gar nicht. Erika Mann war umgeben von
jüdischen Freunden, sowohl zu Hause wie in der Emigration, alle mehr oder minder
assimiliert, aber sie zählte sich einfach nicht dazu. Sie leitete sich nur von
der väterlichen, nicht von der mütterlichen Seite ab. So wurde diese hochbegabte
Frau nach und nach Thomas Manns Tochter und weiter nichts. Die allzu enge
Bindung an einen extrem ichbezogenen Vater verstellte ihr den Weg ins eigene
Leben.
Sie wirkte konsequent und unermüdlich gegen die Nazis in ihrem Kabarett "Die
Pfeffermühle" und als Journalistin und Vortragende, in Amerika auch oft in
Zusammenarbeit mit jüdischen Organisationen, aber immer nur vom
politisch-intellektuellen Standpunkt, nicht als eine von den deutschen
Rassegesetzen Betroffene. Währenddessen wurde im Familienkreis die
Homosexualität nie verdrängt, sondern ganz offen besprochen. Hier sieht
Roggenkamp Zusammenhänge, in dem Sinne, daß das eine Außenseitertum für das
andere einstehen mußte, und hier ist sie wohl am Angreifbarsten, weil diese
Zusammenhänge nicht sofort einleuchten. Und doch konstatiert auch der
Thomas-Mann Forscher Heinrich Detering in seinem neuen Buch "Juden, Frauen,
Literaten" über Manns frühe Erzählungen und Essays, ein überraschendes
Spannungs- beziehungsweise Verwandtschaftsverhältnis zwischen Judesein und
Homosexualität, und bekräftigt dadurch indirekt Roggenkamps These.
Viola Roggenkamp überlegt sogar, daß Thomas Mann sich womöglich von den Nazis, die ihn eine Zeitlang umwarben, hätte überreden lassen, in Deutschland zu bleiben oder dahin zurückzukehren, wenn ihn eine solche Entscheidung nicht die Familie gekostet hätte. Wenn das stimme, meint sie, so verdanke er letzten Endes seinen Status als Deutschlands prominentester Exilautor eben diesem nichtarischen Element, das man gern unter den Teppich kehrte.
Es kommt hinzu, daß die politischen Exilanten sich als etwas Besseres sahen als die "nur" rassisch verfolgten Juden. Diese hatten noch nicht den Märtyerstatus, den eine spätere Generation den Opfern des Holocaust verliehen hat. (Selbst das Wort "Holocaust" gibt es erst seit den siebziger Jahren.) Die Mann-Kinder hatten also etwas zu verlieren, wenn sie sich mit den jüdischen statt mit den politischen Emigranten identifizierten, denn letztere waren aus Gewissensgründen geflohen, die Juden waren willenlos in den Strudel geraten. Außerdem, wie die Autorin ganz richtig feststellt: "Amerika hätte seine Boys nicht zur Rettung der Juden in den Krieg geschickt, wohl aber zur Verteidigung der Zivilisation." Die Verleugnung, ja Abwehr, des Jüdischen dürfte also ganz bewußte, nicht nur unbewußte Beweggründe gehabt haben.
Das Buch bezieht seine Brisanz aber auch aus dem weiteren Umfeld der Verdrängung jüdischen Schicksals in der Nachkriegszeit. Roggenkamp geht auf die heutige Diskussion ein, wer denn Opfer gewesen sei, und auf das Ressentiment gegen Juden von seiten der nichtjüdischen Deutschen, die ihr eigenes Leiden von dem der Juden sozusagen vereinnahmt sehen. Das sind wirklichkeitsnahe Argumente, die den Horizont über die historischen und literaturhistorischen Fragen hinaus erweitern. Roggenkamp irritiert und provoziert. Doch kann man sich der Eindringlichkeit und der Aktualität dieser Irritationen schwer entziehen. Die Autorin hat mit ihren Überlegungen zum deutsch-jüdischen Verhältnis in der kulturellen Elite mit nicht geringem Mut in ein Wespennest gestochen.
Ruth Klüger ist Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie wurde mit
ihrer Autobiographie "weiter leben" bekannt. An dieser Stelle präsentiert sie
regelmäßig Bücher von Frauen.
Ruth Klüger

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.11.2005, S. 40
Wotans Tochter
Zwei Bücher zum hundertsten Geburtstag von Erika
Mann
TILMANN LAHME
Viola Roggenkamp: "Erika Mann". Eine jüdische Tochter.
Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Arche Verlag,
Zürich, Hamburg 2005. 256 S., 10 Fotos, geb., 19,90 [Euro].
Ute Kröger: "Wie ich leben soll, weiß ich noch nicht". Erika Mann zwischen
"Pfeffermühle" und "Firma Mann". Ein Porträt. Mit Erinnerungen von Frido Mann.
Limmat Verlag, Zürich 2005. 202 S., 80 Abb., geb., 19,80 [Euro].
"Was für eine
sonderbare Familie sind wir! Man wird später Bücher über uns - nicht nur über
einzelne von uns - schreiben." Eine hellsichtige Prophezeiung Klaus Manns:
Längst sind die Manns literarischer Pop. Das hat seine Schattenseiten: Wer ein
ihm auf den Nägeln brennendes Thema popularisieren möchte, bedient sich gern der
Familie um den "Großschriftsteller" Thomas Mann.
Nun ist eben Erika an der Reihe, die heute vor hundert Jahren geboren wurde.
Viola Roggenkamp widmet sich ihren jüdischen Wurzeln. Die als Kleinkind getaufte
Mutter Katia tat die Frage nach ihrem Judentum mit "Unsinn, alles Unsinn!" ab,
und ihre Kinder folgten ihr darin. Eine Geschichte der Verleugnung und
Verdrängung, so Roggenkamp, die in ihrem Buch kräftige Hiebe austeilt: gegen
Erikas Zeitgenossen ebenso wie gegen die heutigen Deutschen, die es sich
gemütlich machten in ihrer das Judentum negierenden Normalität und von den Juden
nichts wollten, als zu hören, "daß sie endlich genug getan haben, um ihre Eltern
und Großeltern zu entschulden". Die Forschung kommt nicht besser weg, denn auch
sie "löschte das Jüdische der Familie aus".
Der Hauptschuldige aber ist Thomas. Während nach Roggenkamp Homosexualität ein
offen besprochenes "Dauerthema" im Hause Mann war (wirklich?), trieb der
Antisemit Thomas Mann Frau und Kinder zur Verleugnung des Jüdischen. Staunend
folgt man der Autorin auf ihre psychoanalytische Geisterfahrt. Daß der Dichter
seinem Sohn Michael, der sich vor dem Kruzifix fürchtete, den Gekreuzigten über
das Bett hängte, galt bislang als Beleg für rigide Pädagogik. Dank Viola
Roggenkamp wissen wir nun, daß die Jesusfigur, "leidend gekrümmt und um die
Lenden ein lockeres Tuch drapiert", für den Vater "auch Homosexuelles"
bedeutete. Die Dominanz des Homosexuellen in der Familie, verbunden mit dem
Antisemitismus, unterdrückt mütterliche Weiblichkeit und Judentum. Logische
Folge: Erika wird eine ihre jüdischen Wurzeln verleugnende Lesbe. Was in diese
Denkschablone nicht hineinpaßt, fällt weg, so Erikas große, unglückliche Liebe
zum Dirigenten Bruno Walter, dem Freund ihres Vaters, der so alt war wie dieser
und Jude. Man mag sich kaum ausmalen, welch kühne Folgerungen Viola Roggenkamp
der armen Erika auf die Seele genagelt hätte, sprengte diese Hetero-Liebe nicht
ihr psychoanalytisches Klötzchen-Modell.
Immer wieder Thomas Mann. Nur zu gern hätte der Dichter sich dem "Dritten Reich"
angeschlossen, liest man, wäre da nicht der hinderliche Umstand seiner Ehe mit
einer Jüdin gewesen. Mit offenen Armen (nämlich einem "Schutzhaftbefehl") hätten
ihn Goebbels & Co. empfangen. Und Katias Eltern ließ man 1939 nur noch
emigrieren, weil Thomas Mann trotz allem für die Nazis "der große deutsche
Dichter blieb". Das alles und noch viel mehr wären beeindruckende Korrekturen
der bislang vorliegenden Forschungsergebnisse, wenn Viola Roggenkamp dafür
Fundierteres als wütende Behauptungen anführen könnte.
Statt dessen verheddert sie sich heillos in den Fakten. Laufend zitiert sie
Familienmitglieder, die von Katia Mann als "Halbjüdin" sprechen. Für Roggenkamp
ein klarer Beleg für die Verdrängung des eigenen Jüdischen. "Glaubte Erika Mann
wirklich", fragt sie fassungslos, "ihre Mutter sei nach der Definition der Nazis
höchstens Halbjüdin gewesen?" Das Rätsel löst sich durch die einfache Antwort:
Ja, nach dieser Definition war es so. Auf welchem Wege auch immer, ob durch
Bestechung oder Fälschung oder weil die Herkunft nicht mehr genau zu
rekonstruieren war: Hedwig Pringsheim, Katias Mutter, erhielt einen "arischen
Paß". Viola Roggenkamp erwähnt dies selbst an einer Stelle - folgenlos.
Thomas Mann findet nicht einmal als Schriftsteller ihre Gnade: Schon seine
Sprache zeige Nazi-Nähe. "Eine betulich gestelzte Gediegenheit, deren
selbstverliebter Biedersinn mit der nächsten gewundenen Wendung zu ironischer
Distanz werden konnte." Wem statt seiner die Krone der Emigrationsliteratur
gebührt hätte, weiß Roggenkamp auch: Lion Feuchtwanger, dessen eher
leichtgewichtige Bücher sie denen Manns als mindestens gleichwertig
gegenüberstellt. Leise Zweifel an der Kompetenz ihres Urteils weckt allerdings
der Umstand, daß sie Thomas Manns "Joseph"-Epos, nach Ruth Klüger ein
"großartiger und begeisterter Tribut eines Nichtjuden an die jüdische
Tradition", nicht nur mit ein paar Sätzen und nebenher abtut, sondern das -
vierteilige! - Werk auch als "Roman-Triologie" bezeichnet - dreistimmig
gesungen?
Erika Mann wollte von ihren jüdischen Wurzeln nichts wissen, wie schon ihre
Mutter. Warum dies so war, wäre ein interessantes Thema, bei dem man der
Illusion einer "deutsch-jüdischen Symbiose" ebenso auf die Spur käme wie dem
Verleugnungsdruck der Assimilation. Davon erfährt man bei Roggenkamp wenig, viel
hingegen über ihre Trauer über den Verlust des Jüdischen in Deutschland und über
ihren Zorn, wobei unklar bleibt, warum sich dieser hauptsächlich gegen Thomas
Mann richtet.
Wirklich etwas über Erika Mann zu sagen hat hingegen Ute Kröger. In einer
knappen, brillanten Porträtskizze stellt sie einzelne ihrer Lebensstationen in
den Mittelpunkt: Erikas politisches Kabarett "Die Pfeffermühle", ihre Arbeit als
Assistentin, dann Nachlaßverwalterin des Vaters oder ihre mutigen Reporterreisen
durch das gefährliche Europa der Kriegszeit. Krögers Grundsympathie für ihren
Gegenstand verführt sie nicht dazu, die harten, ungerechten, manchmal
unsympathischen Züge Erika Manns zu verschweigen: ihren Hang zur
Legendenbildung, ihren Haß oder ihr arrogantes Klassenbewußtsein. So intelligent
und mutig "Die Pfeffermühle" in der Schweiz auch gegen den Nationalsozialismus
ankämpfte, ließ die Direktorin ihre Truppe doch die Rangunterschiede nur zu
deutlich spüren: Während die erklärte Sozialistin Erika Mann in der ersten
Klasse zum nächsten Gastspielort reiste, nahm das Ensemble in der Holzklasse
Platz.
Als eigentliche Lebensleistung Erika Manns neben dem Kabarett und der
assistierenden Tätigkeit für den Vater sieht Kröger ihre Kinderbücher an, für
deren Wiederentdeckung sie eindringlich plädiert. Überzeugender noch ist das
Kapitel über das Beziehungsgeflecht der Familie, der Höhepunkt des Buches. Ute
Kröger schildert sowohl die Solidarität der Manns untereinander gegen die äußere
Welt als auch die innerfamiliären Konflikte und Rivalitäten. Mit keinem der
Geschwister konnte Erika nach Klaus' Tod Frieden halten, und selbst mit der
Mutter rang sie eifersüchtig um den nächsten Platz am Thron Thomas Manns.
Zugleich machte sie sich mit großem Geschick um dessen Werk verdient, kürzte,
ermutigte und trieb ihn an. In ihren Augen gab ihr der Vaterdienst nach dessen
Tod ein exklusives Recht darauf, seine Vikarin auf Erden zu sein. Als die
Schwester Monika es wagte, ein eigenes Erinnerungsbuch über Familie und Vater zu
veröffentlichen, herrschte Erika sie an, da des Vaters Beziehung zu ihr
"durchaus unvermögend" gewesen sei, habe sie auch kein Recht, "mit einem Pfunde
zu wuchern, das Dir niemals gehört hat".
Über den "Zauberer" schreiben durfte nur sie. Wenn jemand jedoch einen der Ihren
angriff wie etwa Theodor W. Adorno, der den Bruder Golo als Antisemiten
anschwärzte, um seine Berufung nach Frankfurt zu verhindern, war sie sofort zum
Kampf und zur Rache bereit: draufgängerischer als ihre fünf Geschwister
zusammen, ganz das "kühne, herrliche Kind" ihres Vaters. Ute Krögers glänzend
formulierter Essay präsentiert eine vielseitige, scharfkantige und lebendige
Erika Mann.
N Z Z Online
5. November 2005,
Neue Zürcher Zeitung
Die Amazone des Zauberers
Neuerscheinungen zu Erika Manns 100. Geburtstag
Am 9. November 1905 kam Erika als erstes Kind von Katia und Thomas Mann in München zur Welt. Auf der Bühne, im Rennwagen oder als Reporterin trat die vielseitig Begabte hervor. Die Rolle ihres Lebens fand sie indes an der Seite ihres Vaters: als Muse und Managerin, danach als seine Sachwalterin bis zu ihrem Tod 1969.
Von Manfred Koch
Erika Mann: Ausgerechnet Ich. Ein Lesebuch. Ausgewählt von Barbara Hoffmeister. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2005. 272 S., Fr. 16.50.
Ute Kröger: «Wie ich leben soll, weiss ich noch nicht». Erika Mann zwischen «Pfeffermühle» und «Firma Mann». Ein Porträt. Limmat-Verlag, Zürich 2005. 189 S., Fr. 32.-.
Viola Roggenkamp: Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Arche-Verlag, Zürich 2005. 251 S., Fr. 34.90.
Dass sein erstes Kind eine Tochter war, hat Thomas Mann geschmerzt. Wie zur Entschädigung wurde sie sein ‹männlichstes› Kind. Keiner im Hause Mann konnte es, was Tatkraft, Verwegenheit, Kampfbereitschaft und Härte gegen sich selbst angeht, mit Erika aufnehmen. Ihr Leben war turbulent. Zweimal mit homosexuellen Männern verheiratet, liebte sie vor allem Frauen, zuletzt aber mit erschreckender Heftigkeit den Dirigenten Bruno Walter, der der Vater ihrer besten Jugendfreundin war. Schliesslich wurde sie der geistige Intimus des eigenen Vaters. In der Thomas-Mann-Literatur gibt es dafür das Bild der «Kopfgeburt»: Erika, die androgyne Schönheit, als Pallas Athene, dem Haupt des Dichtergotts entsprungen, an dessen Ratschlüssen sie mitwirkt, für dessen Sache sie jungfräulich ficht.
Aber sie hat auch selbst geschrieben, auffällig viel wiederum in Männerdomänen: Kriegsberichte, Reportagen aus Krisengebieten, politische Essays (endlich gibt es jetzt einen Band, der eine Auswahl dieser Texte im Taschenbuch zugänglich macht). Vermutlich ist Erika Mann die einzige deutsche Schriftstellerin (Schriftsteller mit eingeschlossen), die jemals ein professionelles Autorennen gewann. 1931 siegte sie beim 10 000-Kilometer-Europa-Rally der Firma Ford und verfasste in den Pausen Artikel über die Etappenorte. Es gibt neben ihr wohl auch nicht viele Autoren, die in einem hoch renommierten Theater eine Hauptrolle spielen durften: 1929 gab sie im Münchner Prinzregententheater die Königin in Schillers «Don Carlos». Ihr Leben war ein Hasten von Auftritt zu Auftritt.
Im Grunde stand sie immer auf der Bühne und war zugleich, getrieben von der Fülle ihrer Begabungen, rastlos unterwegs. Das begann bereits bei der Weltreise mit Bruder Klaus in den zwanziger Jahren, auf der das Paar in den USA öffentliche Vorstellungen als die «literary Mann-twins» gab. Nach dem Ende ihrer Schauspielkarriere (um 1930) setzte sie das Lebensrally fort mit den Tourneen der «Pfeffermühle», deren Organisatorin und Texterin sie war; nach dem Ende der «Pfeffermühle» agitierte sie ab 1937 im amerikanischen Exil als politische Vortragsreisende gegen Hitler. Seit 1948 Lektorin und Managerin des Vaters, wurde sie zuletzt in der Wahlheimat Schweiz (1952-1969) zur Reisenden und Öffentlichkeitsbeauftragten in Sachen Thomas Mann. Am Ende eines Lebens, das durch gnadenlose Überanstrengung und Drogenmissbrauch gekennzeichnet war, blieb nur noch der Wechsel der Sanatorien.
Angesichts der exzellenten Erika-Mann-Biografie, die Irmela von der Lühe 1993 vorgelegt hat, war im Gedenkjahr keine neue, umfassende Lebensbeschreibung zu erwarten. Die beiden Porträts, die jetzt erschienen sind, beschränken sich denn auch auf Teilaspekte. Bei Viola Roggenkamp ist Erika Mann sogar kaum noch die Hauptperson. Roggenkamps Thema ist das Jüdische im Familiengeflecht der Manns. Katia Mann war protestantisch getauft, der Herkunft nach jedoch Jüdin. Ihr Vater war der brillante Münchner Mathematiker und Universitätsprofessor Alfred Pringsheim, der aus moralischer Standhaftigkeit die Konversion zum Wohl der Karriere verweigert hatte. Die Mutter Hedwig entstammte jüdischen Familien, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts zum Christentum übergetreten waren. Die Familiengeschichte der Pringsheims ist repräsentativ für die Geschichte des deutschen Judentums im 19. Jahrhundert. Im Zug des rasanten sozialen Aufstiegs und der damit einhergehenden kulturellen Anpassung kam es zu einer zunehmenden Distanzierung vom Glauben und von den traditionellen Lebensformen der Vorväter.
Die in Spitzenpositionen der Wirtschaft und der akademischen Welt aufgestiegenen Juden der Grossstädte sahen mit Verachtung auf die armen Juden der ländlichen Regionen herab und überschütteten die Orthodoxen, die auf deutlicher Abgrenzung beharrten, mit Spott. «Wie abscheulich sind doch Juden en masse», konnte Hedwig Pringsheim mit Blick auf integrationsunwillige Juden schreiben. Katia Mann reagierte schroff ablehnend, wenn man ihr die Frage nach ihrer jüdischen Identität stellte. Für Erika Mann spielte die jüdische Herkunft bereits keinerlei Rolle mehr. Sie thematisierte sie nicht; auch von aussen wurde sie nicht als Jüdin wahrgenommen, nicht einmal von den Nationalsozialisten. Ausgebürgert hat man sie 1935 als linke Kabarettistin.
Roggenkamp sieht in dieser exemplarischen Familiengeschichte ein einziges unheilvolles Kontinuum der Verdrängung. Ihr Buch ist eine genealogisch weit ausholende Anklage der Verweigerung, sich zum Jüdischen zu bekennen, das doch «das Besondere, das Kostbare» gewesen sei, das diese Menschen ausgezeichnet hätte. Erika Manns Lebensgeschichte wird zur Passion, von ihr selbst und der Mutter mitverschuldet: das Jüdische des Kindes wird dem «gestandenen Antisemiten» Thomas Mann zum Opfer gebracht, sein Weibliches dem homophilen Übervater, mit dem sie sich zuletzt bis zur Ununterscheidbarkeit identifizierte. Mit empörten Seitenhieben gegen die Mann-Biografik werden die Familientexte durchforstet nach Belegen für die schicksalhafte «Verleugnung». Keines der Zitate, die Roggenkamp anbringt, ist indessen neu, alle sind - zum Teil mehrfach - belegt und diskutiert in den Biografien von Mendelssohn, Harpprecht, Kurzke, von der Lühe sowie Inge und Walter Jens.
Man staunt über die grossrichterliche Attitüde der Verfasserin, die sich nicht scheut, gleich zu Beginn mögliche Kritiker ihres Verfahrens vorsorglich unter Antisemitismus-Verdacht zu stellen. Roggenkamp huldigt einem diffusen Essenzialismus des «Jüdischseins», der sie von genaueren historischen Überlegungen entlastet. Warum hätten diese Familien überhaupt die Pflicht haben sollen, ihrem Jüdischsein treu zu bleiben? Was hätte das konkret geheissen? Die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft war unter den damaligen Bedingungen schlicht die einzige Möglichkeit, ein besseres Leben zu führen. Zu Beginn des Kaiserreichs zählten bereits fast zwei Drittel der deutschen Juden zur wirtschaftlichen und kulturellen Elite des Landes; die religiösen Bindungen und Lebensformen der Vergangenheit waren ihnen fern gerückt.
Zu «Juden» machten diese hochgebildeten Stadtbürger, deren Gott nicht Jahwe, sondern eher - wie im Fall Alfred Pringsheims - Richard Wagner hiess, erst wieder die Nazis. Zwar kam es nie zur vollständigen Akkulturation; von aussen verhinderte das der wachsende deutsche Antisemitismus, von innen jener mentale Bestand an eher unbewussten Einstellungen und Verhaltensweisen, den die jahrhundertelange Erfahrung von Repression in einer sozialen Gruppe hinterlässt. Die Option für die deutsche Kultur kann dem jüdischen Bürgertum der Wilhelminischen Zeit aber nur zum Vorwurf machen, wer zwanghaft bereits um 1870 die geschichtliche Entwicklung in Auschwitz enden sieht (erst retrospektiv erhalten auch Thomas Manns Äusserungen über Juden den fatalen Klang, der Roggenkamp ermutigt, ihn des Antisemitismus zu bezichtigen; bei allen - zweifellos oft bösen - Anwürfen wäre auch zu berücksichtigen, dass Mann darin immer sein eigenes Aussenseitertum karikiert).
Historische Redlichkeit verlangt jedoch eine doppelte Perspektive. Unweigerlich müssen wir heute die Geschichte der deutschen Juden im 19. Jahrhundert unter dem Blickwinkel von Auschwitz betrachten, zugleich aber auch den Erwartungshorizont der Zeitgenossen, ihre Hoffnung auf ein Gelingen der Judenemanzipation, ernst nehmen. Der Weg zum Völkermord war keine unausweichliche Determination, es gab Alternativen. Das Desinteresse der Pringsheims und vieler anderer an ihrem jüdischen Erbe hat deshalb nichts von pathologischer Verdrängung oder gar Verrat. Erika Mann hat den Antisemitismus bekämpft, wo immer er ihr begegnete. Dass sie es ihrem Selbstverständnis nach nicht als Jüdin, sondern als demokratische Humanistin tat - wer darf ihr das verübeln?
Ute Krögers Buch schildert ausgewählte Stationen und Arbeitsschwerpunkte in Erika Manns Biografie, ein Hauptakzent liegt auf den Schweizer Jahren, dem ambivalenten Verhältnis Erika Manns zur Schweiz. Auch Kröger steht ihrer Heldin keineswegs unkritisch gegenüber. Nah an den Quellen zeichnet sie einen zunehmend schwierigen Charakter: eine Frau von bisweilen penetranter Umtriebigkeit, dominant im Auftreten, eitel und eifersüchtig, wo die Gelegenheit sich bot (wenn z. B. konkurrierende Thomas-Mann-Denkmalpfleger auftauchten), masslos im Hass bis hin zu paranoiden Ideen. Doch Kröger gelingt es, diese Defizite überzeugend mit der kreativen Kehrseite zu vermitteln. Die Streitlust war auch das polemische Talent der Kabarettistin, der Wille zur Selbstinszenierung das Charisma der politischen Rednerin, die Herrschsucht die segensreiche Fähigkeit, den ewig zaudernden Vater anzutreiben. Herausragend ist das Kapitel über die Kinderbücher. Kröger porträtiert Erika Mann überzeugend als eine der Gründerfiguren jenes neuen Typs von Kinderliteratur, der in der Weimarer Republik entstand und den man gewöhnlich nur mit dem Namen Erich Kästner verbindet. Wiederaufgelegt wurde von diesen Büchern in den letzten Jahren nur «Stoffel fliegt übers Meer». Hier läge die wirkliche Chance einer Entdeckung.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Dokument erstellt am 01.11.2005 um 15:16:09 Uhr
Erscheinungsdatum 02.11.2005
Die ideale Vatertochter
Viola Roggenkamp wagt neue Thesen über das verleugnete Jüdische und die Homosexualität in Erika Manns Leben
VON BARBARA VON BECKER
Viola Roggenkamp: "Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und
Ver-leugnetes in der Familie Mann-Pringsheim." Arche Verlag, Zürich und Hamburg
2005, 252 Seiten, 19,90 Euro.
Sie war zeitlebens sein "kühnes, herrliches Kind", das "lebens- und liebevolle,
stets heiteren Auftrieb bringende Kind", sie selber unterschrieb als längst
erwachsene Frau ihre Briefe mit "Inniglich Kind E.": Erika Mann war die
Vater-Tochter par excellence. 1947 zog die Anfang Vierzigjährige bis zu
ihrem Tod wieder bei den Eltern ein, lektorierte Thomas Manns Dr. Faustus
und den Felix Krull. Sie war um das Werk, seine Auftritte und sein
Wohlergehen besorgt, agierte wie eine zweite Ehefrau, die sich mit der Mutter
über die Befindlichkeiten des Dichters in intimer Weise wie über ein gemeinsames
Kind austauschte.
Mütterlicherseits stand sie in einer Genealogie starker Frauen. Die Urgroßmutter
Hedwig Dohm war prominente Frauenrechtlerin und Romanautorin, ihre Großmutter
Hedwig Pringsheim hatte ihre Karriere als Schauspielerin zwar zugunsten ihrer
Ehe schnell wieder aufgegeben, aber ihre gelegentlichen Feuilletonartikel ebenso
wie ihre zahllosen Briefe und der Ruf ihres Salons in München, wo die
künstlerische und wissenschaftliche Elite der Stadt ein und aus ging, zeugen von
ihrer geistigen Brillanz. Katia Mann, die Mutter Erikas, brach ihr
Mathematikstudium, für das sie offensichtlich nicht unbegabt war, widerwillig
ab, um "Frau Thomas Mann" zu werden, wie sie sich selber später bezeichnete.
Obwohl nie berufstätig, war sie letztlich die Managerin der "Firma Mann". Diese
Ahnenreihe vereint aber nicht nur starke, sondern in ihrer Abstammung auch
jüdische Frauen, ein Erbe, mit dem Erika Mann sich selber jedoch nie explizit in
Verbindung gebracht hat.
Als Kabarettistin, als politische Publizistin, als Rednerin hatte sie sich
vehement mit Nazi-Deutschland und dem Antisemitismus auseinander gesetzt,
seltsamerweise ohne den Judenhass in Bezug auf ihr eigenes Leben zu
reflektieren. Sie selbst, ihre Eltern, ihre Geschwister sahen sich im Exil alle
ausschließlich als politisch Verfolgte. Die Tatsache, dass der große deutsche
Dichter Thomas Mann mit einer "Volljüdin" verheiratet war und seine Frau und
seine Kinder nach den national-sozialistischen Rassengesetzen somit als
hochgefährdet gelten mussten, wurde ausgeblendet. Von Katia Mann ist
überliefert, dass sie "immer vollkommen rasend" geworden sei, wenn sie auf ihr
Jüdischsein angesprochen wurde. Golo Mann schrieb in seinen Erinnerungen,
dass er lange nicht gewusst hatte, dass seine Mutter "aus einem jüdischen Haus"
stammte.
Viola Roggenkamp, die vor einem Jahr einen stark autobiographisch geprägten
Roman über ihre Kindheit in einer ebenfalls nur von der Mutterseite her
jüdischen Familie geschrieben hatte, versucht sich nun dem "Verleugneten in der
Frauengenealogie der Familie Mann-Pringsheim" über eine interessante These zu
nähern: Diente der manchmal geradezu frivol-offene Umgang mit der Homosexualität
innerhalb der Familie dazu, "das Jüdische als das vermeintlich Bedrohliche" zu
verdecken?
Es fällt tatsächlich auf, dass in einer Familie, in der über absolut alles,
inklusive der sexuellen Neigungen des eigenen Vaters, ausführlich debattiert
wurde, die eigene jüdische Herkunft offensichtlich zum Tabu erklärt war. Hinzu
kommt, dass Thomas Mann in Äußerungen seinen von antisemitischen Stereotypen
nicht freien Ressentiments wenig Zwang anlegte. Eine Haltung, die sich seiner
Tochter zweifellos mitteilte und die zumindest unbewusst dazu beitragen mochte,
selber so wenig wie möglich mit Jüdischem zu tun haben zu wollen, um die Liebe
des Vaters nicht auf die Probe zu stellen.
Das ging soweit, dass Erika Mann ihr apart dunkelhaariges Äußere wie auch ihren
scharfen, schnell und spitzzüngig urteilenden Intellekt Gaben - die eher
zurückweisen auf die Talente von Groß- und Urgroßmutter mütterlicherseits -
lieber zurückgeführt sehen wollte auf die exotische brasilianische Urgroßmutter
väterlicherseits, eine, so Roggenkamp, "gänzlich unbekannt gebliebene
Urwaldschönheit, die jung verstarb".
Natürlich stellt die Autorin auch die Frage, ob es zulässig ist, Erika Mann in
der Abwehr ihrer jüdischen Identität nun nachträglich in exakt diesem
Zusammenhang zu verankern. Eine Frau, die ihr Leben lang Weltbürgerin war,
evangelisch getauft, aber keine Religion praktizierend, von liberalem Freigeist,
der sich in kein etikettiertes Kästchen sperren ließ, rebellisch gegen
Konventionen, eine Bohémienne und Lesbierin. Roggenkamp argumentiert, dass
gerade das Jüdischsein ihrer Mutter "für die Töchter und Söhne Thomas Manns zur
hilfreichen Unterscheidung und Eigenständigkeit ihm gegenüber" hätte führen
können. Eine Möglichkeit, die jedoch keines der Mann-Kinder als Chance zu einer
nicht vom Vater dominierten Identität begriffen und genutzt hatte.
Viola Roggenkamp lehnt es offensiv ab, "jüdische Deutsche, die lieber keine
Juden sein wollten", in diesem Gefühl "zu respektieren". Für sie verhindert
diese Art von fragwürdiger Rücksichtnahme das nötige Nachdenken, mutet an, als
ob das Jüdische "etwas Unzumutbares" wäre. Sie kennt die Sekundärliteratur zu
ihrem Thema sehr genau, und es ist wirklich frappant, wie ausweichend in der
biographischen Literatur über die in Deutschland mittlerweile zu fast schon
dynastischer Bedeutung aufgestiegene Mann-Familie mit dem Signum "jüdisch"
umgegangen wird, auch in Zusammenhängen, die eigentlich eine Erklärung oder
Frage danach geradezu zwingend nahelegte.
Genau dieses peinliche Vermeiden, die bemühte Auslassung führt Viola Roggenkamp
in ihrem Buch vor. Sie schlägt weiter einen Bogen zu dem verdrängenden,
negierenden, beschönigenden Umgang mit der Schoa vom Nachkriegsdeutschland bis
heute, und hin zur neueren Diskussion über das Verlangen der Deutschen, sich
eben falls als Opfer - von Krieg, Vertreibung, Naziterror - ansehen zu dürfen.
Erika Mann hatte sich nie als Opfer gefühlt - auch nicht als das des
übermächtigen Vaters. Vielmehr gab es ein starkes Band zwischen ihr und dem
Vater: das Homosexuelle. Dieses "schloß die Mutter aus. Das Jüdische verband die
Kinder mit der Mutter und schloß den Vater aus. Verbotene Nähe war nicht das
Homosexuelle, sondern das Jüdische", spitzt Roggenkamp zu. Die androgyne Tochter
sei die ideale Partnerin für den Vater: Weder stoße sie ihn durch zuviel
Weiblichkeit ab noch bedrohe sie ihn durch einen schönen Knabenkörper, so wie
der Sohn Klaus. Das Jüdische war somit, wie es Viola Roggenkamp in ihren
Ausführungen schlüssig zeigt, für die Tochter in mehrfacher Hinsicht keine
wünschenswerte Identität.
Natürlich müssen solche Analysen letztlich im Bereich der Zuschreibung, der
Vermutung bleiben. Aber dieser Versuch einer Annäherung, gerade weil die Autorin
an manchen Stellen ihre Thesen gezielt forciert und bewusst provokant einbringt,
schafft es mit Verve und intellektueller Schärfe, dem Bild des mittlerweile
sattsam durch alle Generationen, Kinder und Kindeskinder erforschten
Familienclans eine neue, bedenkenswerte Facette hinzuzufügen.
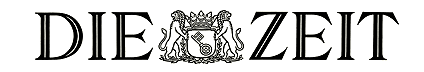
DIE ZEIT 13.10.2005 Nr.42
Alternative: Zivilisation
Viola Roggenkamp zeigt uns die Jüdin Erika Mann
Von Elisabeth Wehrmann
Viola Roggenkamp: Erika Mann: Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann- Pringsheim; Arche Verlag, Hamburg 2005; 256 S., 19,90 €
Im September 1937 schreibt Klaus Mann in einer Moskauer Exilzeitschrift über Gottfried Benn – fassungslos darüber, dass der Arzt und Dichter die Ideen des Humanismus an die Nazis verraten hat. Benn treibe heuer Rassen- und Familienforschung, berichtet Klaus Mann. Da sitzt der ehemals Bewunderte im Weinhaus Kempinski und sucht anhand der Getränkekarte (die einen »Dürkheimer Benn« verzeichnet) zu beweisen, »dass es in der Familie Benn kein semitisches Blut gibt«.
Diesem Rückfall in die Barbarei setzt Klaus Mann den Begriff des denkenden, fühlenden, des erwachsenen Menschen entgegen. Wenn einer wie er über »Rasse« redete, stimmte er das »Lob der gemischten Rasse« an. Ähnlich scheint Erika Mann gedacht zu haben, als sie ihren Vater, der sich nicht durchringen konnte, öffentlich gegen das Naziregime zu sprechen, als »unmündig« bezeichnete. Sollte das nicht reichen, »so weit, so gut«, wie Erika Mann zu sagen pflegte?
Reicht nicht, findet Viola Roggenkamp, die wissen will, was jene Frauen der Familie Mann-Pringsheim beseelte, die ihr jüdisches Erbe verschwiegen und verdrängten. Pünktlich zum 100. Geburtstag der Schauspielerin, Weltreisenden, Kabarettistin, Journalistin, Widerstandskämpferin und »Statthalterin ihres Vaters auf Erden« stellt Viola Roggenkamp Erika Mann als »eine jüdische Tochter« vor. Sucht die Spuren, schreibt als deutsch-jüdische Nachgeborene über das Jüdische in der Familie des deutschen Dichters Thomas Mann. Trägt es den Manns nach, uns vor: »das eigene Jüdische, das Besondere, das Andere, das Verleugnete«.
Sie macht das glänzend; kenntnisreich, oft polemisch, immer nachdenklich blickt Viola Roggenkamp zurück auf die Geschichte von Müttern, Großmüttern und weiter auf die Feministin Hedwig Dohm, Erika Manns Urgroßmutter, auf die Berliner Salons, auf die »erträumte Idylle der gemischten Gesell-schaft«. Warum eine deutsch-jüdische Kultursymbiose im Zeichen des Vernünftigen so schrecklich scheiterte, warum das Besondere zum Heimlichen, das Heimliche zum Unheimlichen wurde, sie zeigt es an vielen Episoden, an Worten und fehlenden Worten in einer berühmten Familie, in der ein deutscher Dichter »die Krone der jüdischen Schöpfung« war. Und Erika? »Erika Mann hat nie etwas über ihre jüdische Zugehörigkeit geschrieben«, konstatiert Roggenkamp.
Vielleicht nicht direkt. Und doch gibt es wichtige Spuren in Erika Manns wahren Geschichten aus dem Dritten Reich, ihrem 1940 in den USA und England veröffentlichten Buch, das jetzt mit dem Titel Wenn die Lichter ausgehen zum ersten Mal in deutscher Sprache erschienen ist. Erika Mann hatte im Sommer 1939 im Schweizer Exil Zeitungsberichte aus Deutschland gesammelt, mit Flüchtlingen gesprochen. Dann in den USA versucht, aufklärend die Wirklichkeit der Bürger einer kleinen Stadt nachzuzeichnen. Dass sie dazu kinoartig gotische (besser: gothic) Kulissen aufstellt, oft in die Nähe von Melodram, Kitsch und Tod abrutscht, liegt wohl daran, dass sie eine unerträgliche Wirklichkeit in gerade noch erträgliche Dimensionen zurückdrängen wollte, den Glauben an den »gesunden Menschenverstand« selbst eines Gestapo-Chefs nicht aufgeben wollte.
Das jüdische Thema taucht zum ersten Mal in der Rahmengeschichte auf. Ein junger Amerikaner kommt in die Stadt, hört wie alle die Führerrede im Radio, kommentiert: »So oder so hat Ihr Führer eine Menge erreicht. Wenn er nur seine Aggressivität gegen die Außenwelt aufgeben wollte« – er schluckte herunter, was er noch sagen wollte von den Grausamkeiten gegen die Juden. Das Verschluckte kehrt in Kapitel drei als »halbjüdisches« Thema zurück, als der Fabrikant Huber der Sekretärin Anni einen Heiratsantrag macht. »Es kann nicht sein«, sagt Anni. Das Jüdische, lässt Erika Mann sie sagen, sei »das Unaussprechliche«. Denn: »Eins ist sicher: Ich kann nicht so leben, wie es die Juden müssen.«
Die verfolgten, die ausgeschlossenen Juden. Es war nicht zuletzt die Angst vor dem Absturz aus großbürgerlichen Sicherheiten, die Thomas Manns jüdische Verleger 1933 dazu bewegte, die Kritik von Klaus Manns Exilzeitschrift Die Sammlung mit Hilfe »nationaler Zellen« im Deutschen Börsenverein abzuwürgen. »Man nimmt«, kommentierte Robert Musil dieses Verhalten, »das neue Deutschland als gegeben an und sucht darin die alten Geschäfte zu machen.«
»Klaus strahlte Wärme aus, er war liebenswürdig wie sonst niemand in der Familie«, erzählte Hilde Kahn, die im amerikanischen Exil als Sekretärin von Thomas Mann arbeitete. »Erika hatte Klassenbewusstsein, sie machte deutlich, dass ich ›nur‹ die Sekretärin war. Thomas hatte immer eine hörbare Herablassung, wenn er über Juden sprach. Obwohl doch seine Frau Katia aus jüdischem Hause kam; obwohl er selbst seinen Ruhm den jüdischen Lesern zu verdanken hatte, die alle die Buddenbrooks gekauft hatten, und auch seine Freunde und seine Verleger, die waren fast alle Juden.«
Dass Katia Mann aus jüdischem Hause kam, war der jüdischen Sekretärin ihres Mannes bewusst. Frau Thomas Mann selbst pflegte das Thema als »Unsinn! Alles Unsinn!« vom Tisch zu wischen. Und die »klassenbewusste« Erika? Im März 1937 stand sie bei einer antifaschistischen Demonstration in New York vor 23000 Zuhörern und berichtete der Mutter: »Geschickter Weise sprach nur ein Jud überhaupt, im übrigen (…) ein sehr konservativer General und der Arbeiterführer Lewis und klein Erimaus.«
Wer Klaus und Erika Mann kennen lernen will, findet sie 1931 »champagnerselig und bildungslustig« an der französischen Riviera. Da reisten sie am Meer entlang, die Kinder »aus guter Familie und oh so dekadent«, schrieben sie in ihrem Reiseführer. »Sie Amateure der Zivilisation«, schimpfte Gottfried Benn Jahre später. Nun ja, Zivilisation bleibt eine inspirierende Alternative.