4-1-2003
Daniel Jonah Goldhagen: Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne.
Siedler, Berlin. 474 S.
השואה
![]()
08. Oktober 2002, 17:51
Holocaust-Forschung
Kirche lässt
neues Goldhagen-Buch verbieten
Mit einer einstweiligen Verfügung lässt das Erzbistum
München den Deutschland-Vertrieb des Buches "Die katholische Kirche und der
Holocaust" verbieten. Das neue Werk des US-Historikers Daniel J. Goldhagen
enthält eine Fotografie, die angeblich den früheren Münchner Kardinal in
Verbindung mit der SA bringt.
München/Berlin - In Goldhagens Buch ist auf Seite 237 ein Foto zu sehen, auf dem laut Bildunterschrift Münchens früherer Kardinal Michael Faulhaber durch ein Spalier von SA-Leuten marschiert. Bei der Person soll es sich jedoch keineswegs um Faulhaber handeln, teilte das Münchner Erzbistum am Dienstag mit, das per einstweiliger Verfügung beim Münchner Oberlandesgericht bewirkte, dass die Auslieferung von "Die katholische Kirche und der Holocaust - Eine Untersuchung über Schuld und Sühne" (Siedler Verlag) in Deutschland gestoppt wurde. Eine Sprecherin des Berliner Verlags wollte zunächst keine Stellungnahme abgeben, da dem Verlag die schriftliche Verfügung noch nicht vorliege.
Das Gericht folgte in seiner Entscheidung der Argumentation der Kirche, wie Gerichtssprecher Christian Ottmann am Dienstag bestätigte. Das Bistum habe glaubhaft machen können, dass die Abbildung nicht den Kardinal zeige. Solange das Buch die Bildunterschrift enthält "Auf einer NS-Kundgebung in München marschiert Michael Kardinal Faulhaber durch ein Spalier von SA-Leuten", dürfe es weder vom Verlag vertrieben werden, noch mit seiner Billigung verkauft werden, so Ottmann. Der Verlag müsse nun das Buch zurückrufen oder die entsprechenden Stellen schwärzen lassen. Ansonsten drohe dem Verlagshaus ein Strafgeld von 250.000 Euro. Dem Verlag bleibe die Entscheidung frei, die Gerichtsentscheidung anzufechten.
Das Erzbistum München erklärte, das umstrittene Foto stamme aus dem Fotoarchiv des United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Es gebe jedoch eidesstattliche Versicherungen und Vergleichs-Fotografien, die belegten, dass es sich bei der abgebildeten Person mit Sicherheit nicht um den Münchner Kardinal handle. Nach Angeben des Bistums habe sich der Verlag zunächst zum Einlenken bereit gezeigt und angekündigt, den Einwand gegen die Bildunterschrift noch einmal zu überprüfen, damit eine Korrektur auch für die internationale Ausgabe des Buches berücksichtigt werden könne. Dann hätten Verlagsanwälte jedoch erklärt, dass, selbst wenn es sich nicht um eine Abbildung von Faulhaber handeln sollte, 50 Jahre nach dem Tod des Kardinals ein entsprechender Persönlichkeitsschutz nicht mehr bestehe, der eine Klage rechtfertige.
Das Bistum hält dagegen Faulhaber für eine historische Persönlichkeit, "die noch heute in einem gewissen Sinn das Erzbistum München und Freising verkörpere", wie ein Sprecher erklärte. Das Bistum betonte zugleich, dass sich die Klage "nicht gegen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Haltung der Kirche in den Jahren des Nationalsozialismus richtet". Die katholische Kirche werde weiter ihr Archive offen halten. Die Auseinandersetzung über die Rolle der katholischen Kirche im Nationalsozialismus könne aber nur auf der Basis gesicherter Fakten geführt werden. Daher sei es notwendig gewesen, gegen die falsche Bildunterschrift zu intervenieren.
Der Politologe Daniel Jonah Goldhagen hatte vor sechs Jahren die Deutschen als "Hitlers willige Vollstrecker" gebrandmarkt. Sein gleichnamiges Buch erregte monatelang die Gemüter. In seinem neuen Buch beschuldigt der Amerikaner in einem Rundumschlag Papst und Klerus, sie trügen nicht nur Mitschuld am Holocaust, sondern seien zudem allesamt uneinsichtige Antisemiten - bis heute.

Sonnabend, 12. Oktober 2002
Von Sven Felix Kellerhoff
Erfolg macht süchtig. Vor ziemlich genau sechs Jahren, Anfang September 1996, tourte ein amerikanischer Politologe durch Deutschland und erklärte landauf, landab Tausenden Zuhörern, in zwei Fernsehdiskussionen gar Hunderttausenden Zuschauern, warum der Holocaust geschah und warum «die» Deutschen «Hitlers willige Vollstrecker» wurden. Zwar verurteilten fast alle Fachhistoriker die Thesen des bis dahin unbekannten Autoren. Doch das Publikum feierte ihn.
Derzeit reist Daniel J. Goldhagen wieder durch Deutschland. Gestern war er auf der Frankfurter Buchmesse und morgen Vormittag eröffnet er die diesjährigen Berliner Lektionen im Renaissance-Theater. Vordergründig geht es ihm darum, sein neues Buch zu bewerben. Doch eigentlich, das spürt man bei der Lektüre jeder Seite in «Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne», wünscht sich Goldhagen, seinen Triumphzug von 1996 zu wiederholen.
Ausdrücklich erklärt der 43-Jährige, der am «Minda de Gunzburg-Center for European Studies» der US-Universität Harvard arbeitet, sein neues Werk zur Fortsetzung: «Mit diesem Buch greife ich nun die moralischen Probleme auf, die im vorigen Buch zwar enthalten waren, aber nicht angesprochen wurden. Ich unterziehe sie einer generellen Prüfung, wobei ich mich empirisch auf die katholische Kirche und den Holocaust konzentriere.»
Ganz neu ist es nicht, sich Gedanken über die Rolle des Vatikans und Papst Pius' XII. während NS-Herrschaft und Zweitem Weltkrieg zu machen. Rolf Hochhuth hatte 1963 in seinem sensationellen Drama «Der Stellvertreter» die Kirche der Mitschuld am millionenfachen Judenmord angeklagt. Seither sind buchstäblich Tausende Studien zu genau diesem Thema erschienen. Trotzdem geriert sich Goldhagen als Tabubrecher, der es auf sich genommen habe, bei «einer mächtigen Institution Anstoß zu erregen und sich dadurch einen öffentlichen Tadel» einzuhandeln. Derlei ist noch verzeihlich - Klappern gehört zum Geschäft.
Unverzeihlich dagegen sind die sachlichen Mängel seiner Arbeit und der ungebremste Hang zum vorschnellen Urteil, der sich seit «Hitlers willige Vollstrecker» offenbar noch verstärkt hat. Goldhagens neue Untersuchung ist die buchgewordene Bestätigung für ein ehrwürdiges Bonmot: Je weniger man weiß, desto mehr kann man entdecken.
Im ersten Teil, «Klärung des Verhaltens» überschrieben, beschreibt der US-Sozialwissenschaftler das Handeln der katholischen Kirche zwischen 1933 und 1945. Nun gibt es darüber genügend Kritisches zu sagen - tatsächlich haben Vatikan und Papst, aber auch der Klerus in Deutschland und im besetzten Europa viel zu wenig versucht, dem Massenmord an den Juden Einhalt zu gebieten. Deshalb ist das laufende Verfahren zur Seligsprechung Pius´ XII. unpassend, sind die weiter verschlossenen vatikanischen Archive ein Skandal.
Goldhagens Darstellung ist jedoch derartig einseitig verkürzt, dass sich auch kirchenkritische Sachkenner mit Schaudern abwenden - zum Beispiel bei Sätzen wie: «Dem Staat bei der Verfolgung der Juden zu helfen war in den Augen der katholischen Geistlichen dagegen ein Akt des Patriotismus, der dem Wohl der Deutschen diente.»
Schlimmer noch sind die beiden folgenden Teile, «Beurteilung der Schuld» und «Wiedergutmachung des Schadens». Hier schwingt sich Goldhagen zum Ermittler, Ankläger und Richter in einer Person auf. Und hier kommt man endlich auch dem Kern seines geschwätzigen Buches nahe. Schuld am Antisemitismus sei nämlich eigentlich das Christentum, genauer die «christliche Bibel», das Neue Testament. Die katholische Kirche habe ein «Bibelproblem», so das Urteil.
«Die ganze Struktur der Evangelien ist antisemitisch», stellt Goldhagen fest. 450 «explizit antisemitische» Verse zählt der Autor in den vier Evangelien und der Apostelgeschichte. Richtig ist daran nur, dass die Schilderung von Jesu Verurteilung und Tod tatsächlich Grundlage für spätere judenfeindliche Interpretationen wurde. Daraus den Schluss zu ziehen, all diese Verse müssten «entfernt» werden, zeugt von einem grundlegenden Missverständnis der Buchreligion Christentum.
Doch Daniel J. Goldhagen geht noch weiter: Das Kreuz sei ein «antisemitisches Symbol und eine antisemitische Waffe». Ähnlich falsche Forschheit zeigt sich auch in anderen «Erkenntnissen», zum Beispiel, dass das Christentum eine «auf den Tod fixierte» Religion sei. In Wirklichkeit ist seine zentrale Botschaft nicht der Tod Jesu Christi, sondern die Auferstehung.
Goldhagens neues Buch, man muss es nach Jürgen Möllemanns Attacken auf Michel Friedman eigens betonen, schafft keinen neuen Antisemitismus. Nur eingefleischte Judenfeinde könnten für derart ahnungslose Assoziationsketten «die Juden» verantwortlich machen. Sehr wohl jedoch ist das Buch eine Beleidigung für jeden an Geschichte interessierten Leser.
Das allerdings dürfte Daniel J. Goldhagens Erfolg auf dem deutschen Markt so wenig verhindern wie die einstweilige Verfügung, die das Erzbistum München wegen einer falschen Bildlegende gegen das Buch erwirkt hat. Kommende Woche soll bereits die zweite Auflage ausgeliefert werden.
Daniel J. Goldhagen im Gespräch mit Hans-Joachim Meyer und Jan Roß: morgen 11.30 Uhr im Renaissance-Theater, Charlottenburg. Karten unter Tel.: 25 48 92 54
Daniel J. Goldhagen: Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne. Siedler Verlag Berlin 2002. 476 S., 24,90 Euro.
Von hier
Antisemitismus
im Katholizismus:
Moral und
Geschichte
Hierzulande scheint es besonders schwer zu sein, offen über moralische Fragen von Schuld und Sühne zu sprechen. Das zeigen die jüngsten Reaktionen auf Daniel Jonah Goldhagens Buch über die Verstrickung der katholischen Kirche in die Verbrechen des Holocaust und die Problematik einer moralischen Wiedergutmachung.
Vor etwa drei
Jahren bat Martin Peretz, Herausgeber der amerikanischen Zeitschrift The New
Republic, Daniel Goldhagen um eine ausführliche Besprechung einiger
Neuerscheinungen zu Papst Pius XII. Die Arbeit nahm überraschende Ausmaße an und
führte Goldhagen, wie er selbst zu Beginn seines Buches erklärt "in eine
gänzliche unerwartete Richtung (...), die nicht nur einen längeren Artikel
erforderte, sondern auch eine Untersuchung und Abhandlung in Buchlänge, um
unsere Frage zu beantworten: Was muss eine Religion der Liebe und Güte tun, um
sich ihrer von Hass und Unrecht geprägten Vergangenheit zu stellen und
Wiedergutmachung zu leisten?" (S.47)
Der Artikel erschien zunächst in The New Republic vom 21. Januar 2002,
das entsprechende Buch, Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine
Untersuchung über Schuld und Sühne, kam in Deutschland am 27. September
dieses Jahres in den Handel – oder auch nicht, doch davon später. Als Daniel
Goldhagen im Oktober nach Deutschland kam, um sein Buch vorzustellen, stand er
sogleich im Zentrum erhitzter Debatten, denn es ging um weit mehr als nur die
katholische Kirche. Es ging um so moralisch belastete Begriffe wie Schuld und
Sühne, und mit Moral, gar moralischen Urteilen, tun wir uns schwer in der
heutigen Zeit, vor allem in Deutschland: "Ein Politikwissenschaftler, ein
Historiker, der Moral treibt, der sich hier als Sittenwächter aufspielt,
verfehlt sein Fach. Das würde in Deutschland nicht möglich sein." So der
Kirchenhistoriker Georg Denzler in einer vom Südwestdeutschen Fernsehen am 10.
Oktober übertragenen Podiumsdiskussion mit Goldhagen. Die Historiker, zumal
Kirchenhistoriker, hadern wieder einmal gewaltig mit dem amerikanischen
Politikwissenschaftler. Goldhagen, so der Generalvorwurf, habe keine
Primärquellen studiert, habe aus zweiter Hand und fehlerhaft zitiert, seine
Aussagen seien erstens nicht neu und zweitens vom aktuellen Forschungsstand
längst überholt (kurioserweise wird in diesem Zusammenhang von kaum einem
Kritiker etwas aktuelleres angeführt als Rolf Hochhuths vor fast 40 Jahren
uraufgeführtes Theaterstück "Der Stellvertreter"). Das Buch sei ein Pamphlet,
eine Katastrophe und voller Fehler.
Manche dieser Äußerungen erinnern an die Debatten über Goldhagens vor sechs
Jahren erschienenes Buch Hitlers willige Vollstrecker. Welche Einwände
auch immer gegen Goldhagens Thesen bestanden oder bestehen mögen, Stil und
Vehemenz der Abwehr irritieren.
Im Vorwort zu
Hitlers willige Vollstrecker schrieb Goldhagen: "Ich möchte mit meiner
Beweisführung und Interpretation der Quellen deutlich machen, warum und wie der
Holocaust geschah, ja warum er überhaupt möglich werden konnte. Es geht mir
dabei um historische Erklärung, nicht um moralische Beurteilung."
Dennoch, so Goldhagen in der Einführung seines aktuellen Buchs: "Hitlers
willige Vollstrecker hatte ungewollt einen moralischen Aufruhr ausgelöst und
war ständig von einem moralischen Subtext umgeben, der die ausgiebige
schriftliche und mündliche Diskussion teilweise entgleisen ließ. (...) Dies
alles machte zwar unausgesprochen, aber doch nachdrücklich die bislang weithin
gemiedene Frage unausweichlich: Wer ist schuldig in welchem Sinne und wofür?
(...) Sollte Hitlers willige Vollstrecker dazu beitragen, die Umrisse und
Ursachen des Holocaust zu erklären und vor allem die Menschen wieder als Akteure
dabei zu begreifen, so soll dieses Buch helfen, die moralische Schuld zu klären,
die Akteure zu beurteilen und darüber nachzudenken, wie sie das von ihnen
begangene Unrecht am besten sühnen können." (S. 11ff)
Mit dieser moralischen Überprüfung der Institution Kirche, speziell der katholischen Kirche, sowie ihrer Vertreter und deren Handlungen angesichts der Judenverfolgung, will Goldhagen keine historische Gesamtdarstellung liefern, sondern vielmehr über den exemplarischen Fall hinaus allgemeingültige Lösungsvorschläge und Denkmodelle für aktuelle und zukünftige Auseinandersetzungen über Verantwortung und Wiedergutmachung entwickeln.
Es beginnt mit der Frage, wie das Verhalten Eugenio Pacellis, des späteren Papst Pius XII. vor und während der NS-Zeit zu verstehen ist. Da Pius XII. zwar ein wichtiger, aber eben doch nur ein kleiner Teil der Institution Kirche ist, dehnt Goldhagen seine Analyse auch auf Papst Pius XI. sowie die nationalen Kirchen, Bischöfe und Priester aus und kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis: "Der Antisemitismus war ein fester Bestandteil der katholischen Kirche" (S. 54). Die Belege, die Goldhagen für diese Aussage anführt, stammen zum größten Teil aus eben jenen Büchern, die er für The New Republic besprochen hatte, und auch ein großer Teil seiner Rezension selbst hat in diesen ersten Teil seines Buches Eingang gefunden. Goldhagen macht daraus durchaus kein Geheimnis, sondern verweist absolut korrekt auf den Ursprung seiner Arbeit ebenso wie auf die Quellen – primäre wie sekundäre. Der gelegentlich unterschwellig anklingende Vorwurf, er habe sich quasi unrechtmäßig die Arbeit anderer Wissenschaftler angeeignet, ist ebenso abwegig, wie der Hinweis darauf, dass er nur altbekanntes wiederhole, denn den Anspruch mit diesem Buch als erster unbekannte Fakten ans Tageslicht befördert zu haben, erhebt Goldhagen gar nicht. Ob diese Fakten allerdings einer breiteren Öffentlichkeit außerhalb der akademischen Zirkel bekannt sind, ist zu bezweifeln.
In jedem Fall
birgt Goldhagens Art der Beweisführung aus zweiter Hand gewisse Risiken, die der
Kritik eine breite Angriffsfläche bieten. Ein Beispiel, das bereits häufiger zur
Sprache kam, ist ein vertraulicher Brief, den Pacelli im April 1919 während
eines Aufenthaltes in München schrieb. Für Goldhagen ist dieses Schreiben ein
Beweis für die antisemitische Einstellung Pacellis, denn es enthält eine
Beschreibung russischer Revolutionäre, in der nicht nur "irgendeine Bemerkung"
fällt, sondern die "vielmehr einem Trommelfeuer von antisemitischen Stereotypen
und Vorwürfen gleicht" (S.63). Goldhagen zitiert diesen Brief nach John Cornwell
und dessen Buch: Pius XII. Der Papst, der geschwiegen hat, und das war
wohl ein Fehler.
In der erwähnten Diskussionsrunde des Südwestdeutschen Fernsehens führte der
Münchner Historiker Thomas Brechenmacher aus, dass sowohl Cornwell als auch
Goldhagen auf eine falsche Übersetzung zurückgegriffen hätten. Brechenbachers
korrigierende Wiedergabe vereinzelter Formulierungen aus einem längeren
Schreiben kann zwar auch nicht jeden Zweifel ausräumen, was den übrigen Inhalt
des Briefes angeht, doch ist eines nicht von der Hand zu weisen: Eine moralische
Prüfung und erst recht ein moralisches Urteil erfordern zu allererst eine
sorgfältige Beweisführung. Indem Goldhagen sich überwiegend auf die
Beschreibungen anderer verlässt, deren subjektive Einschätzungen oder
Fehleinschätzungen übernimmt, zusätzliche möglicherweise erklärende Faktoren
nicht selbst auslotet, bietet er seinen Kritikern eine höchst willkommene
Gelegenheit, die dringend nötige Diskussion über die Beteiligung der Kirchen an
der Shoah in einen Buchstabierwettbewerb zu verwandeln. Eine Gelegenheit, die,
wie es scheint, umso leidenschaftlicher genutzt wird, als man dadurch der
eigentlichen Problematik, die Goldhagen in seinem Buch zu Recht formuliert,
elegant aus dem Weg gehen kann.
Trotz mancher Fehler im Detail hat allerdings kein Kritiker ernsthaft behauptet,
dass das Gesamtbild, das Goldhagen von der Kirche, insbesondere von den
katholischen Kirchen, während der NS-Zeit zeichnet, völlig unzutreffend sei.
Selbst innerhalb der katholischen Kirche hört man seit geraumer Zeit das vage
Eingeständnis einer Mitschuld an der Verfolgung und Ermordung der europäischen
Juden. Vage insofern, als die offiziellen Erklärungen der Kirche, in ihrer
Wortwahl erstaunlich weich ausfallen, verglichen mit den sehr viel pointierteren
Verlautbarungen zu Themen wie Biotechnologie oder Abtreibung. Im pontifikalen
Schuldbekenntnis und der damit verbundenen Vergebungsbitte vom März 2000 hieß
es:
"Gott unserer Väter,
du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt,
deinen Namen zu den Völkern zu tragen:
Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller,
die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen.
Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen,
dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes."
"Leiden lassen" ist eine bemerkenswert unpräzise Umschreibung für Verfolgung und
Massenmord. Fast genau zwei Jahre zuvor, im März 1998 wurde in einer Erklärung
der Kommission für die religiösen Beziehungen zu den Juden "Wir Erinnern. Eine
Reflexion über die Shoah" zwar vorsichtig eingeräumt, dass die
nationalsozialistische Verfolgung der Juden "durch die antijüdischen Vorurteile
in den Köpfen und Herzen einiger Christen begünstigt wurde" und dass "vielleicht
das antijüdische Ressentiment die Christen weniger sensibel oder sogar
gleichgültig" machte gegenüber dem Schicksal der Juden, doch zugleich steht für
diese Kommission fest:
"Die Shoah war das Werk eines typischen modernen neuheidnischen Regimes. Sein
Antisemitismus hatte seine Wurzeln außerhalb des Christentums (...)"
Diese strikte
Unterscheidung zwischen 'antijüdischen Ressentiments', oder Antijudaismus, wie
die Vertreter der Kirche es nennen, und 'modernem neuheidnischen Antisemitismus'
läßt Goldhagen nicht gelten und verweist unter anderem auf diverse Ausgaben der
Jesuiten Zeitung Civiltà cattolica, die, gegründet 1850, gewissermaßen
als das Sprachrohr des heiligen Stuhls galt. Bereits gegen Ende des 19.
Jahrhunderts aber auch unmittelbar vor und nach Hitlers Machtergreifung finden
sich in dieser Publikation antisemitische Formulierungen, die von denen eines
Julius Streicher in seinem Hetzblatt Der Stürmer kaum zu unterscheiden
sind, wie einige Artikel belegen, die Goldhagen in Auszügen zitiert:
"1922 hieß es zum Beispiel: 'Die Welt ist krank [...] Überall werden Völker von
unerklärlichen Krämpfen geschüttelt [...]' Wer ist daran schuld? 'Die Synagoge.'
'Jüdische Eindringlinge' steckten hinter Russland und der Kommunistischen
Internationale, der größten Gefahr für die Weltordnung. 1936 – die Nürnberger
Gesetze waren erlassen, und die Juden in Deutschland standen seit Jahren unter
Beschuss – griff Civiltà cattolica auf gängige antisemitische Floskeln
der NS-Propaganda zurück und warf den Juden vor, sie seien 'einzig und allein
mit den Eigenschaften von Parasiten und Zerstörern versehen' und zögen im
Kapitalismus wie im Kommunismus die Fäden, um durch einen Zangengriff die
Weltherrschaft an sich zu reißen. 1938 erinnerte sie an 'die anhaltenden
Verfolgungen der Christen, insbesondere der katholischen Kirche, durch die Juden
und an ihre Allianz mit den Freimaurern, den Sozialisten und anderen
antichristlichen Parteien.' (...)
Außerdem schlug sie eine noch extremere Lösung der vermeintlichen Judenfrage
vor, in eigenen Worten: 'drastisch feindselig' durch 'Vernichtung' " (S. 111f)
Selbst wenn man
unterstellt, diese Artikel seien extreme Ausnahmen, fällt es schwer dem
Kirchenhistoriker Georg Denzler zu folgen, der es Goldhagen wiederholt als
"Kardinalfehler" ankreidete, nicht zwischen kirchlichem Antijudaismus und
modernem Antisemitismus unterschieden zu haben, weil der Antisemitismus, so
Denzler wörtlich "bei der Kirche nie als Lehre vertreten ist. Sie müssen mir ein
Dokument bringen, wo ein Papst oder ein Konzil die Aufforderung erhebt: 'Schlagt
die Juden tot! Wir freuen uns, wenn Ihr die Juden totschlagt.' (...) und da sehe
ich den Grundfehler des Buches, dass man hier nicht differenziert, dass man die
Judenfeindschaft gleich mit Judenvernichtung identifiziert."
Diese Aussagen verdienen Aufmerksamkeit in zweifacher Hinsicht:
Erstens: Goldhagen lehnt zwar Begriffe wie "traditionelle Judenfeindschaft" oder
"Antijudaismus" als verschleiernd bzw. als Selbstentlastungsversuch der Kirchen
ab, doch eine Gleichsetzung des kirchlichen Antisemitismus mit Judenvernichtung,
wie Denzler sie unterstellt, vollzieht er keineswegs:
"Der allgemeine Ausdruck 'eliminatorisch' sollte daher (...) nicht Töten
bedeuten, sondern den Wunsch oder das Bestreben ausdrücken, ein Gebiet auf diese
oder jene Weise von Juden und ihrem wirklichen oder eingebildeten Einfluss frei
zu machen (...).
Der Antisemitismus, den die Kirche unausgesprochen oder gar offen verbreitet
hatte, verlangte, die Juden aus der christlichen Gesellschaft zu eliminieren,
beispielsweise durch Zwangstaufe oder Ausweisung, doch ihre massenhafte
Ermordung forderten die Kirche und ihre Bischöfe nie, und oft ermahnten sie ihre
Gläubigen, keine Gewalttaten zu begehen." (S. 38, Hervorhebung im Original)
An anderer Stelle heißt es: "Bedeuten die Bemerkungen Pius' XII., dass der
Charakter seines Antisemitismus derselbe war wie der Hitlers? Natürlich nicht.
Es gibt viele Spielarten des Antisemitismus, und sie unterscheiden sich
erheblich, was ihre Grundlagen, die Natur der gegen Juden erhobenen Vorwürfe und
die Intensität angeht. Bedeutet der Antisemitismus Pius' XII., dass er
notwendigerweise jeden Aspekt der Verfolgung der Juden durch die Deutschen
billigte? Natürlich nicht." (S. 66)
Zweitens: Die
Erklärung, die Kirche habe nie verlangt "Schlagt die Juden tot!" erinnert
frappierend an jene zumal im Nachkriegs-Deutschland weit verbreitete Beschwörung
"Das haben wir nicht gewollt!" - besonders oft zu hören, nachdem gewöhnliche
Deutsche, was auch immer sie zuvor gewußt oder geahnt haben mochten, durch die
sogenannten Wochenschauen im Kino oder, auf Druck der Alliierten Besatzung,
durch eigene Anschauung gezwungen wurden, das wahre Ausmaß der Verbrechen an den
Juden zur Kenntnis zu nehmen.
"Das haben wir nicht gewollt!" - Die Betonung lag fast immer auf dem
ersten Wort. - Die Juden totschlagen, Männer, Frauen und Kinder auf so
bestialische Art und Weise ermorden, das hat man also nicht gewollt, aber
was heißt das schon? Über der Monstrosität des Massenmords in den
Vernichtungslagern, dieser tödlichen Endstufe des eliminatorischen
Antisemitismus, werden seine alltäglichen Vorläufer gerne bagatellisiert, als
hätte die seit 1933 immer weiter fortschreitende publizistische, berufliche und
soziale Ausgrenzung der Juden aus der Gesellschaft und nicht zuletzt die
stillschweigende Billigung wenn nicht gar Unterstützung dieser Maßnahmen durch
die Mehrheit der Deutschen, nichts oder doch nur wenig mit den ultimativen
Verbrechen des Holocaust zu tun.
Wer wollte das heute noch ernsthaft behaupten? Goldhagen jedenfalls nicht und
mit dieser Haltung steht er keineswegs allein. Namentlich genannt seien an
dieser Stelle zum Beispiel der Historiker Olaf Blaschke und der Theologe Stefan
Moritz. Wie Goldhagen verwies auch Blaschke 1997 in einer brillanten und auf
breiter Quellengrundlage basierenden Gesamtdarstellung über Katholizismus und
Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich auf die apologetische Absicht hinter
der Trennung von Antijudaismus und Antisemitismus: "(...) man verschleierte,
Antisemit zu sein, während man es doch war." (Blaschke: S. 31)
Goldhagens Einschätzung, " (...) dass der Antisemitismus für die kirchliche
Lehre und Theologie ebenso wie für ihre geschichtliche Entwicklung insgesamt
zentral war" (S. 253), würde
Blaschke
nach seiner Untersuchung zwar nicht unterstützen, auch spricht er sich gegen die
Kontinuitätsbehauptung eines isolierten 'Auslöschungsantisemitismus' losgelöst
vom Kontext des katholischen Diskurses und seiner Motive aus, doch der
Schlußsatz seiner Studie läßt aufhorchen:
"Und gegen die aufrichtigen Selbstbezichtiger, die auf die 'Mitschuld' der
Christen hinweisen, weil sie gegen ihre Maxime, etwa die Nächstenliebe verstoßen
hätten und die Juden aufgrund eines Defizites an christlicher Gesinnung
verachtet hätten, steht zuletzt das Resumee: Die Katholiken teilten stabile und
auch moderne antisemitische Einstellungen, nicht obwohl sie Christen waren, auch
nicht weil sie sich als bloß charakterlose Christen oder als schlechte
Katholiken erwiesen. Vielmehr waren Katholiken antisemitisch, gerade weil sie
gute Katholiken sein wollten." (Blaschke: S. 337)
Ebenfalls im
Herbst 2002 erschien das Buch des Österreichers Stefan
Moritz
mit dem Titel Grüß Gott und Heil Hitler. Katholische Kirche und
Nationalsozialismus in Österreich. Moritz hat in verschiedenen Staats- und
Diözesanarchiven zahlreiche Primärquellen ausgewertet, darunter Hirtenbriefe,
Pfarr- und Gemeindeblätter sowie viele weitere offizielle katholische
Kirchenpublikationen und er kommt zu dem Ergebnis, dass die katholische Kirche
Österreichs sich nach dem sogenannten Wiederanschluss nicht nur notgedrungen
irgendwie mit den Nationalsozialisten arrangierte, sondern dieses neue Regime in
vielen Fällen durchaus freiwillig unterstützte. Genau wie Goldhagen und Blaschke
erkennt auch Moritz in der künstlichen Abgrenzung von Antijudaismus gegen
Antisemitismus die Tendenz zur Verharmlosung. Er plädiert für den Begriff des
'katholischen Antisemitismus' und belegt anhand zahlreicher Beispiele dessen
untrennbare Verknüpfung mit der modernen Rassenideologie der Nazis, so im Fall
des Pfarrers Franz Hlawaty und seiner Gemeinde in Erdberg im Sommer 1938:
"(...) tausende Menschen waren durch die Einführung der Rassengesetze gezwungen,
in der Pfarre den Nachweis ihrer Herkunft zu erkunden. Der 'Ariernachweis' war
ein lebensnotwendiges Dokument. Für Pfarrer Franz Hlawaty war die 'Mithilfe an
der Familienforschung' nicht bloß eine lästige Pflicht oder ein bürokratischer
Aufwand, sondern in erster Linie eine wichtige 'Seelsorgearbeit', die dem
'großen Werk des blut- und artgemäßen Aufbaues' der 'Volksgemeinschaft' diente.
(...)
Wohl wissend, dass es für die Betroffenen um Leben oder Tod ging, behielt die
Kirche diese Praxis auch in den Kriegsjahren bei. Im September 1939 schloss das
Erzbischöfliche Ordinariat Wien eine Vereinbarung mit der 'Arbeitsgemeinschaft
für Sippenforschung und Sippenpflege' ab. (...) Die Präambel zu dieser
Vereinbarung erläuterte den Sinn dieses Vorhabens: 'In der Erkenntnis, dass eine
planmäßige Bearbeitung der Kirchenbücher durch Verkartung und Auswertung ihrer
Eintragungen den Bluts und Sippengedanken im Deutschen Volke wieder belebt und
stärkt und zur Schonung und Erhaltung der Kirchenbücher beiträgt ...' "(Moritz:
S. 200; der Autor zitiert nach Ausgaben des Erdberger Pfarrblatts
und des Wiener Diözesanblatts aus den Jahren 1938 und 1939)
Obwohl Stefan
Moritz' fundierte Untersuchung der österreichischen katholischen Kirche eine
Menge Zündstoff für Debatten – auch in Deutschland – enthält, werden Buch und
Autor bis jetzt bei weitem nicht so heftig attackiert wie Daniel Goldhagen. Das
ist leicht zu verstehen, denn während Moritz moralische Fragen nach Schuld und
Wiedergutmachung in seiner Darstellung weitgehend ausklammert, geht Goldhagen
den entscheidenden Schritt weiter. Er holt die Moral aus ihrem gewohnten
Versteck zwischen den Zeilen heraus und nennt Schuld und Schuldige beim Namen.
In klarer unmissverständlicher Sprache beschreibt er das moralische Versagen
einer großen Mehrheit der Kirchenvertreter und ebenso deutlich fällt auch sein
Urteil aus:
"Mit Sicherheit können wir sagen, dass eine beträchtliche Zahl von Bischöfen und
Priestern willentlich zur Vernichtung der Juden beigetragen hat. Mit Sicherheit
können wir ebenfalls sagen, dass der niederschmetternde Mangel an Mitleid mit
den Juden, den der Papst und der Klerus bekundeten, ihre Beihilfe zu wichtigen
verbrecherischen Akten, ihre Unterstützung für viele weitere Taten und die
Tragweite ihrer politischen Verantwortung und Schuld die katholische Kirche
eindeutig in die Verbrechen verwickeln, die von Deutschen, Kroaten, Litauern,
Slowaken und anderen an den Juden begangen wurden." (S. 221)
Keine Frage,
Goldhagens Sprache musste auf den Blätterwald der neblig formulierten
Publikationen katholischer Provenienz wie ein Herbststurm wirken. Entsprechend
verschnupft reagierten denn auch folgerichtig und lautstark die Vertreter der
Kirchen. Immer wieder wird hervorgehoben, wie sehr sie selbst Opfer
nationalsozialistischer Verfolgung waren, wie viele Priester von der Gestapo
verhaftet worden seien, und selten fehlt der Hinweis auf vereinzelte
Lichtgestalten wie jenen Berliner Domprobst Bernhard Lichtenberg, der, nachdem
er in seiner Kirche für Juden gebetet hatte, 1941 nach Dachau geschickt wurde,
wo er unter ungeklärten Umständen umkam.
Muss hier wirklich noch einmal betont werden, dass Goldhagen keinen
Kollektivschuld-Vorwurf gegen alle Katholiken erhebt?
Unbestritten waren die Nazis auch der Kirche gegenüber extrem feindlich
eingestellt, doch erstens kann diese Bedrohung wohl kaum auf eine Stufe gestellt
werden mit der weitaus tödlicheren Gefahr, in der sich die Juden befanden und
zweitens galt gerade für letztere in dieser Zeit mehr denn je die alte
Binsenweisheit: Der Feind meines Feindes ist nicht notwendigerweise mein Freund.
Wie groß auch immer die Bedrängnis der katholischen Kirche unter der
Nazi-Diktatur gewesen sein mag, sie führte nicht zu einer Solidarisierung mit
den Juden oder auch nur zu einem verstärkten Engagement für jüdische Mitbürger,
geschweige denn zu einem offenen Protest gegen ihre Verfolgung. Wie Moritz' und
Goldhagens Untersuchungen belegen, trat in vielen Fällen eher das Gegenteil ein.
Die lobenswerten Ausnahmen, jene christlichen Helfer der verfolgten Juden, die
Goldhagen sehr wohl und mit größter Anerkennung erwähnt, handelten fast
ausnahmslos auf eigene Initiative und ohne jeglichen Rückhalt in ihrer Kirche.
Vielleicht wäre
der Aufschrei der kirchlichen Kritiker etwas leiser ausgefallen, hätte Goldhagen
über den Schuldspruch hinaus nicht auch noch verschiedene Formen der
Wiedergutmachung diskutiert und dies ausgerechnet unter Anwendung der
moralischen Grundsätze, die die katholische Kirche selbst in ihrem Katechismus
formuliert:
"Viele Sünden fügen dem Nächsten Schaden zu. Man muss diesen, soweit möglich,
wieder gutmachen (zum Beispiel Gestohlenes zurückgeben, den Ruf dessen, den man
verleumdet hat, wiederherstellen, für Beleidigungen Genugtuung leisten). Allein
schon die Gerechtigkeit verlangt dies."
(Katechismus der katholischen Kirche, Teil II, Abschnitt 2, Kapitel 2, Artikel
4.7, § 1459; siehe auch
www.vatican.va,
wo der vollständige Text des Katechismus in englisch, italienisch, lateinisch
und spanisch nachzulesen ist)
Für Goldhagen ist jegliche Wiedergutmachung "eine moralische, weil man mit diesem Wort die Verpflichtung benennt, einen moralischen Schaden zu beheben" (S. 283) Dazu gehört neben einer materiellen vor allem eine politische und eben jene rein moralische Wiedergutmachung, die für die katholische Kirche darin bestehen müßte, sich aufrichtig zu ihrer Vergangenheit zu bekennen, sie ehrlich zu bereuen, den Antisemitismus als Ursache des Übels auszumerzen und dafür zu sorgen dass die Institution Kirche "nie wieder Anlass zur Verfolgung von Juden geben wird." (S. 296)
Die von der
Kirche ausdrücklich formulierte Pflicht, das "muss" einer Wiedergutmachung wird
heute in der Regel von niemandem mehr bestritten, nur über Ausmaß und
Durchführung der Sühne gehen die Meinungen auseinander und dies wohl am
weitesten, was die rein moralische Wiedergutmachung angeht, die Goldhagen hier
diskutiert.
Voller Empörung wirft man ihm vor, dass er die vielen positiven Entwicklungen,
nicht zuletzt nach dem zweiten vatikanischen Konzil von 1962, hartnäckig
ignoriere. Dazu ist zu sagen: Goldhagen ignoriert diese Veränderungen nicht
(siehe S. 296 ff und 352f), doch er bezeichnet sie mehrheitlich als
unzureichend. Das ist erstens nicht dasselbe und entspricht zweitens einer
Einschätzung, die auch von einigen Katholiken geteilt wird (siehe
www.jcrelations.net).
Nach wie vor hält der Vatikan in seinen Archiven eine Fülle von Akten unter
Verschluss. Nicht einmal jene katholisch-jüdische Historikerkommission, die
eigens vom Vatikan eingesetzt worden war, um dessen Rolle während der Nazi-Zeit
zu untersuchen, erhielt uneingeschränkten Zugang zu allen Dokumenten. Angeblich,
so heißt es, wolle oder müsse man die Persönlichkeitsrechte noch Lebender
schützen. Denkt innerhalb dieser Kirche auch jemand an die Persönlichkeitsrechte
der immer kleiner werdenden Zahl der Überlebenden, an ihr Recht,
die Wahrheit zu erfahren?
Wie leichtfertig selbst hohe Kirchenvertreter gelegentlich ihre Vergangenheit
schönreden, belegen auch die jüngsten Äußerungen Kardinal Lehmanns, der in einem
Interview mit der Illustrierten Stern ohne weitere Nachprüfung oder Beweise
erklärte, dass "von den etwa 900.000 Juden, die im deutschen Machtbereich
überlebt haben, 70 bis 80 Prozent ihre Rettung den verschiedenen päpstlichen
Maßnahmen und dem Einsatz der Nuntien verdanken." (Stern Nr. 40 v. 26.09.2002)
Dieser Behauptung haben einige Historiker, darunter Raul Hilberg, David Bankier
und Sergio Minerbi (der selbst als Kind in einem katholischen Kloster in Rom
versteckt wurde und überlebte) prompt und heftig widersprochen. Die Zahlen seien
massiv überzogen und nicht zu belegen.
Goldhagen liefert noch eine Reihe anderer Beispiele für die fortbestehende
Tendenz der katholischen Kirche, sich durch verschleiernde Formulierungen oder
die Überbewertung der eigenen Opferrolle zu entlasten, statt sich ihrer
Vergangenheit mit der gebotenen Aufrichtigkeit und Reue zu stellen.
Alleine was diese zuletztgenannten Aspekte moralischer Wiedergutmachung angeht,
hätte die Kirche noch einen weiten Weg vor sich, doch um den Antisemitismus
auszumerzen und zu gewährleisten, dass die Kirche nie wieder Anlass zu einer
Verfolgung der Juden bietet, müsse sie, laut Goldhagen, sowohl ihre religiösen
Schriften als auch ihr theologisches Selbstverständnis und ihre
politisch-institutionelle Struktur einer kritischen Revision unterziehen.
In der Phantasie einiger Kritiker mutierte Goldhagen damit endgültig zum
Katholikenfresser. Entsprechend irrational fielen denn auch manche Kommentare
aus, wonach Goldhagen angeblich verlange, die Bibel umzuschreiben, den Vatikan
aufzulösen und alles aufzugeben, was den katholischen Glauben ausmache. Den
peinlichen Höhepunkt dieser künstlichen Hysterie lieferte Prof. Hans Maier,
ehemaliger bayerischer Kultusminister, der bei einer Podiumsdiskussion in
München allen Ernstes fragte. "Müssen wir jetzt alle Juden werden?"
Das geht nun allerdings so weit an Goldhagens Aussagen vorbei, dass man sich
fragt, ob von der jüngst diagnostizierten Leseschwäche unter deutschen
Schulkindern nicht noch ganz andere Altersgruppen betroffen sind.
Nicht die Abschaffung der katholischen Kirche oder Lehre wird verlangt, sondern
Reformen. Nicht die Aufgabe des katholischen Glaubens wird gefordert, sondern
seine Erweiterung in der Toleranz gegenüber anderen Religionen. Und was die
Bibel angeht, sagt Goldhagen: "Um nicht missverstanden zu werden: Ich sage
nicht, dass die katholische Kirche ihre Bibel verändern muss." (S. 363)
Goldhagen ist
keineswegs so naiv, dass er sich anmaßt einen annähernd 2000 Jahre alten
heiligen Text mal eben korrigieren zu können wie einen schlechten Schulaufsatz,
doch er verweist zu Recht auf ein nach wie vor bestehendes Problem: Es gibt im
Neuen Testament eine Vielzahl explizit antisemitischer Passagen und
Formulierungen, die dem christlichen Europa über Jahrhunderte den Vorwand
geliefert haben, Juden als Gottesmörder, Schlangenbrut oder Kinder des Satans zu
stigmatisieren, auszugrenzen, zu verfolgen und zu ermorden. Auch heute noch sind
diese Begrifflichkeiten geeignet, Argwohn und Vorurteile gegenüber Juden zu
fördern (Wer das nicht glauben will, den könnte eine Recherche auf
rechtsextremistischen Internetseiten schnell eines besseren belehren).
Die aus der katholischen Lehre selbst ableitbaren Forderungen bezüglich
moralischer Wiedergutmachung (den Ruf dessen, den man verleumdet hat,
wiederherstellen, für Beleidigungen Genugtuung leisten) besagen, "dass man es
nicht zulassen darf, dass das Übel des Antisemitismus, zu dem unbedingt auch der
in der christlichen Bibel enthaltene und sie beseelende Antisemitismus zu zählen
ist, im Herzen eines Menschen Wurzeln schlägt. Doch die christliche Bibel ist
ein heiliger Text, in den man, da er Gottes Wort ist, nach Überzeugung von
Katholiken und anderen Christen nicht eingreifen darf. Was soll man tun? Was
kann man tun?" (S. 355)
Goldhagen diskutiert verschiedene Lösungsmöglichkeiten von einer
Neu-Kommentierung bis zu einer konsequenten Entfernung aller explizit
antisemitischen Formulierungen und Passagen des Neuen Testaments. So radikal und
verstörend vor allem letztgenannte Überlegung klingen mag, Goldhagen ist nicht
so anmaßend zu behaupten, er habe die Lösung bereits gefunden. Vielmehr erklärt
er:
"Bei unseren Überlegungen müssen (...) drei Dinge bedacht werden: (1) Es gibt
keine offenkundige und einfache Lösung für dieses Problem; (2) sich den
problematischen Aspekten der christlichen Bibel zuzuwenden, ist nicht einmal
ausschließlich Sache der katholischen Kirche, weil der Text auch von anderen
christlichen Kirchen und Christen für heilig erachtet wird; und (3) die Lösung
muss, jedenfalls für Katholiken, am Ende aus dem Inneren der Kirche selbst
kommen." (S. 364)
Was Goldhagen
hier nahe legt, ist eine Art erweitertes vatikanisches Konzil unter Beteiligung
aller Christen, sowie Vertretern der jüdischen Religion, mit dem Ziel,
gemeinsam zu einer für alle akzeptablen Übereinkunft zu kommen, wie die
christliche Bibel zu ergänzen, neu zu kommentieren bzw. zu interpretieren sei,
damit sie keine antisemitischen Ressentiments mehr produziert oder fördert.
Ginge es nach den Kirchenvertretern, besteht in dieser Hinsicht allerdings wenig
Handlungsbedarf. Immer wieder wird Goldhagen vorgehalten, die jüngste
Entwicklung in der Erörterung dieser theologischen Probleme nicht zur Kenntnis
genommen zu haben. Die geforderten Veränderungen in Sachen Bibelauslegung seien
längst gängige Praxis.
Gewiss, es gibt gute theologische Bücher und der katholische Religionsunterricht wird heute von einer Reihe progressiver Pädagogen und mit modernen Lehrmitteln gestaltet. Dennoch fragt man sich, warum die in Deutschland derzeit aktuelle Schulbibel, eine explizit "für den Schulgebrauch zugelassene" Einheitsübersetzung des Alten und Neuen Testaments, erschienen im Herder Verlag, noch aus dem Jahr 1979 [!] stammt und seitdem, abgesehen von einer neuen Einbandgestaltung, nicht verändert wurde. Und wie zur Bestätigung Goldhagens findet man ebenda im Evangelium nach Matthäus unter 27,24-26 jene Stelle, an der Pilatus seine Hände in Unschuld wäscht, und das ganze jüdische Volk ruft: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!" Der auf der selben Seite mitgelieferte Kommentar dazu lautet: "Das Volk gibt durch die Selbstverwünschung indirekt seine Verantwortung zu." – Was liegt nach dieser Erläuterung näher als die Annahme: 'Irgendwie sind also doch die Juden schuld!'? Auch zu anderen antisemitischen Passagen, von denen Goldhagen einige in seinem Buch zitiert, findet sich in dieser Schulbibel kein erhellender Kommentar. Kann oder besser darf man sich allein darauf verlassen, dass progressive Religionslehrer diese unhistorischen Falschdarstellungen eines ganzen Volkes durch eigene Kommentare oder Sekundärliteratur korrigieren? Diese Schulbibeln – zugelassen 17 Jahre nach dem zweiten vatikanischen Konzil und seit mehr als 20 Jahren nicht überarbeitet – werden bis heute an allen deutschen Schulen benutzt; angesichts dieser Tatsache kann man sich nur wundern, woher einige der Kirchenvertreter die Selbstgewissheit nehmen, Goldhagen vorzuwerfen, er sei nicht auf dem neusten Stand. Ist es nicht überaus berechtigt, auf die schwerwiegende Problematik dieser tatsächlich verleumderischen Bibelstellen hinzuweisen? Oder gelten die Regeln des katholischen Katechismus – den Ruf dessen wiederherstellen, den man verleumdet hat – nur dann, wenn die Geschädigten Katholiken sind?
Erinnert sei zum
Beispiel an das Foto mit der falschen Bildunterschrift. Der hohe katholische
Würdenträger, der auf besagtem Bild durch ein Spalier von SA-Leuten schreitet,
ist nicht Kardinal Faulhaber, wie es in der Bildlegende zunächst hieß, und so
erwirkte das erzbischöfliche Ordinariat München umgehend eine
gerichtliche Verfügung,
die den Vertrieb des Goldhagen-Buches solange unterbinden sollte, bis die
strittige Zeile korrigiert wäre. Kardinal Lehmann erklärte in einem kurzen
Fernseh-Statement: "(...) es ist natürlich misslich, wenn so etwas dann
ausgerechnet einem Mann wie dem Kardinal Faulhaber angelastet wird, der einer
der mutigsten Leute war in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus."
(12.10.2002, 3sat, Kulturzeit extra) – Über die Rolle Kardinal Faulhabers
während der NS-Zeit gehen die Meinungen weit auseinander, aber nehmen wir zu
seinen Gunsten einmal das beste an und sagen, er wäre tatsächlich der mutige
Mann gewesen, den Kardinal Lehmann in ihm sieht.
Dass sich in Bildlegenden mitunter Fehler einschleichen, ist nicht neu und
menschlich verständlich. Ebenso verständlich ist andererseits, dass die Kirche
einen vermeintlich aufrichtigen Kardinal nicht in die Nähe der Nazis gerückt
sehen will. Dies, so die Kirche, sei eine Verleumdung und damit eine Verletzung
des Persönlichkeitsrechts, das auch noch für Verstorbene gelte. Wie gesagt: ein
solcher Einwand ist grundsätzlich berechtigt und verständlich. – Dennoch, mit
Blick auf die erwähnten Schulbibeln erscheint die zur Schau getragene Empörung,
mit der das Münchner Erzbistum sein Recht einklagte, reichlich scheinheilig, und
es drängt sich mit Matthäus 7,3 die Frage auf: "Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem [eigenen] Auge bemerkst Du
nicht?"
Warum tritt die Kirche für das Persönlichkeitsrecht der Juden, für deren unbestreitbares Recht, in der christlichen Bibel nicht länger falsch und verleumderisch dargestellt zu werden, nicht mindestens mit dem selben Engagement ein, wie andererseits für das Persönlichkeitsrecht ihrer eigenen Glaubensbrüder?
Die Bildunterschrift in Daniel Goldhagens Buch wurde korrigiert. Das ist ein relativ einfacher Vorgang bei einem herkömmlichen Buch. Schließlich ist es nicht das Wort Gottes – Allerdings: das war das Neue Testament seinem Ursprung nach auch nicht. Die Autoren dieser Schriften waren Menschen, und wie alle Menschen waren sie nicht frei von Fehlern und Irrtümern. Dies zuzugeben und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, ist nur für die ein Problem, die unbeirrbar an ihrer eigenen Unfehlbarkeit festhalten, und das trifft insbesondere auf die katholische Kirche und ihr traditionelles Selbstverständnis zu.
So gesehen erscheint die eingangs erwähnte Vehemenz, mit der vor allem katholische Kirchenvertreter und Historiker Autor und Buch attackieren, zumindest psychologisch nachvollziehbar. Die interessierte Öffentlichkeit steht dieser Art von Kritik jedoch eher skeptisch gegenüber, und in Erinnerung an ähnliche Töne in den Debatten über Hitlers willige Vollstrecker dürfte sich mancher sagen: Selber lesen wäre auch eine Möglichkeit. Selbst wenn die eine oder andere Detailkritik berechtigt sein mag, und auch wenn man Goldhagens Überlegungen nicht in jeder Hinsicht folgen will oder kann, bleibt festzuhalten, dass die überaus berechtigten Fragen nach Schuld und moralischer Wiedergutmachung bisher wohl selten so deutlich und radikal formuliert wurden wie von Daniel Goldhagen. Die Antworten, besonders jene der katholischen Kirche, stehen in vielen Fällen noch aus.
Franziska Werners – haGalil 03.11.2002
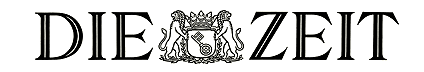
ZEITGESCHICHTE
Jan Ross
Kirche und Holocaust, das ist ein großes Thema seit dem Stellvertreter, Rolf Hochhuths Theatercoup von 1963, mit dem er Papst PiusXII. für sein Schweigen zur Judenvernichtung anprangerte. Hat die höchste, jedenfalls die herausgehobenste moralische Instanz des Abendlands im Angesicht des schlimmsten Geschichtsverbrechens versagt – und wenn ja, warum? Sie hat, erklärt Daniel Goldhagen, und sie hat es deshalb, weil der Antisemitismus mit der katholischen Lehre, wenn nicht mit dem Wesen des Christentums unauflöslich verwachsen ist. Seinem halb genialischen, halb bizarren Erstling Hitlers willige Vollstrecker, dem Gerichtstag über die Deutschen der Nazizeit, lässt Goldhagen nun eine Generalabrechnung mit der Kirche und ihrer Komplizenschaft mit dem Massenmord folgen.
Der Furor der Anklage ist ungewöhnlich, die vorgebrachten Tatsachen und Argumente dagegen kann man neu oder originell nicht nennen. Zur Politik des Heiligen Stuhls im Zweiten Weltkrieg ist gerade jüngst viel geforscht und publiziert worden, kritisch wie apologetisch, ebenso zur päpstlichen und katholischen Sicht auf das Judentum seit dem 19. Jahrhundert. Goldhagen hat keine eigenen Quellenstudien getrieben, sondern diese Untersuchungen ausgewertet; die italienischen allerdings nicht, sie scheinen ihm sprachlich unzugänglich zu sein. Der Verzicht auf Archivarbeit ist im Übrigen bei der besonderen Natur und Anlage des Buchs keine Schande. Goldhagen will nicht darstellen, sondern plädieren, genauer: Er will an einem Modellfall die Legitimität moralischen Wertens und Richtens in der Geschichtsschreibung darlegen. Freilich gibt ein Autor, der über Dutzende von Seiten auf seinem Anspruch besteht, Urteile über Gut und Böse zu fällen, eine etwas eigentümliche Figur ab. Im Buch herrscht ein ausgeprägtes Klima der Rechthaberei.
Warum Pius XII. zum Judenmord schwieg
Was die Sache angeht, so war PiusXII., 1939 gewählt, für den Nationalsozialismus in der Tat nicht jener eindrucksvolle Gegenspieler, den Johannes PaulII. Jahrzehnte später für den Kommunismus abgegeben hat. Goldhagen gibt zu, dass der Papst „kein Bewunderer Hitlers“ war (was zu schwach gesagt ist) und dass er 1940 Kontakte zwischen den Briten und der deutschen Opposition zu vermitteln suchte. Aber die geradezu apokalyptische Herausforderung durch das Satanswerk des Nazitums hat PiusXII. wirklich nicht begriffen oder nicht wahrhaben wollen. Seine Hauptsorge war weniger der Judenmord als der Krieg, und da hielt er, wohl um illusionärer Vermittlungshoffnungen willen, Neutralität für klüger als Parteinahme. Ebenso mochte er auch wirklich das Schweigen für klüger halten als das Reden und ehrlich meinen, dass ein lauter päpstlicher Protest gegen die Deportationen die Mordlust der Nazis nur noch mehr angestachelt hätte. Nur konnte man, wenigstens im Vatikan, schon damals wissen, dass hier nichts mehr anzustacheln und umgekehrt nichts „Schlimmeres“ zu verhüten war, weil das Schlimmste jeden Tag geschah.
Auch im katholischen Milieu wucherte der Antisemitismus
Goldhagen richtet den Blick über den zaudernden und halbherzigen Papst hinaus auf die katholischen Bischöfe, Geistlichen und Gläubigen in ganz Europa. Er findet, wiederum nicht als Erster, ein breites Spektrum des Stillhaltens und der Anpassung, bis hin zu eifriger und überzeugter Kollaboration wie im Fall des slowakischen Priesterfaschisten Tiso. Widerspruch gab es auch: Das bayerische Kirchenvolk verteidigte die Kreuze im Klassenzimmer, und Bischof Galen, der „Löwe von Münster“, predigte gegen die Euthanasie an Geisteskranken. Nur für die Juden wurde kaum je öffentlich die Stimme erhoben, und wenn es doch einer tat, wie der Berliner Dompropst Lichtenberg, dann jedenfalls nicht auf Initiative und kaum auch nur mit Deckung der bischöflichen oder kurialen Hierarchie.
So wahr und schändlich das ist, so richtig ist es auch, wenn Goldhagen von einem katholischen Antisemitismus spricht. Die Fürsprecher der Kirche machen es sich zu leicht, wenn sie zwar die Existenz christlicher Judenfeindschaft zugeben, aber einen klaren Trennstrich zum Rassenhass der Nazis ziehen wollen. Der kirchliche Antijudaismus, so die Verteidigungslinie, sei rein religiös begründet gewesen, mit der Taufe war der Makel abgewaschen; dagegen habe erst eine unchristliche, neuheidnische Moderne das Judentum als quasi-biologische Eigenschaft definiert, als vernichtungswürdige Untermenschlichkeit. In Wahrheit lassen sich auch im Kirchenmilieu, besonders in der katholischen Publizistik des späten 19. Jahrhunderts, die Klischees des modernen Antisemitismus finden, von der kosmopolitischen Wurzellosigkeit der Juden bis zu Verschwörungstheorien nach Art der Protokolle der Weisen von Zion. Goldhagen verfolgt den christlichen Hass auf die Juden als Volk zurück über die Geschichte der Ghettoisierung und der Pogrome bis zum Vorwurf einer jüdischen Kollektivschuld an der Kreuzigung Jesu, den schon die Evangelien erheben.
Das kirchliche Versagen vor dem Holocaust ist also eine Tatsache, und die Tradition von Judenfeindschaft im Christentum ist es auch. Aber besteht zwischen beidem wirklich der Kausalzusammenhang, den Goldhagen unterstellt? Dass PiusXII. nicht energischer gegen die Nazis auftrat, dürfte viel mehr mit seinem übervorsichtigen Diplomatennaturell zu tun haben als mit irgendwelchen antisemitischen Affekten oder Prägungen. Das Taktieren und das erhabene In-der-Schwebe-Lassen passte zu seinem Wesen, zu seiner Schulung im auswärtigen Dienst der Kurie und zu seinem Rollenverständnis als weltentrückter Nachfolger Petri; er war nicht jener Prophet, den die Kirche und die Welt in diesem historischen Augenblick bitter nötig gehabt hätten. Was Goldhagen als Beleg für die Vorurteile des Papstes anführt, einen Bericht aus seiner Zeit als Nuntius in München 1919, in dem er sich über die „jüdisch-bolschewistischen“ Räterevolutionäre alteriert – das mag man antisemitisch nennen, aber es hat gewiss nichts spezifisch Christliches oder „Mittelalterliches“ an sich, nichts von uraltem Hass auf das Volk der „Gottesmörder“; es klingt eher nach jener bürgerlichen Chaosangst, wie sie zur selben Zeit und am selben Gegenstand etwa auch bei Thomas Mann anzutreffen ist.
Für Zwischentöne und Ambivalenzen ist kein Platz
Goldhagen selbst weist darauf hin, dass das Verhalten der Katholiken und ihrer Hirten zu den Juden in aller Regel die Muster ihrer nationalen Umgebung spiegelte: Die Kirche war antisemitisch, wo das Volk es war, sie blieb immun oder zumindest weniger anfällig, wo die Judenfeindschaft nicht zur Landessitte gehörte. Das sollte davor warnen, die Bedeutung des Christentums in dieser Frage zu überschätzen. Es entlastet die Kirche nicht; vielmehr besteht, recht verstanden, darin der eigentliche Skandal: dass Glauben oder Unglauben hier einen so bedrückend geringen Unterschied machten, dass die Religion offenbar nichts gewesen ist, was auf der Waagschale der Moral und der Humanität ausschlaggebend ins Gewicht gefallen wäre. Es stimmt schon, dass Jahrhunderte theologisch begründeter Ausgrenzung und Demütigung von Juden dabei geholfen haben, den Boden für den Holocaust zu bereiten. Aber ob es 1941, 1942 oder 1943 nicht doch eher Feigheit als Religionsvorurteile gewesen sind, die Millionen von Christen dazu gebracht haben, ihre jüdischen Mitbürger im Stich zu lassen?
Für solche Zwischentöne und Ambivalenzen fehlt Goldhagen der Sinn. Wie breit sein Pinsel und wie schwer seine Keule sind, zeigt sich besonders krass, wenn er auf Theologisches zu sprechen kommt, auf Dogma und Bibel. Das Christentum hat sich, seit Paulus, in Abgrenzung und Widerspruch zum Judentum entwickelt; es gibt zwischen den beiden Religionen einen Gegensatz, der für die jüngere von ihnen konstitutiv ist: Christen glauben, dass Jesus der Messias war, und Juden glauben es nicht. Goldhagen neigt nun dazu, in der Manifestation von Unterschieden oder gar Konkurrenz zum Judentum bereits Antisemitismus zu vermuten. So erörtert er allen Ernstes ausführlich das Für und Wider einer Säuberung des Neuen Testaments von anstößigen Stellen, und ganz sicher ist er sich, dass die katholische Kirche ihren absoluten Wahrheitsanspruch aufgeben müsse (auch wenn sie heute weit davon entfernt ist, ihre Wahrheit anderen aufzuzwingen). Wenn schon nicht bei der eher kuriosen Idee einer Bibelrevision, so dürfte ihm bei dieser Dogmenkritik die Zustimmung vieler Leser gewiss sein. Interessanter wäre freilich die Frage, wie Religionen unbeschadet ihrer fortbestehenden Differenzen miteinander auskommen können. Denn nicht die Einebnung, sondern das Ertragen von Unterschieden ist Toleranz.
|
Daniel Jonah Goldhagen
:
Die
katholische Kirche und der Holocaust
Eine Untersuchung über Schuld und Sühne; aus dem Englischen von Friedrich
Griese; Siedler Verlag, Berlin 2002; |

5-10-2002
Von Gerhard Besier
In seinem jüngsten Buch "Die katholische Kirche und der Holocaust" nimmt Daniel J. Goldhagen nicht nur Papst Pius XII., sondern die katholische Kirche insgesamt ins Visier. Der Katholizismus wiederum steht exemplarisch für das Christentum als Ganzes. Die Kriterien für seine moralische Prüfung - im konkreten Fall des Verhaltens der katholischen Kirche gegenüber den Juden - entnimmt Goldhagen zum einen aus ihrer Lehre selbst, zum anderen beruft er sich auf allgemeingültige moralische Grundsätze.
Die Anklage gegen Pius XII. beginnt Goldhagen mit seiner Entscheidung, den Entwurf der "Enzyklika Humani Generis Unitas" seines Vorgängers 1939 nicht zu veröffentlichen. Er hält Pius XII. für einen unverbesserlichen Antisemiten. Negative Stereotypen des Jüdischen, die er aus seinem Munde anführt, waren in Europa und Nordamerika freilich gang und gäbe. Selbst Emigranten und mit Juden verwandtschaftlich eng verbundene Intellektuelle (das prominenteste Beispiel ist Thomas Mann) waren nicht frei davon.
Insgesamt spielt allerdings der angebliche Antisemitismus Pius XII. in Goldhagens Argumentation nur eine untergeordnete Rolle. Er hält die Konzentration auf den Papst geradezu für einen Trick, um die katholische Kirche zu entlasten. Er will "den Beitrag der katholischen Kirche zu der von Deutschland angeführten Verfolgung und Vernichtung der Juden" herausstellen.
Dass auch die Kirche selbst unter der ständigen Vernichtungsdrohung des NS-Regimes stand, Priester einen hohen Blutzoll zahlten und die Kirche für Katholiken jüdischer Herkunft Beachtliches leistete, hält Goldhagen alles in allem für aufgebauscht und verlogen. Die Kirche "erfindet falsche christliche Märtyrer, falsche christliche Helden und falsche christliche Opfer, und sie erklärt jüdisches Leid zu ihrem eigenen"; man stelle die Sache "so dar, als sei die Kirche zusammen mit den Juden zum Opfer des Nationalsozialismus geworden. Katholiken kommen nicht als Verfolger der Juden vor, sondern werden fälschlich als deren Helfer gefeiert. Die Kirche stellt sich als ein Opfer des Nationalsozialismus dar, das sie in Wirklichkeit nicht war".
Bei seiner Ursachenforschung und der Frage nach den Maßstäben zur Beurteilung des Verhaltens der katholischen Kirche verlässt Goldhagen das Feld der historisch-politischen Analyse und betritt den Raum des Religiösen. Sein Vorwurf an die katholische Kirche lautet, sie habe als "universale moralische Institution" versagt. Sie sei an den Opfern wie an den Tätern schuldig geworden, indem sie nicht nur "normale, von vielen Menschen geteilte moralische Maßstäbe" missachtet habe, sondern auch ihre eigenen: Die Massenmörder hätten sich einer Todsünde schuldig gemacht und seien ihres Seelenheils verlustig gegangen - ohne dass die Kirche sie vor dieser Konsequenz gewarnt habe.
Will Goldhagen in einen moralischen Wettstreit zwischen rivalisierenden Religionen eintreten? Er möchte jedenfalls eine Art Tribunal über das Christentum veranstalten - mit Beurteilungskriterien, Beweiserhebung, Urteilsspruch und "Wiedergutmachung des Schadens". Ihm geht es um die Rehabilitierung und die Wiederaufrichtung des von den Christen abgetanen mosaischen "Gesetzes" und schließlich um die Feststellung, welche Christen überhaupt noch als "Gerechte unter den Völkern" gelten dürfen.
Vor dem Hintergrund der eigenen religiösen Tradition vermag er in der christlichen Erbsünden- und Rechtfertigungslehre vermutlich keine tieferen anthropologischen Einsichten, sondern wohl nur heuchlerische Immunisierungsstrategien zu sehen. Dagegen hebt er die Willensfreiheit des Menschen besonders hervor und betont die Übereinstimmung der katholischen Lehre mit dieser Prämisse. Das Ganze wird als epochaler Revisionsprozess inszeniert, der mit dem Beweis enden soll, dass "die außergerichtliche, de facto strafrechtliche Verurteilung der Juden durch die Deutschen, Slowaken, Kroaten und andere" ein gigantischer Justizirrtum war.
Nach seiner Beweiserhebung kommt Goldhagen zu dem Ergebnis, dass die katholische Kirche und ihr Personal "während des Holocaust insgesamt gefehlt" hätten, weil sie die Juden "für böse und schädlich hielten" und darum gegen ihre "ernsthafte Bestrafung" nichts einzuwenden hatten, obwohl "die Juden vollkommen unschuldig waren". Aber damit nicht genug: Aus den Grundsätzen der kirchlichen Lehre folge, dass das "Verbreiten von Vorurteilen oder Hass, einschließlich des Antisemitismus, eine Todsünde" sei.
Durch ihre Unterstützung verbrecherischer Maßnahmen und teilweise sogar durch ihre Beteiligung an diesen, hätten die Kirchen schwere moralische, ja in einigen Fällen sogar strafrechtlich relevante Schuld auf sich geladen. Statt nach Kriegsende die Bestrafung der Schuldigen zu fordern, habe der Vatikan mit dafür gesorgt, dass sich die Mörder den Justizbehörden der Alliierten hätten entziehen können.
Als "Wiedergutmachung des Schadens" stellt sich Goldhagen - neben energischer historischer Forschung und Gedenkarbeit - nicht weniger vor als eine weit gehende Revision der katholischen Lehre. Danach wäre die katholische Kirche nicht mehr sie selbst, sondern eine pluralistisch orientierte, ökumenische Humanitätsreligion ohne einzigartigen Anspruch auf Heilsuniversalität. Empört wendet sich Goldhagen gegen den nach wie vor bestehenden Missionsanspruch der römisch-katholischen Kirche, der sich allerdings, was er unerwähnt lässt, nicht nur auf die Juden, sondern auf alle Menschen bezieht - sogar Christen außerhalb der römisch-katholischen Kirche.
Für den Verfasser sind die auf Jesu Tod "fixierte" Religion, ihr "fehlgeleiteter Kult des Kreuzes von der Milvischen Brücke bis Auschwitz" und prononcierte Aussagen der "christlichen Bibel" (wie er das Neue Testament nennt) die eigentlichen Ursachen für den 2000 Jahre währenden Antisemitismus. Dass auch die Thora die Aufforderung zum Genozid kennt und Israel sich während seiner, allerdings kurzen, politischen Machtentfaltung tausend Jahre vor Christi Geburt kaum anders verhielt als andere Imperien im Vorderen Orient, scheint Goldhagen nicht bewusst zu sein.
Goldhagens theologischer Kampf gilt vor allem der "Substitutionstheorie", der Überzeugung des Christentums, dass der "alte Bund" durch den Bund des Neuen Testamentes grundsätzlich überboten worden sei. Dabei hält er es anscheinend für möglich, mithilfe historischer Beweisführungen religiöse Lehrsätze zu falsifizieren. Den Anspruch der katholischen Kirche, von den Juden die Anerkennung Jesu Christi als Sohn Gottes zu erwarten, betrachtet er als unerhörte Respektlosigkeit gegenüber dem mosaischen Glauben.
Bei aller Anerkennung der katholischen Lehrrevisionen im Blick auf das Judentum seit dem Zweiten Vatikanum erwartet er sehr viel mehr: eine "Reinigung" der Liturgie und des Neuen Testaments von antisemitisch zu verstehenden Passagen. "Wenn die katholische Kirche eine moralische Institution werden soll, muss sie aufhören, eine politische Institution zu sein." Als vorrangige Aufgabe der katholischen Kirche betrachtet es Goldhagen, wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Antisemitismus zu ergreifen.
Darüber hinaus gilt seine Kritik allen "vormodernen" Formen von Religion. "Viele Religionen sind ethnozentrisch, feiern die eigene Gruppe, sind unduldsam gegen andere. Religionen neigen zur Intoleranz gegen andere - das hat sich beim Katholizismus, beim Hinduismus, beim Islam, beim Judentum und bei vielen Formen des Protestantismus gezeigt." Um diesen in allen Religionen schlummernden Gefahren zu begegnen, plädiert er - neben der politischen Entmachtung - für eine Liberalisierung, Pluralisierung und Demokratisierung der religiösen Institutionen und ihrer Lehren.
Lassen sich die dramatischen Folgen religiöser und ethnischer Vorurteile so ahnden und ihre Ursachen so beseitigen? Dass eine Rationalisierung von Vorurteilen, ihre Transformation in objektive "Schuldtitel", schon in sich ein paradoxes Unterfangen ist, dürfte jedem mit sozialwissenschaftlichen Arbeitsweisen einigermaßen vertrauten Historiker unmittelbar einleuchten. Insofern trägt der methodische Zugriff das Unternehmen nicht. Schon gegen Goldhagens früheres Buch "Hitlers willige Vollstrecker" (1996) hatte der Historiker Christopher R. Browning eingewandt, dass der Verfasser nahezu alle apologetischen Aussagen der seinerzeit behandelten Tätergruppe nicht wirklich gelten ließ.
Dieses Eindrucks kann man sich auch im vorliegenden Falle nicht erwehren. "Eine Methode, die kaum etwas anderes kann als die Hypothese bestätigen, die sie eigentlich überprüfen sollte, sollte nicht mit dem Anspruch strenger Sozialwissenschaft auftreten."
![]()
Süddeutsche Zeitung, 10.10.2002: Ein Skandal, der die Auflage steigert
Das
Erzbischöfliche Ordinariat lässt Goldhagens neues Buch verbieten – Historiker
kritisieren die schlampige Arbeitsweise des Autors
Von Christian Mayer
Zwei Dinge kann man schon jetzt über Daniel
Goldhagens neues Buch sagen. Erstens: „Die katholische Kirche und der Holocaust.
Eine Untersuchung über Schuld und Sühne“ wird wohl ähnlich wie sein Erstling
„Hitlers willige Vollstrecker“ ein Bestseller. Die erste Auflage mit 30000
Exemplaren ist bereits an die Buchhändler ausgeliefert, und die Lesereise des
Harvard-Politologen, die ihn am 16. Oktober auch ins Münchner Literaturhaus
führt, dürfte das Interesse weiter anheizen. Zweitens: Der 500-Seiten-Band wird
bei den Fachhistorikern auf ähnlich heftige Ablehnung stoßen wie sein voriges
Werk. Goldhagen schreibe nicht als Historiker, sondern „wie ein Anwalt oder
Ankläger in einem Wiedergutmachungsprozess“, urteilt der
Geschichtswissenschaftler Konrad Repgen.
Der schärfste Einwand gegen Goldhagen, der in seinem Buch die Haltung der
katholischen Kirche zur Judenverfolgung unter die Lupe nimmt, kommt indes aus
München. Genauer gesagt aus der Kardinal-Faulhaber-Straße, dem Sitz des
Erzbischöflichen Sekretariats. Die Kirchenbehörde hatte am Dienstag bei der
Zivilkammer des Landgerichts München I eine einstweilige Verfügung gegen das
Buch erwirkt. Eine ungewöhnliche Maßnahme, die das Buch in die Schlagzeilen
katapultierte. Das Erzbistum will Vertrieb und Verkauf des Werkes verhindern.
Grund ist ein Foto, auf dem angeblich der Münchner Kardinal Faulhaber zu sehen
sein soll. „Auf einer NS-Kundgebung in München marschiert Michael Kardinal
Faulhaber durch ein Spalier von SA-Leuten“, lautet die Bildunterschrift. Und die
ist falsch, wie gestern der Berliner Siedler-Verlag einräumen musste, bei dem
das Buch erschienen ist: Auf dem Foto ist nachweislich nicht Faulhaber zu sehen.
„Wir waren nicht auf einen Rechtsstreit aus, aber der Verlag hat uns keine Wahl
gelassen. Wir mussten handeln, weil davon auszugehen ist, dass die falsche
Bildunterschrift international verbreitet wird“, begründet Ordinariats- Sprecher
Winfried Röhmel das Vorgehen. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung hatte es
eine erregte Auseinandersetzung zwischen Verlag und Ordinariat über die
Verwendung des Fotos gegeben; doch bei Siedler siegten am Ende kaufmännische
Erwägungen über wissenschaftliche Zweifel. „Das Ordinariat hat uns keine
schlüssigen Beweise vorgelegt, dass auf dem Bild eine andere Person als
Faulhaber dargestellt ist“, sagt Siedler-Justiziar Rainer Dresen. Eine
Überprüfung hielt man nicht für erforderlich, da das Foto aus dem Archiv des
renommierten Holocaust Memorial Museum in Washington stamme. Erst gestern zeigte
sich der Verlag kompromissbereit: Man werde bei der nächsten Auflage die
Bildunterschrift ändern. Die bisher gelieferten Exemplare von „Die katholische
Kirche und der Holocaust“ blieben aber im Handel. „Darauf haben wir keinen
Einfluss mehr“, so Justiziar Dresen.
Wer wirklich auf dem umstrittenen Foto abgebildet ist, ob es der päpstliche
Nuntius Cesare Orsenigo sein könnte, ließ sich bisher nicht klären. Es ist nicht
einmal sicher, ob das Bild überhaupt in München aufgenommen wurde. „Der Kenner
sieht auf den ersten Blick, dass dies nicht Kardinal Faulhaber ist“, sagt der
Münchner Zeithistoriker Hans Günther Hockerts. Auch er kommt nach der Lektüre zu
einem vernichtenden Urteil: Der Autor habe eine Reihe peinlicher Sachfehler in
Kauf und nur wenige Originalquellen zur Kenntnis genommen. Größtenteils basiere
das Buch auf Sekundärliteratur, die für die Grundthese des Autors
instrumentalisiert würde. Die falsche Bildunterschrift sei da noch das geringste
Ärgernis.
Ähnlich kritisch sieht der Direktor der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn,
Karl-Joseph Hummel, die Neuerscheinung. Hummel und Hockerts saßen gemeinsam im
wissenschaftlichen Beirat der kürzlich gezeigten Münchner Ausstellung über
Kardinal Michael von Faulhaber. Beide Wissenschaftler sind aber nicht nur über
Arbeitsweise und Argumentation Goldhagens erstaunt, sondern auch über den
Berliner Siedler-Verlag. Es werfe ein schlechtes Licht auf einen an sich
seriösen Verlag, wenn derart schlampig lektoriert werde. „Ich glaube nicht, dass
dieses Buch eine wissenschaftliche Diskussion auslösen wird wie ,Hitlers willige
Vollstrecker‘ 1996. Dazu ist es zu schlecht“, glaubt Hummel.
Einige Fachkollegen haben allerdings Zweifel, ob sich das Erzbistum mit dem
Verbot einen Gefallen getan hat. „Ich dachte beim ersten Lesen: Das wird ein
totaler Flop“, sagt ein Wissenschaftler. „Aber jetzt hat Goldhagen wieder einen
Skandal.“ Eines dürfen die Leser auf keinen Fall erwarten: neue Erkenntnisse
über die Person Faulhabers. Von dem 1869 geborenen Kardinal ist in Goldhagens
Buch nur in dürren Zeilen die Rede; der Autor zählt ihn pauschal zur
überwiegenden Mehrheit der Kleriker, die nichts gegen die Judenverfolgung
unternommen hätten und deshalb wie die Schlüsselfigur Papst Pius XII. eine
Mitschuld am Holocaust trügen. „Damit wird er einer zugegeben widersprüchlichen
Figur wie Faulhaber nicht gerecht“, sagt Historiker Hans Günther Hockerts. Auf
eine ausführliche Monografie über den Kardinal müssen die Leser noch warten.
Immerhin: Das erzbischöfliche Faulhaber-Archiv ist seit kurzem für die
Wissenschaftler zugänglich. „Momentan sitzen 16 Doktoranden an den
Originalquellen“, sagt Ordinariats-Sprecher Röhmel.
Süddeutsche Zeitung, 10.10.2002: Der Monarchist
Nichts Neues: Der
Streit um Goldhagens Faulhaber-Text
Wieder einmal also eine Faulhaber-Debatte. Diesmal,
weil in Goldhagens schlampig begründeten Generalangriff auf die katholische
Kirche unter einem Foto der Name Faulhaber steht, obwohl der Münchner Kardinal
gar nicht darauf zu sehen ist, was wiederum das Münchner Ordinariat dazu
gebracht hat, den Verkauf des Goldhagen-Buchs in Deutschland vorläufig stoppen
zu lassen (SZ vom 9.10.). Dem Publizisten aus dem fernen Amerika schien der
optische Beweis der Anbiederung der Katholiken an die Nazis viel zu schön, um
falsch zu sein. Und dem heimischen Münchner Erzbistum schien dadurch der Ruf des
Kirchenfürsten derart lädiert, dass es nicht nur Goldhagen den Fehler nachwies,
sondern auch die Justiz bemühte. Selbst mehr als 50 Jahre nach seinem Tod ist
Kardinal Michael Faulhabers Erregungspotenzial enorm.
Dabei gibt es nichts Neues über Leben oder Wirken des so widersprüchlichen
Erzbischofs. Das Erzbistum München hat im Juni das Archiv Faulhabers mutig und
vorbehaltlos der Forschung geöffnet: 3000 Akten auf 100 Regalmetern. Dass dort
eine Sensation auf ihre Entdeckung wartet, die das politische Wirken des
Kirchenmanns in völlig anderem Licht zeigt, ist nicht zu erwarten; die
wichtigsten Dokumente hat der Jesuitenpater Ludwig Volk 1975 und 1978
publiziert. Wer will, kann mit Hilfe des vorliegenden Materials den Kardinal zum
heldenhaften Kämpfer gegen die Nazis stilisieren. Wer will, kann ihn aber auch
zu Hitlers Helfer machen. Der Versuch, sich der Wahrheit zu nähern, endet
irgendwo dazwischen.
Alles andere als ein Nazifreund
Dem 1869 geborenen Michael Faulhaber, dem Bischof
von Speyer und Münchner Erzbischof, blieben letztlich alle Staatsformen fremd,
die nach dem Sturz der Monarchie in Deutschland entstanden. Die Weimarer
Republik gründe auf „Meineid und Hochverrat“, sagte er 1922 auf dem Münchner
Katholikentag – der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer widersprach ihm
heftig. Seit den Adventspredigten von 1933 sahen die Nationalsozialisten in dem
Kardinal einen Feind – darin hatte er die Sittlichkeit des „altbiblischen
Volkes“ gelobt und festgestellt: „Wir sind nicht mit deutschem Blut erlöst.“
Allerdings hatte er auch gesagt, Israel sei „aus dem Dienst der Offenbarung
entlassen“. Faulhaber war angesichts des enormen Wirbels um seine Predigten viel
daran gelegen, nicht als Staatsfeind zu gelten. Auch deshalb traf er sich 1936
auf dem Obersalzberg mit Adolf Hitler, wo er dem „Führer“ versicherte, dieser
sei die „für uns gottgesetzte Autorität, der wir im Gewissen Ehrfurcht und
Gehorsam schulden“.
Die Verteidigung der Kirche unter Achtung der gottgesetzten Ordnung – dafür vor
allem formulierte Faulhaber die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ von 1937.
Deshalb verurteilte er allerdings auch das Attentat vom 20. Juli 1944.
Michael Faulhaber – ein Mann aus dem Kaiserreich, den die neue Zeit in immer
neue Widersprüche verwickelte. Der mit dem Münchner Rabbiner Leo Baerwald
befreundet war und gleichzeitig verkündete, dass der Staat das Recht habe,
„gegen Auswüchse des Judentums in seinem Bereich vorzugehen“. Er war alles
andere als ein Nazifreund, aber auch kein Widerständler – mehr ein Kämpfer für
die Unabhängigkeit und Unversehrtheit der katholischen Kirche als für die
Universalität der Menschenrechte. Ein Kind seiner Zeit eben, neben Kardinal Graf
von Galen der sprach- und wirkungsmächtigste Repräsentant eines weltanschaulich
geschlossenen Katholizismuss.
Ist alles bekannt. Ist alles geschrieben. Wird aber Faulhaber nicht den
postmortalen Frieden bringen.
MATTHIAS DROBINSKI
Süddeutsche Zeitung, 10.10.2002: Jonah, der Wiedergutmacher
Daniel Goldhagens neues
Buch als moralische Handlungsanleitung / Von Moshe Zimmermann
Daniel Jonah Goldhagen ist diesmal eindeutig eher
Jonah als Daniel: Die erste Aufgabe, die er in seinem neuen Buch „Die
katholische Kirche und der Holocaust“ (künftig: G2) auf sich genommen hat,
besteht darin, Sünder zur Buße aufzurufen wie seinerzeit der Prophet Jonah in
Ninive. Schuld, Wiedergutmachung und Moral stehen im Mittelpunkt, nicht die
historische Forschung wie noch im ersten Goldhagen-Buch „Hitlers willige
Vollstrecker“ (künftig: G1). Die zweite Aufgabe des Buches wäre dann, den
Sündern ein Buß- und Wiedergutmachungsmenü anzubieten. Offeriert werden „ein
Paradigma und eine Reihe von Verfahrensweisen, die auch auf andere Fälle
anwendbar sind“. Die Katholiken wurden also nur „exemplarisch“ als Zielscheibe
gewählt. Wir im modernen Ninive sollen von Goldhagen erfahren, wie man mit Sünde
und Wiedergutmachung umzugehen hat. „Wir haben das Recht zu urteilen“, fügt
Goldhagen hinzu. Er will also urteilen, praktiziert dabei aber weniger Buße,
dafür mehr Wiedergutmachung (für sich), Rückzieher und Vergeltung.
Zur Schuld der Deutschen: Bereits in G1, das sich mit dem „eliminatorischen
Antisemitismus“ der Deutschen seit Luther beschäftigte, sorgte eine Fußnote für
einen partiellen Ablass: Die Generation nach 1945 wurde von der automatischen
Teilnahme am „eliminatorischen Antisemitismus“ rückwirkend entlastet. Mit der
Wahl der Katholiken als Ziel des Angriffs von G2 können nun – vorübergehend –
auch die nichtkatholischen Deutschen aufatmen. Mehr noch: Die besondere deutsche
Last an der Schuld wurde – wenigstens andeutungsweise – relativiert: Schuldig
gesprochen sind „gewöhnliche Deutsche und (!) Nichtdeutsche während des
Holocaust“.
Gegen den Vorwurf der Kollektivschuld wehrt sich G2 mit Nachdruck, weil es
„jegliche moralische Untersuchung“ vermeidet. Richtig. Aber damit ist der Satz
aus G1 außer Kraft gesetzt, nach dem die Last der Beweisführung nicht bei
denjenigen liege, die den „eliminatorischen Antisemitismus“ der Deutschen
nachweisen wollen, sondern umgekehrt bei denen, die einige Deutsche von diesem
automatischen, kollektiven Charakterzug entlasten möchten. Nun kommt in G2 ein
weiterer Rückzieher: Goldhagen behauptet, wiederholt anerkannt zu haben: „Es gab
durchaus Deutsche, deren Ansichten über den Juden mit der vorherrschenden
antisemitischen Ansicht ihrer Kultur nicht übereinstimmten.“ Auch heißt es:
„Viele gewöhnliche Deutsche waren in der NS-Zeit Antisemiten“, also nicht alle,
und nicht unbedingt vor dieser Zeit. Und diese Deutsche waren nicht allein:
„Schweizer Banken (und Institutionen anderer Länder) haben die Opfer bestohlen.
“ Um die dreifache Kombination zu ergänzen: „Einige führende deutsche Historiker
haben dem NS-Regime gedient.“ Nur Historiker?
Die Antwort hat wieder mit Schuld, Wiedergutmachung, aber noch mehr mit
Vergeltung zu tun – die Rache Goldhagens. Denn der Satz geht weiter: „. ..und
ihre Schüler, von denen einige zu den bedeutendsten Historikern des heutigen
Deutschland gehören, haben es also die Kollaboration] vertuscht.“ Wieder
entschlüsselt die Fußnote (Nr. 17) den Sinn: Es handelt sich um Hans- Ulrich
Wehler und Hans Mommsen, die Goldhagens Meinung nach „haltlose Schriften über
den Holocaust“ geschrieben haben. Mit „haltlosen Schriften“ meint er sicher die
Kritik an G1, nicht die Werke der beiden, die kein seriöser Historiker als
haltlos bezeichnen wird. Die interne Debatte in der deutschen Historikerzunft um
das Erbe Conzes & Co. verhalf Goldhagen zu einer eigenartigen privaten
Wiedergutmachung. „Die“ Deutschen sind teilweise entlastet, dafür rücken, außer
den Schweizer Banken, „die deutschen Historiker“, die sich bekanntlich nicht für
G1 begeisterten, ins Zentrum des Vollstreckertums.
Ein eleganter Rückzug
Zum eliminatorischen Antisemitismus: In G1 war dieser Begriff Goldhagens
Steckenpferd. In G2 findet er nur auf sieben Seiten Erwähnung und verschwindet
praktisch hinter der „eliminatorischen Verfolgung“. Zwar ist unter „eliminatorisch“,
wie in G1, eigentlich jede Einstellung (auch die der Liberalen) gegenüber Juden
zu verstehen, aber „eliminatorische Verfolgung“ ist plausibler als „eliminatorischer
Antisemitismus“. Ein eleganter indirekter Rückzieher.
Zur Beziehung zwischen Antisemitismus und Antizionismus: Goldhagen nimmt sich
diesmal eine detaillierte Definition des Antisemitismus vor und schafft als
Nebenprodukt eine politische Wiedergutmachung. Anders als in G1 schenkt er
Israel und dem Zionismus seine Aufmerksamkeit. Darüber wird man sich in Israel
freuen. Er betrachtet Israel als Wiedergutmachung für die zerstörten jüdischen
Gemeinschaften und wagt den nächsten Schritt: Wer Juden das Recht auf einen
Nationalstaat absprechen will, ist nicht nur Antizionist, sondern Antisemit. Den
heutigen Antizionismus hält er für eine „radikale und extreme Spielart des
politischen Antisemitismus“.
Doch die Freude der Möllemann-Gegner oder der Vertreter der israelischen
Regierungspolitik darf sich in Grenzen halten: Goldhagen gibt zu, dass „Israel
und die Israelis sich nicht wenige strafrechtliche, politische und moralische
Verfehlungen zu Schulden kommen lassen“. Darüber hinaus „wären alle, die Juden
politische Wiedergutmachung schulden, verpflichtet, solchen Entwicklungen oder
Maßnahmen entgegenzuwirken“! Wiedergutmachung gegenüber Juden schließt also die
Unterstützung eines Palästinenserstaates keineswegs aus.
G2 ist aber auch sonst aus nahöstlicher Perspektive willkommen: Goldhagen lehrt
uns mit seinem Paradigma, dass die Folgerungen, die „hinsichtlich Schuld und
Wiedergutmachung gezogen werden, grundsätzlich auf alle anderen Verbrechen
übertragen (werden können), gleichgültig, von welchen Institutionen oder
Menschen sie an anderen Menschen in Vergangenheit oder Gegenwart begangen wurden
oder werden“. Goldhagen deutet ja nicht nur auf serbische oder südafrikanische
Untaten hin, sondern auch auf amerikanische. Wenn das Paradigma im Ernst
allgemeine Gültigkeit erhalten soll, muss man auch das Beispiel Israels unter
die Lupe nehmen. Das wird Grund genug sein, G2 – wie bereits G1 – in Israel
nicht zu thematisieren.
Konstruktiv scheint auch Goldhagens Beobachtung zu sein, dass „viele Angehörige
der akademischen Gemeinschaft sich ihrer Verpflichtung entziehen, auf moralische
Fragen überhaupt einzugehen“. Allerdings ist daran nicht nur die akademische
Gemeinde schuld. Als sich in Israel Akademiker gegen den herrschenden
rechtsorientierten Strom in Sachen Krieg, Intifada, Wehrdienstverweigerung etc.
zu Wort meldeten, waren es nicht nur die Verfechter der „wissenschaftlichen
Unparteilichkeit“, sondern gerade die Stimmen außerhalb des Elfenbeinturms, die
sich erbost distanzierten. Nimmt man Goldhagen beim Wort, so ist der Akademiker,
der die G2-Paradigmata der Wiedergutmachung akzeptiert, sogar verpflichtet,
Jonah im modernen nahöstlichen Ninive nachzuahmen. War die deklarierte Absicht
von G1, „den Deutschen wieder zu ihrem Menschsein zu verhelfen“, so könnte die
latente Absicht von G2 womöglich sein, unter anderem Israelis auf einen
ähnlichen Weg zu helfen.
Der Autor lehrt Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem.

8-10-2002
Rezension: Sachbuch
Dostojewski nahm es mit Schuld und Sühne genauer
Reizfigur Pius
XII.: Hätte Daniel Goldhagen nur José Sánchez gelesen, wäre Goldhagen II nicht
passiert / Von Konrad Repgen
8. Okt.
2002 Hitlers
Judenmord und Pius XII." - das alte, emotionsgeladene Thema hat in den
Vereinigten Staaten wieder Konjunktur. Zwei einschlägige Neuerscheinungen dieses
Jahres erreichen jetzt in Übersetzung Deutschland. Sie unterscheiden sich nach
Umfang und Preis schon sehr; nach Fragestellung, Vorgehensweise und Ergebnis
sind sie wie Feuer und Wasser.
Goldhagen ist kein
Unbekannter. Vor sechs Jahren erschien sein Wälzer "Hitlers willige
Vollstrecker" mit der Zentralthese, daß die Deutschen, von Ausnahmen abgesehen,
mit dem Judenmord einverstanden gewesen seien. Dieser These haben die
Fachhistoriker fast unisono widersprochen, während das Buch ein Bestseller wurde
und der junge Autor zum Medienstar aufstieg. Wird Goldhagen II an den Erfolg von
1996 anknüpfen? Am bewährten Marketing mangelt es nicht. Die deutsche Version
erscheint sogar zeitgleich mit der New Yorker Originalausgabe (bei Alfred A.
Knopf). Daher ist die Zuverlässigkeit der Übersetzung noch nicht überprüfbar.
Sie macht keinen schlechten Eindruck. Ob auch diesmal, wie bei Goldhagen I,
gewisse Abmilderungen vorgenommen worden sind, bleibt abzuwarten.
Goldhagen II bietet jedoch
nicht, wie der Titel behauptet, eine "Untersuchung", sondern ist ein Plädoyer.
Der Autor will mit seinem umfangreichen Buch, das viele Aspekte berücksichtigt,
eine Verurteilung begründen, um Wiedergutmachung wegen des Holocaust, der die
Folge des kirchlichen Antijudaismus gewesen sei, zu verlangen: materielle (unter
acht Millionen Dollar), politische (Abschaffung des Vatikanstaates) und
moralische (Eliminierung von 450 Judenfeindschaft verursachenden oder
begünstigenden Versen der Evangelien und der Apostelgeschichte). Dabei ergeht er
sich in ermüdenden Wiederholungen. So werden problematische Hypothesen zum
Reichskonkordat von 1933 allein an sieben verschiedenen Stellen des Buches
wiederholt.
Dem Plädoyer
entspricht auch Goldhagens mitunter hämmernder Argumentationsstil, der drei,
vier, fünf rhetorische Fragen suggestiv aneinanderreiht. Gibt es darauf keine
befriedigende Antwort (oder kennt der Autor sie nicht), so ist "bewiesen", daß
Schuld vorliege, die Wiedergutmachung erfordere. Der junge
Politikwissenschaftler Goldhagen aus Harvard schreibt sein zweites Buch nicht
wie ein Historiker, sondern wie ein Anwalt oder Ankläger in einem
Wiedergutmachungsprozeß.
Die fundierte
Kritik der Fachleute an Methode und Resultat von Goldhagen I ist an dem Autor
abgeprallt. Er wiederholt seine Thesen von 1996 und hält an deren Gültigkeit
unvermindert fest. Dort galt als Leitbegriff zur Erklärung der
Massenmord-Aktionen der Jahre 1941/1945 die in Deutschland angeblich allgemein
verbreitete Mentalität eines "eliminatorischen Antisemitismus". Der ziemlich
nahtlose Übergang vom Verdrängen zum Vernichten verstand sich für ihn fast von
selbst. "Töten ist nur eines von zahlreichen Mitteln der Ausschaltung", heißt es
auch jetzt lapidar. In Goldhagen II geht es aber nicht mehr, wie 1996, um "die
Deutschen", sondern um "die katholische Kirche". Damit meint er den Papst, die
Bischöfe und den Seelsorgeklerus, nicht die Laien.
Warum nun gerade
der hierarchische und klerikale Antijudaismus religiöser Art den Schlüssel für
die Massenmorde von Babi Jar und Auschwitz bieten soll, erklärt Goldhagen II
nicht, obwohl er gut weiß, daß "Antisemitismus allein kein Programm des
systematischen Massenmordes hervorbringt". Einen angemessenen Zugang zur Lösung
dieses Problems verstellt er sich jedoch mit Pauschalurteilen wie etwa: "Die
Kirche, der Papst, die nationalen Kirchen, die Bischöfe und die Priester haben
während des Holocaust insgesamt gefehlt." Auch wer dieses Urteil sich zu eigen
machen wollte, hätte noch zu begründen, wie gerade dieses Fehlverhalten die
Massenmord-Aktionen verursacht habe. Dazu müßte man sich allerdings auf viele
Quellen einlassen und nicht, wie Goldhagen II, mit fleißigen, aber flüchtigen
Exzerpten aus der Sekundärliteratur begnügen.
Nur wenn man,
wie er, den (kirchlichen) Antijudaismus und den NS-Antisemitismus zu dicht
zusammenrückt, kann der wüste Kirchenhasser Julius Streicher, dessen "Stürmer"
in Artikeln und Karikaturen gleichermaßen gegen Juden wie gegen "Pfaffen" hetzte
und den Kardinalstaatssekretär Pacelli als Kumpan des "Weltjudentums"
attackierte, kann ausgerechnet Streicher als Zeuge für eine judenfeindliche
Verwandtschaft zwischen Kirche und Nationalsozialismus figurieren. Dies ist eine
ähnlich abwegige Konstruktion wie die These, daß das Reichskonkordat dem Regime
das "Recht" zugestanden habe, "seine unverhüllt militaristischen,
imperialistischen und rassistischen Ziele zu verfolgen".
Im Vertrag von
1933 steht das Gegenteil. Denn dort wird dem Klerus die "pflichtmäßige
Verkündigung und Erläuterung der dogmatischen und sittlichen Lehren und
Grundsätze der Kirche" ausdrücklich vorbehalten. Gehörten etwa Militarismus,
Imperialismus und Rassismus im Jahre 1933 zum Dogma der katholischen Kirche?
Plakativ, freilich ohne Beleg, wird im Text von des Papstes "Begeisterung für
den deutschen Eroberungsfeldzug im Osten" gesprochen; dagegen steht nur irgendwo
im Anmerkungskeller, daß der Vatikansender (am 21. Januar 1940) den
Nationalsozialismus für schlimmer als den Kommunismus erklärt habe. Jongliert
ein seriöser Historiker derart mit Behauptungen und Fakten?
Für einen
Historiker mit wissenschaftlichem Anspruch eine befremdliche Maxime: "Da dieses
Buch keine Übung in Geschichtsschreibung ist, begebe ich mich nicht in eine
laufende Diskussion mit Ansichten dieser oder jener Autoren, die von den meinen
abweichen mögen. Leser, die ihre Kenntnisse über diese Fragen zu vertiefen
wünschen, können sich ihre Bücher und die anderer Autoren, die das Material
anders deuten, ohne weiteres beschaffen." Das könnte man höchstens als
freundlichen Aufruf zur Absatzförderung historischer Literatur gelten lassen;
aber so wird Geschichte zum Steinbruch, dem für abstrakte Thesen über Schuld und
Sühne Belege entnommen werden, die nicht begründen, sondern illustrieren. Auf
deutschsprachige Texte bezieht er sich selten, auf lateinische, französische und
italienische noch weniger und auf die Sprachen der Bibel schon gar nicht.
Es liegt nahe,
daß bei dieser Vorgehensweise der Historie auf Schritt und Tritt Gewalt angetan
wird. Ich will aber nicht die lange Litanei seiner groben Fehler und kleineren
Schnitzer weiter ausbreiten. Ich möchte jedoch daran zweifeln, daß Goldhagens
exegetische Kompetenz ausreicht, um ein überzeugendes Programm für die
Eliminierung von 450 unbequemen Bibelstellen, wie es ihm vorschwebt, zu
begründen.
In Umfang, Preis
und Anspruch präsentiert sich die von Schöningh betreute Sánchez-Studie sehr
viel bescheidener. Auch ist José M. Sánchez, Professor an der
Jesuitenuniversität von St. Louis/Mo., bisher in Deutschland unbekannt. Das
könnte sich nun ändern. Denn was er in betont ruhigem Duktus über die Anatomie
der aktuellen Pius-XII.-Debatte geschrieben hat, bringt die
Geschichtswissenschaft tatsächlich voran und öffnet dem breiteren,
zeitgeschichtlich interessierten Publikum den Weg zu eigenem Urteil. Er will den
Leser weder überreden noch emotionalisieren, sondern ihm eigenes Urteilen
ermöglichen. Seine Schneise durch den Dschungel der neuesten Literatur über Pius
XII. im Zweiten Weltkrieg ist dafür eine Hilfe.
Sánchez hält
sich an die erprobten historischen Methoden und fragt in zwölf kurzen Kapiteln
jeweils drei Dinge: Was möchten wir wissen? Welche Quellen haben wir dafür?
Welche Antworten lassen sich darauf begründen sowie - sehr wichtig - welche
Antworten nicht. Denn der Historiker ist nicht das Weltgericht und weiß nicht
alles. Aber er vermittelt Einsicht, indem er den Leser nie darüber im unklaren
läßt, was er eigentlich weiß und was nicht, wie weit sein Blick reicht, wie
sicher seine Aussagen die Probe durch die Evidenz der Logik und der Quellen
bestehen können. Sánchez erörtert die Probleme, während er die primären Quellen
prüft, und bildet sich daraus eine eigene Meinung. Deshalb macht seine Lektüre
wirklich klüger. Außerdem findet man bequem beisammen, was zum jeweiligen Punkt
der Debatte die Kritiker des Papstes (wie John Cornwell, Suzan Zuccotti und
Michael Phayer), seine Verteidiger (wie Margherita Marchione und Ronald Rychlak)
oder ein Historiker, der einen Mittelweg sucht wie Giovanni Miccoli (Triest),
geschrieben haben.
Etwas zu
bedauern ist freilich, daß Sánchez in seinen Überblick nicht auch die große, vor
zwei Jahren erschienene Studie von Hans Jansen, früher katholischer Priester,
jetzt reformierter Pfarrer und Professor an der Freien Universität Brüssel,
einbezogen hat. Auf 850 Seiten eines sehr materialreichen, allerdings
niederländisch geschriebenen Buches, das "den Protest Pius XII. und seiner
Mitarbeiter gegen die Judenverfolgung in Europa" behandelt, arbeitet Jansen
einen Katalog von nicht weniger als vierzig "Protesten" des Papstes zugunsten
der Juden heraus. Denn einfach "geschwiegen" hat Pius XII. bekanntlich nicht;
aber er war im Zweiten Weltkrieg, wie Sánchez im Schlußteil überzeugend
formuliert, eine zugleich "bemitleidenswerte und beeindruckende Gestalt". Die
ständige Güterabwägung zwischen den beiden Amtspflichten, Stellvertreter Christi
und Oberhaupt der Kirche zu sein, war nach des Papstes eigenen Worten
"schmerzvoll schwer". Die Späteren, die in der Welt von heute leben, verstehen
eine solche Problematik kaum noch unmittelbar. Sánchez erleichtert es ihnen;
denn er will "einige der Legenden, die sich um das Rätsel ,Pius XII. und der
Holocaust' ranken", begraben. Das ist ihm gelungen. So hebt er die Erinnerung an
Persönlichkeit und Wirken des Pacelli-Papstes über Anklage und Verteidigung
hinaus.
Daniel Jonah Goldhagen: "Die
katholische Kirche und der Holocaust". Eine Untersuchung über Schuld und Sühne.
Aus dem Amerikanischen von Friedrich Griese. Siedler Verlag, Berlin 2002. 480
S., 24 S/W-Abb., geb., 24,90 [Euro].
José M. Sánchez: "Pius XII.
und der Holocaust". Anatomie einer Debatte. Aus dem Amerikanischen von Karl
Nicolai. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2002.
182 S., br., 13,90 [Euro].
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2002, Nr. 233 / Seite L31
|
|
Von Hanno Helbling
Daniel Jonah Goldhagen hat seinem umstrittenen Werk «Hitler's Willing Executioners» («Hitlers willige Vollstrecker», 1996) eine weitere Arbeit mit dem Titel «A Moral Reckoning. The Role of the Catholic Church in the Holocaust and its Unfulfilled Duty of Repair» (2002) folgen lassen, ein Buch, das nun auch in der offenbar etwas rasch angefertigten Übersetzung von Friedrich Griese vorliegt: «Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne». Der Autor bezieht sich ausdrücklich auf die frühere Publikation und auf die zum Teil sehr kritische Aufnahme, die sie gefunden hat, wobei er sich einerseits gegen den «frei erfundenen» sowie «ehrenrührigen» Vorwurf verwahrt, er habe den dort behandelten «ganz gewöhnlichen Deutschen» eine Kollektivschuld zugeschrieben, und andererseits an der These festhält, «dass die Deutschen, von Ausnahmen abgesehen, im Wesentlichen mit der gewaltsamen, eliminatorischen Verfolgung der Juden einverstanden waren». Im Zusammenhang mit der Pflicht zur Wiedergutmachung begangenen Unrechts wird er darauf zurückkommen, dass nur die «schuldig gewordenen Individuen und Institutionen und dann, nachdem die Verfehlungen verübt worden sind, die freiwilligen Mitglieder der Institutionen» für Sühneleistungen verantwortlich sind (also die Träger einer Staatsbürgerschaft, die Angehörigen einer Kirche).
Goldhagen unterzieht den Katholizismus einer «moralischen Prüfung» - bahnbrechenderweise? Wenn man ihm glauben will, hat in der Diskussion über die Zeit des Nationalsozialismus lange «ein Denk- und Redeverbot über die Moral» bestanden («obwohl über diese Zeit Zigtausende von Büchern geschrieben wurden»), und die Kirche ist, wie er feststellt, «einer gründlichen Untersuchung entgangen», trotz einer «Flut neuer Bücher über das Fehlverhalten Pius' XII. während des Holocaust». Seine «Analyse und die Urteile, die hier vorgelegt werden, beziehen sich auf die katholische Kirche und ihren Klerus, nicht speziell auf die katholischen Laien» - durch die zwar die Kirche am unmittelbarsten in das politische Geschehen involviert war. Gewiss hat er Recht, wenn er sagt, es sei «einfacher, die Handlungen und Versäumnisse der Geistlichen zu identifizieren, da sie in amtlicher Eigenschaft handelten und im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen». Es kommt ihm auf die Unterlassungen der Amtskirche an; so ausschliesslich, dass man sich fragen muss, ob er die «ganz gewöhnlichen Katholiken» für Menschen hält, die erst ein Hirtenbrief oder eine Enzyklika auf den Gedanken gebracht hätte, dass man Juden nicht umbringen soll.
In seiner Beurteilung der vatikanischen Politik und zumal des so schmerzlich vermissten päpstlichen Einspruchs gegen die Verfolgung und Vernichtung der Juden im deutschen Machtbereich steht Goldhagen in der Tradition, die Gunther Lewy 1964 mit «The Catholic Church and Nazi Germany» begründet und John Cornwell 1999 mit «Hitler's Pope» zu einem wahrhaft bitteren Ende geführt hat. Ein systematisches Quellenstudium ist seiner Arbeit nicht anzumerken; seine Zitate aus Primärtexten stammen zumeist aus der - vorwiegend angelsächsischen - Sekundärliteratur. Oft meint er auch ohne direkte Zeugnisse auszukommen. Er erwähnt als bekannte Tatsache die «Begeisterung Pius' XII. für den deutschen Eroberungsfeldzug im Osten» - auf Grund welcher Äusserung des Papstes? Was man tatsächlich weiss, ist zum Beispiel, dass Pius XII. am 3. April 1943 den Wunsch des ungarischen Ministerpräsidenten Miklos von Kallay, er möge auf einen Zusammenschluss aller nichtkommunistischen Staaten gegen die Sowjetunion hinwirken, abgelehnt hat: An etwas Derartiges, meinte er, könnte man doch erst dann denken, «wenn die Deutschen eine menschliche Behandlung der Kirche, der Juden und der Bevölkerung in den besetzten Gebieten» einführten. Von Begeisterung ist da nichts zu spüren.
Man pflegt zwischen einem christlichen (nicht nur katholischen) Antijudaismus und einem pseudowissenschaftlich begründeten Antisemitismus zu unterscheiden, den die Kirche neuheidnisch nennt. Goldhagen ist nicht der Erste, der diese Differenzierung für fragwürdig hält - womit allerdings wenig gesagt ist: Er nennt sie «eine der eklatantesten Geschichtsklitterungen der letzten Zeit». Tatsächlich verraten autoritativ-klerikale Behauptungen über den «zersetzenden» Einfluss der Juden auf die Gesellschaft einen bedrückenden Einklang mit der vulgär-antijüdischen Publizistik, die der Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben hat. Nur ändert das nichts daran, dass der Judenhass, den die Kirchen jahrhundertelang gepflegt haben, religiös motiviert war und nicht rassistisch. Wenn Goldhagen die Evangelisten als Antisemiten bezeichnet - und zu den längst fälligen Sühneleistungen der Kirche eine Absage an die «christliche Bibel» rechnet -, ignoriert er die geschichtlichen Umstände so gut wie ihre neuere theologische Verarbeitung (etwa: «Das jüdische Volk und seine heiligen Schriften in der christlichen Bibel», eine Studie der Päpstlichen Bibelkommission, 2001). Doch auch die hergebrachten katholischen Glaubensvorstellungen scheinen ihm fremd zu sein: Die Kirche, meint er, habe mit ihrer ungenügenden Abmahnung vor einem kriminellen Verhalten zugelassen, dass die Gläubigen ihre Seelen dem Fegefeuer «auf ewig» aussetzten.
Er dringt auf «analytische Exaktheit und moralische Redlichkeit»: keine Beschönigungen und Ausreden mehr. Wenn beim Abschluss des Reichskonkordats (1933) der Heilige Stuhl versicherte, er werde sich nicht in innerdeutsche staatliche Verhältnisse einmischen, dann wurde damit nach Goldhagens Auslegung «die Absicht der Kirche» bekundet, «den Deutschen im Hinblick auf die Juden freie Hand zu lassen». Die slowakischen und kroatischen Geistlichen, die sich gegen die nationalsozialistischen Untaten nicht auflehnten, waren in seinen Augen «Massenmörder im Priestergewand». Und wenn es nach dem Krieg der polnischen Kirche einfiel, in Auschwitz ein Nonnenkloster errichten und ein riesiges Kreuz aufstellen zu lassen, konnte das in Goldhagens Optik allein zu dem Zweck geschehen, den Ort zu «entjuden»; wo das Kreuz doch schon seit Konstantin «ein antisemitisches Symbol» war (den Gewährsmann für solche Zusammenhänge hat er in James Carroll gefunden: Constantine's Sword. The Church and the Jews, 2001).
Schuld und Sühne: Für die Schuld ist nach Goldhagens Überzeugung massgeblich, dass die Menschen jederzeit frei sind, das Richtige, Gute zu tun und das Falsche, Böse zu lassen. Dass geschichtliche Situationen die Handlungsfreiheit begrenzen, dass Konstellationen entstehen können, in denen man es, wie Pius XII. einmal von sich selber sagte, mit «widerstreitenden Forderungen» zu tun hat: dergleichen Relativitäten erkennt der strenge Richter nicht an; sein Ethos weiss nichts von Bedingtheiten. Daher kann er auch Art und Mass der materiellen, politischen und moralischen Wiedergutmachung kasuistisch genau, und mit Hilfe von Tabellen, bestimmen.
Vor beinahe vierzig Jahren ist Rolf Hochhuths Schauspiel «Der Stellvertreter» erschienen: die Anklageschrift, die einen heute weitgehend abgeschlossenen Prozess einleitete. Prozess im engeren Sinn, als Verfahren gegen Eugenio Pacelli, den Kardinalstaatssekretär und späteren Papst, aber auch im weiteren Sinn einer Klärung des Verhältnisses zwischen geistlicher und weltlicher Macht, historischer Autorität und politischer Verantwortung. Die Resultate liegen vor, sie sind überblickbar, und man kann sie zueinander in Beziehung setzen. Oder man verfährt wie Goldhagen und greift die Elemente heraus, die mit dem ursprünglichen Verdacht übereinstimmen. Feststellungen, die ihm widersprechen oder die ihn modifizieren könnten, werden als unwesentliche Ausnahmen oder verteidigende Ausflüchte abgetan, und so liest man von neuem die Anklage, nun aber als Urteil. Die «Zigtausende von Büchern», von denen der Autor weiss - sie wären, ginge es nach ihm, umsonst geschrieben worden.
Daniel Jonah Goldhagen: Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne. Aus dem Amerikanischen von Friedrich Griese. Siedler-Verlag, Berlin 2002. 476 S., Fr. 42.-.
Neue Zürcher Zeitung, 8. Oktober 2002