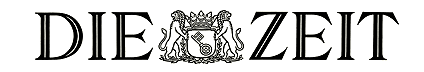
2-11-2002
Das Leben der Lilli Jahn 1900 – 1944
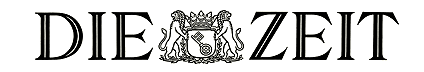
Literatur 33/2002
Wie bitter weh das alles tut
Ein neues, bewegendes Zeugnis über den Holocaust: Die Briefe der Lilli Jahn und ihrer Kinder
von Volker Ullrich
Martin Doerry:
Mein verwundetes Herz
Das Leben der Lilli Jahn 1900-1945; Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart/München 2002; 351 S., 24,90 €
|
Da dachte man, nach dem Tagebuch der Anne Frank, nach Victor Klemperers Aufzeichnungen und Helene Holzmans Erinnerungen könne einen nichts mehr erschüttern. Doch nun ist mit den Briefen der Lilli Jahn und ihrer Kinder ein Zeugnis aufgetaucht, das uns ergreift wie kaum ein anderes. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es in der Literatur über den Holocaust künftig einen bedeutenden Platz einnehmen wird. Lilli Jahn gelang es, die Briefe unmittelbar vor ihrer Deportation nach Auschwitz im März 1944 aus dem Lager Breitenau bei Kassel (wo sie seit Anfang September 1943 festgehalten worden war) hinauszuschmuggeln. Ihr Sohn Gerhard, später Justizminister im Kabinett Willy Brandts, bewahrte sie in seiner Marburger Wohnung auf. Dort entdeckten sie seine vier jüngeren Schwestern nach seinem Tode im Oktober 1998 - ein überraschender Fund, denn nie war davon mit einer Silbe die Rede gewesen. Martin Doerry, ein Sohn der ältesten Schwester Ilse, heute stellvertretender Chefredakteur des Spiegels, übernahm es, den kostbaren Nachlass zu ordnen. Er stellte intensive Nachforschungen an, machte viele weitere Dokumente und Briefe ausfindig. Unter der Hand entstand so die exemplarische Biografie einer klugen, hoch gebildeten deutschen Jüdin, deren Leben durch die Nazibarbarei zerstört wurde - und durch ihren eigenen nichtjüdischen Ehemann Ernst Jahn, der sich im Oktober 1942 von ihr scheiden ließ und sie damit schutzlos der Verfolgung auslieferte. Kennen gelernt hatte die 1900 geborene Tochter eines Kölner Fabrikanten und angehende Medizinerin ihren "Amadé", wie sie ihn zärtlich nannte, im Spätsommer 1923, auf dem Höhepunkt der Inflation. |
|
Ernst Jahn hatte wie sie Medizin studiert und suchte, nachdem das geerbte Geldvermögen sich in nichts aufgelöst hatte, händeringend nach einer festen Anstellung. Unterschiedlicher hätten die Temperamente nicht sein können: Sie, eine lebenslustige junge Frau, vielseitig interessiert an Kunst, Literatur, Musik; er, ein früh verwaister Eigenbrötler mit einem Hang zur Schwermut und Frömmelei. Es bedurfte einiger Überredungskunst von Seiten Lillis, um den Widerstand ihrer Eltern gegen eine Heirat zu überwinden. Die Mutter warnt vor den "Gefahren einer Mischehe", der Vater befürchtet, dass seine Tochter in Immenhausen, einer Kleinstadt nördlich von Kassel (wo Ernst sich schließlich als praktischer Arzt niedergelassen hatte) nicht genügend geistige und kulturelle Anregungen finden könne.
Allem Anschein nach war die Verbindung eine, wie Doerry schreibt, "zuweilen einseitige Angelegenheit". Sie schreibt ihm wunderbare, leidenschaftliche Liebesbriefe; seine Antwortbriefe sind nicht erhalten, aber offenbar waren sie im Ton sehr viel reservierter. Denn er liebt zunächst eine andere Frau, und erst als diese ihn verlässt, entscheidet er sich für Lilli. Während sie ihren Beruf weiter ausüben möchte, will er sie in die traditionelle Frauen- und Mutterrolle zurückdrängen. Und von Anfang an liegt der in der Weimarer Republik grassierende Antisemitismus wie ein großer Schatten über ihrer Beziehung. "Und dann habe ich Sorge", schreibt sie ihm im März 1925, "ob nicht Dir die Ehe mit einer Jüdin in Deinem Beruf und dem Vorwärtskommen Schwierigkeiten bereiten wird, und ich bitte Dich von Herzen, mir mit aller Offenheit darauf zu antworten." Diese Offenheit wird Ernst nie aufbringen, und das sollte ihr zum Verhängnis werden.
In einem anrührenden Brief vom Januar 1926 beschwört der Vater seinen künftigen Schwiegersohn, seiner Tochter die Treue zu halten. "Wir haben Dir ein Teil des Liebsten und Besten, was wir haben, gegeben." Nach der Trauung im August 1926 zieht das Paar nach Immenhausen. In rascher Folge werden die Kinder geboren: Gerhard 1927, Ilse 1929, Johanna 1930, Eva 1933 - und als Nachzüglerin Dorothea 1940, genannt Dorle. "Meine Tage sind so ausgefüllt mit Haus und Kindern, und abends bin ich restlos müde", klagt die Mutter Anfang Februar 1933, kurz nach Hitlers "Machtergreifung". Mit deren Folgen werden die Jahns erstmals Ende März 1933 konfrontiert. SA-Leute verhaften die Immenhausener Sozialdemokraten und Kommunisten und foltern sie eine Nacht lang. Die übel zugerichteten Leute muss Ernst Jahn am nächsten Tag in seiner Praxis verarzten.
Und dann der Schock des 1. April 1933, als Ernsts Praxis von den Immenhausener Bürgern in den "Judenboykott" einbezogen wird. "Wir haben Erschütterndes erlebt", berichtet Lilli einen Tag später einer Freundin. "Und könnt Ihr Euch vorstellen, wie mir zumute ist? Könnt Ihr begreifen, wie schwer mir ums Herz ist und wie bitter weh das alles tut?" Die eben noch geachtete Arztfamilie ist plötzlich geächtet. Lilli zieht sich ganz auf die Familie zurück; sie geht "fast überhaupt nicht mehr vor die Tür" (4. Februar 1934). Und wenn sie es tut, dann senkt sie den Blick zu Boden, um niemanden in die Verlegenheit zu bringen, sie grüßen zu müssen. Am meisten Sorgen bereitet ihr die Zukunft ihrer Kinder, die als "Halbjuden" in der Schule als Außenseiter gemieden werden und von vornherein jeder Berufschance beraubt sind. "Manchmal weiß ich nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, alles zu ertragen" (23. August 1935).
Lillis Schwester Else wandert nach England aus; nach dem Pogrom vom 8. November 1938 folgt ihr die Mutter nach. Doch Ernst Jahn kann sich nicht dazu entschließen, seine Praxis aufzugeben. So werden alle Möglichkeiten, rechtzeitig Nazideutschland zu verlassen, vertan.
In der Situation extremer Not und Bedrängnis der Dresdner Juden hielt Eva Klemperer bedingungslos zu ihrem Mann Victor - und rettete ihm dadurch das Leben. Lillis Mann hingegen hält dem Druck nicht stand. Er liiert sich mit einer jungen Göttinger Ärztin, die im Sommer 1939 zum ersten Mal die Praxisvertretung übernommen hat. Und obwohl ein befreundeter Rechtsanwalt ihm dringend abrät, seine Ehe mit Lilli aufzulösen, weil man nicht wissen könne, wie lange seine Frau dann noch vor Übergriffen geschützt sei, lässt er sich im Oktober 1942 scheiden. Einen Monat später heiratet er seine Geliebte, mit der er schon ein Kind hat.
"Vielleicht habt ihr ein wenig Käse übrig oder Marmelade"
Vor den wenigen Freunden, die ihr noch geblieben sind, versucht Lilli zunächst, die Katastrophe zu verheimlichen. Doch im März 1943 macht sie in einem langen Brief ihrem Schmerz Luft: "Ich fühle mich im Innersten grenzenlos einsam und verlassen." Und doch bittet sie zugleich, ihren "Amadé" nicht so hart zu verurteilen. Denn "weder Leichtsinn noch Herzlosigkeit noch Schlechtigkeit" könne man ihm vorwerfen.
Im Juli 1943 wird Lilli gezwungen, mit ihren fünf Kindern in eine Etagenwohnung nach Kassel umzuziehen. Als provisorisches Namensschild heftet sie ihre Visitenkarte "Dr. med. Lilli Jahn" an die Tür an und verstößt damit gleich gegen zwei Nazivorschriften: das Verbot, den Doktortitel zu führen, und die Verordnung, den Namen Sara dem Vornamen hinzuzufügen. Sie wird bei der Gestapo denunziert, verhört, noch einmal freigelassen, dann aber erneut festgenommen und ins "Arbeitserziehungslager" Breitenau gebracht. Dort muss sie Zwangsarbeit in einer Pharmafabrik leisten - zwölf Stunden am Tag bei völlig unzureichender Ernährung.
Von einem Tag auf den anderen sind die Kinder weitgehend sich selbst überlassen. Ilse, die 14-Jährige, übernimmt die Rolle der Ersatzmutter, sorgt in rührender Weise für die jüngeren Schwestern. Und sie schreiben Briefe, Ilse und Johanna fast jeden zweiten Tag. Darin lassen sie ihre Mutter teilhaben an den Sorgen und kleinen Freuden ihres Alltags, sprechen ihr Mut zu und geben ihr immer aufs Neue Zeichen ihrer Liebe und Verbundenheit. Diese insgesamt 250 Briefe, unter denen Doerry die sprechendsten ausgewählt hat, sind das Herzstück des Buches; sie spiegeln, wie sonst kaum eine historische Quelle, das Leben der Verfemten unter der Nazidiktatur. Erstaunlich, wie sicher vor allem Ilse den Ton trifft, wie sie es versteht, durch Andeutungen und Verschlüsselungen die Zensur zu umgehen.
Lilli darf nur einmal im Monat schreiben - doch es gelingt ihr immer wieder, auf der Fahrt zu ihrer Arbeitsstelle auf Packpapier oder Medikamentenbanderolen unzensierte Nachrichten herauszubefördern. Aus den Wünschen, die sie darin äußert, können die Kinder entnehmen, wie schlecht es ihr gehen muss: "... und dann, wenn es Euch möglich ist, hin und wieder etwas Brot, ein bißchen Salz, vielleicht habt ihr ein wenig Käse übrig oder Marmelade ... wir bekommen hier nur Suppe oder Pellkartoffeln" (12. September 43). Dennoch: Über die menschenunwürdigen Zustände im Lager, über die tägliche Entwürdigung, die ihr widerfährt, äußert Lilli sich nur zurückhaltend, um ihre Kinder nicht zu sehr zu beunruhigen. "Es ist natürlich viel schwerer, als ich den Kindern schreibe", teilt sie im Oktober 1943 ihrer Schwägerin mit.
"Ich werde weiter tapfer sein und fest die Zähne zusammenbeißen"
Mittlerweile hat der Krieg auch die Restfamilie eingeholt. Gerhard, der 16-Jährige, muss als Luftwaffenhelfer Dienst tun. Viele Nächte müssen seine Schwestern im Luftschutzkeller zubringen. Am Abend des 22. Oktober 1943 legen britische Bomber die Kasseler Altstadt in Schutt und Asche; auch die Wohnung der Jahns brennt vollkommen aus. Den Kindern gelingt die Flucht aus dem Inferno. "Ein wahnsinniger Funkenregen umgab uns. Hannele und Eva trugen die Decken und Koffer ... und ich unser teuerstes Gut, unser Dorle. Dieser Lauf durch Feuer und Hitze war ein Lauf fürs Leben durch den Tod", so schildert Ilse der Mutter das traumatische Erlebnis dieser Bombennacht.
Anfang November 1943 richtet Lilli einen verzweifelten Hilferuf an ihren "Amadé": Er möge doch in ihrer Sache ein Gesuch an die Gestapo richten. "Ihr ahnt nicht, was ich seelisch und sonst auch aushalte und durchmache, und doch ist es nichts gegen diese quälende Angst und Sorge, ob ich überhaupt wieder rauskomme." Doch offensichtlich hat Ernst Jahn nichts unternommen; ob er durch eine Intervention das Schicksal Lillis noch hätte beeinflussen können, ist allerdings auch zweifelhaft.
Im März 1944 entschied die Kasseler Gestapo, Lilli mit einem Sammeltransport ins Vernichtungslager Auschwitz zu schicken. Während einer Zwischenstation in Dresden am 21. März konnte Lilli ihrer Familie noch eine Nachricht zukommen lassen: "Morgen abend werden wir dann in Auschwitz sein. Die Mitteilungen darüber, wie es dort sein soll, sind sehr widersprechend ... ich werde weiter tapfer sein und fest die Zähne zusammenbeißen und an Euch denken und durchhalten, wenn's auch noch so schwer sein wird."
Ob Lilli wusste, was sie in Auschwitz erwartete? Geahnt hat sie es wohl. Nur noch einmal erhalten die Kinder ein Lebenszeichen - einen Brief aus Auschwitz Birkenau von Anfang Juni 1944 an die Schwägerin, den Lilli selbst schon nicht mehr hat schreiben können (sondern wohl einer Leidensgenossin diktiert hat), offenbar weil sie schon zu geschwächt war: "Meine Gedanken sind ununterbrochen immer bei Euch." Wenige Tage später kommt die Nachricht von ihrem Tode.
Martin Doerry beschränkt sich auf die Rolle des Chronisten. Er lässt, wo immer das möglich ist, die Dokumente selbst sprechen und begnügt sich im Wesentlichen mit verbindenden und erläuternden Kommentaren. So wohltuend diese Zurückhaltung ist - manchmal hätte man sich doch noch nähere Informationen gewünscht, etwa über den Antisemitismus in der Weimarer Republik oder das System der Zwangsarbeit im "Dritten Reich".
Man legt dieses bewegende, aufwühlende Buch mit einer großen Frage aus der Hand: Wie konnte Ernst Jahn nach 1945 weiterleben - im Bewusstsein, seine Frau den Nazischergen ausgeliefert zu haben?
![]()
Donnerstag, 8.8.2002
Ums Leben schreiben
Die Briefe der Lilli Jahn und ihrer Kinder: Zeugnisse der
vollkommenen Zuständigkeit für die deutsche Geschichte / Von Martin Walser
MARTIN DOERRY (Hrsg.): „Mein verwundetes Herz“. Das Leben der Lilli
Jahn 1900 – 1944. Deutsche Verlagsanstalt, München und Stuttgart 2002. 350
Seiten, 24,90 Euro.
|
Alles, was in diesem Buch geschieht, ist wirklich geschehen. Und doch wird wahrscheinlich mancher Leser beim Lesen dieses Buches unwillkürlich an etwas Romanhaftes oder Filmhaftes denken. Nicht was die erfahrungsverbürgende Gegenständlichkeit, die Situationsgenauigkeit angeht, aber wie das Ganze gefügt ist. Die Konstellation der Figuren, der Verlauf –, das ist so krass demonstrativ, so schreiend grell, dass es mir immer wieder um meiner selbst willen lieber gewesen wäre, das wäre erfunden gewesen; von einem Autor oder Regisseur erfunden, um auszudrücken, wie entsetzlich es unter der Naziherrschaft zugehen konnte. |
|
Also erfunden aus den anerkennenswerten Motiven. Es wäre letzten Endes tröstlich, wenn man sich beim Lesen auf so einen Kunstvorbehalt zurückziehen könnte. Andererseits würde ich, wenn ich das als Roman läse, protestieren. Es sei denn, der Autor könnte in allem, was er erzählt, seinen persönlichen Anteil, Erfahrungsanteil, nachweisen. Dass sich einer nur diesen schlimmstmöglichen Stoff aneignet und dann handwerklich lobenswert damit umgeht, würde mich eher abstoßen. Ich würde nie den Stalingrad-Roman eines Autors lesen, der sich eingearbeitet hat. Die Ausgrabungen Walter Kempowskis aber schon. Der Anteil der Erlittenen kann, je schlimmer das Erzählte ist, um so weniger ersetzt werden durch Kunst.
„Mein verwundetes Herz“ ist ein Buch, in dem etwa 250 Briefe zu lesen sind, die von den Töchtern Ilse, Johanna und Eva und von dem Sohn Gerhard an ihre Mutter Lilli geschrieben worden sind. Dorothea, genannt Dorle, die vierte Tochter, geboren 1940, konnte, als das Schlimmste passierte, noch nicht schreiben. Die Mutter war von September 1943 bis März 1944 im „Arbeitserziehungslager“ Breitenau (südlich von Kassel) und ab März 1944 in Auschwitz inhaftiert. Im Oktober 1944 wird den Kindern mitgeteilt: „Die Ärztin Lilli Sara Jahn geborene Schlüchterer – glaubenslos –, wohnhaft Kassel, Motzstr. 3, ist am 19. Juni 1944 um 11 Uhr 25 Minuten in Auschwitz, Kasernenstraße, verstorben.“ Lilli durfte, solange sie Gefangene war, nur einmal im Monat schreiben. Sie hat im Lager Breitenau noch auf Packpapier oder auf die Rückseite von Medikamenten-Banderolen schreiben und das Geschriebene auf illegalem Weg hinausbefördern können.
Lilli, Jahrgang 1900, Tochter einer Kölner jüdischen Kaufmannsfamilie, studierte Medizin, schloss 1924 ab, heiratete 1926 als Dr. Lilli Schlüchterer den gleichaltrigen Ernst Jahn, auch Arzt, nicht promoviert. Von 1927 bis 1940 fünf Kinder, 1942 lässt sich der Ehemann Ernst scheiden, heiratet nach ein paar Wochen eine jüngere Ärztin, arbeitet als Lazarettarzt in Kassel und Umgebung.
Als Ehefrau eines nichtjüdischen Deutschen war Lilli noch geschützt. Aber es gab eine Verordnung, dass auch geschiedene Partner aus einer „Mischehe“, sollten die Kinder noch nicht achtzehn sein, vor Deportation geschützt seien. Lilli und die Kinder wurden 1943 durch behördliche Barbarei aus ihrem Haus in Immenhausen (nördlich von Kassel) vertrieben, zogen in Kassel in die Motzstraße. Als provisorisches Namensschild brachte Lilli an der Wohnungstür ihre Visitenkarte an: „Dr. med. Lilli Jahn“. Damit verstieß sie gegen die 1938 erlassene Verordnung, dass jüdische Frauen ihrem Vornamen immer „Sara“ zuzufügen hätten. Und sie hätte ihren Doktortitel nicht mehr führen dürfen. Jemand denunzierte, Lilli wurde vernommen, darf wieder heim, Gestapobeamte durchsuchen die Wohnung, kein Ergebnis, Lilli wird noch einmal vorgeladen, ruft ihren Töchtern (Sohn Gerhard ist schon bei der Heimatflak) „Bis gleich, Kinder“ zu, geht und kommt nicht mehr zurück. Nie mehr. Dann also die Briefe. Mehr hin als her.
Daraus entsteht fast sechzig Jahre später dieses Buch. Ich habe mich gründlich beschäftigt mit der von Viktor Klemperer in umfangreichen Tagebuchbänden hinterlassenen Geschichte der Familie Klemperer. Das Prinzip Genauigkeit habe ich genannt, was diese Tagebücher zu einer einzigartigen Quelle macht für die deutsche Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 und darüber hinaus. Viktor Klemperer hat gewusst, dass er ein Geschehen mitnotierte, das wegen seiner Ungeheuerlichkeit mitnotiert werden musste. Und er hat es durch seine rücksichtslose Genauigkeit zur vollkommenen Glaubwürdigkeit gebracht. Auf einem ganz anderen Weg hat Rudolf Borchardt als Briefschreiber auch einen solchen Grad an Glaubwürdigkeit erreicht. Ich habe es bei ihm genannt „Sprachenergie“, „Geschichtsmächtigkeit“, „Formulierungswut“, und „Verantwortungsernst“.
Jetzt also Lilli und ihre Kinder und dieser Verlauf. In keiner Zeile dieser Briefe gibt es auch nur die geringste stilistische oder literarische Ambition. Ilse, Johanna, Eva und Dorothea sind vierzehn, dreizehn, zehn und drei Jahre alt, als diese Briefe geschrieben werden. Gerhard, von dem die wenigsten Briefe sind, ist sechzehn. Und Lilli ist in ihren Briefen so von der Gewalt der Entwürdigung, des Leidens und von der Sorge und Angst um ihre Kinder gequält, dass sich alles Formulieren verbietet. Aber was ihr zugemutet wird, ist schon vor der Einweisung ins „Arbeitserziehungslager“ und vor der Deportation nach Auschwitz schlimm.
In ihrem Haus bringt die jüngere Kollegin das Kind zur Welt, dessen Vater ihr Ernst Jahn ist, den Lilli Amadé nennt. „Mein Amadé, mein lieber, kleiner Amadé“. Ihr Mann und sie leisten Geburtshilfe. Weil ihr Amadé seine gut gehende Praxis in Immenhausen nicht aufgeben wollte, wurde das durch Verwandte in England zugesagte Affidavit nicht in Anspruch genommen. Sie hätten, wie Lillis Mutter und Schwester, entkommen können. Ein Freund und Rechtsanwalt warnt Ernst Jahn vor dem, was trotz all der schutzversprechenden Regelungen der nach der Scheidung ungeschützten Frau passieren kann.
Lilli versuchte einer Freundin zu erklären, warum Amadé eine andere Frau finden musste. Eine Frau, die ihn wieder zurückführte zu sich selbst. Lilli will nicht, dass ihre Freundin Amadé verurteile. Es sei ihm weder „Herzlosigkeit noch Schlechtigkeit“ vorzuwerfen. Sie selber, gesteht sie, sei „im Innersten grenzenlos einsam und verlassen“. Gegen diese Seelenkraft verblassen auch die edelsten Menschlichkeitsgesten eines Thoas, einer Iphigenie. Man darf das, ich weiß es, nicht aneinander messen.
Dann die Verhaftung. Da verschlägt es Lilli das „innere Atemholen, weil die Schicksalsschläge“ gegen sie „gar nicht abreißen wollen“.
Als Ilse, die Vierzehnjährige, zum zweiten Mal bei der Gestapo erscheint, um zu fragen, wann die Mutter wieder heimkommen dürfe, kriegt sie zu hören: „Wenn du nochmals kommst, behalten wir dich auch hier.“ Weil Lilli fürchten muss, dass sie ihrem „Dorlekind“ am dritten Geburtstag den Geschenktisch wahrscheinlich nicht richten kann, schreibt sie, dass Dorles „große Geburtstagskerze und drei Taschentüchlein... im vorderen Flurschrank im untersten Fach und ein paar Bonbons im Buffet (Mitte)“ sind. Den Vati sollen die Kinder sehr lieb grüßen. Wie wohl täte ihr „ein gutes und tröstliches Wort von ihm, aber das wird wohl nicht gehen“. Zeitungen sollen sie ihr schicken, ein Buch, „vielleicht den ,Nachsommer‘ von Stifter“. Und vielleicht noch „vom Bücherbrett ein weniger wertvolles Buch“ für ihre „Saalkameradinnen“.
So füllt, was ihr alles fehlt, allmählich die Briefe. Und was fehlt, wird zum Dokument unserer Schande. Nagelfeile, Pinzette, Vasenolpuder, Schlämmkreide, Pantoffeln, Puddingpulver. „Und sobald wie möglich Camelia“. „Und dann, wenn es Euch möglich ist, hin und wieder etwas Brot, ein bisschen Salz, vielleicht habt ihr ein wenig Käse übrig oder Marmelade, und legt mir eines von den alten silbernen Messern (rechte Schublade) bei.“
Warum, fragt man sich, muss das vom Staat angerichtete Verbrechen an Ort und Stelle so grausam exekutiert werden! Und dieser grauenhafte Erfüllungseifer ist das wirkliche Lehrstück. So sind wir, wenn man uns lässt. Wenn man uns auch einmal Macht haben lässt. Am Sonntag ist es am schlimmsten. „Da gibt es 1/2 7 Uhr morgens ein Stück trockenes Brot und diese elende Kaffeebrühe, um 11 Uhr entweder dünne Suppe oder Pellkartoffel, Sauce und Gurke und um 4 Uhr wider ein Stück Brot, abwechselnd mit etwas Wurst oder einem Löffel Quark und dazu Kaffee und dann wieder nichts mehr bis zum anderen Morgen.“
Haarnadeln, Weckgläser, Mikado, Zahnpasta, schwarze Schuhcreme, Molton- Decke, Gamaschen-Hosen, Wintersachen, Stoffärmel, Strickkleidchen, Pflaumenmus, Honigkuchen, Faltenrock, Flickreste, Wollkleid. Das ist die Gegenständlichkeit dieses Elends. In dieses Vegetieren im „Arbeitserziehungslager“ schreiben die Kinder ihre Briefe.
Ilse, die Vierzehnjährige, und Johanna, die Dreizehnjährige, Ilsemaus und Hannelekind sind es, die jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag schreiben. Aber es ist ja viel mehr als Schreiben. Sie leben auf ihrem Briefpapier. Statt Auf Wiedersehen schreibt Ilse „Auf Wiederlesen bis morgen Abend.“ Auch der sechzehnjährige Gerhard schreibt. Er ist Luftwaffenhelfer. Die Angriffe auf Kassel haben begonnen. Gerhard schreibt: „Wir haben sogar einen viermotorigen Bomber abgeschossen. Da kannst du dir sicher vorstellen, wie wir uns gefreut haben.“ Zu Jungvolk und HJ war Gerhard als „Halbjude“ nicht zugelassen, jetzt gehört er endlich dazu. Diese Dissonanz repräsentiert den Ton dieser Jahre vollkommen. Die Bomber, auf die Gerhard schießt, zertrümmern die Stadt, in der die vier Schwestern untergekommen sind. Hannele meldet ihrer Mutter, dass sie sich entschlossen habe, Hansi (ihren Wellensittich) oben zu lassen und die Geige mit runterzunehmen. Beides kann sie nicht tragen, weil sie noch die „Luftschutztasche“ mitnehmen muss. Und schreibt: „Äußere Dich bitte mal darüber, wie Du das findest. Ich bin mir selber nicht klar. Das Tierchen lebt doch, spürt und hat Angst. Die Geige ist aber auch so eine Sache. Sie ist mir auch sehr lieb.“ Und Hannele ist dreizehn!
Das Haus verbrennt, und Hansi mit ihm. Die Kinder müssen raus aus dem Keller, sie rennen, schreibt Ilse dann, durch einen „wahnsinnigen Funkenregen“ in den nächsten Bunker. „Hannele und Eva tragen die Decken und Koffer .. . und ich unser teuerstes Gut, unser Dorle“. Wann immer jetzt die Flak zu schießen beginnt, sagt Dorle: „Ille, aber nicht wieder durch das Feuer laufen. “ Und Gerhard ist stolz auf seine Beförderung zum „Luftwaffenoberhelfer“. Ilse wird sozusagen von heute auf morgen die Mutter ihrer drei Schwestern. Wenn sie einmal durch „Einsatz“ oder Schule ausfällt, wird Hannele „Vizemama“. Die Vierzehnjährige schreibt auch die meisten Briefe, spendet der eingesperrten Mutter am spürbarsten Leben. Und was und wie sie berichtet, erzählt mir von der Wirklichkeit der Diktatur mehr als ein Historiker darstellen kann.
Wenn es schellt, denkt sie, Mutti stehe vor der Tür. „Mir war ein so seltsames Gefühl wie noch nie.“ Aber: „Es war Frau Kunze.“ Und am Mittwoch früh war sie mit Dorle „wieder bei Brandau, wegen der Einlagen für ihre Senkfüßchen. Dorles Zöpfe sind schon gewachsen, und Dorle fragt auch oft: Wann kommt Mutti?“ In der Schule muss Ilse zur gleichen Zeit einen Aufsatz schreiben über das Thema: „Die deutsche Treu in Lessing Minna von Barnhelm.“
Jede Tochter erzählt der Mutter ihr Leben. Die Zehnjährige Eva ist in ihrer freien Zeit am liebsten auf einem Bauernhof, arbeitet richtig mit, kriegt dann eine Wurst geschenkt, „für Dich, beste Mutti“. Und unterschreibt: „Viele liebe Millionen Grüße und Küsse von Deiner Bauerntochter, Eva.“ Dieses Komma der Zehnjährigen zwischen den letzten zwei Worten darf man mit einer Art ästhetischer Rührung zur Kenntnis nehmen. Aber Ilse! Wie sie ihre Entwicklung von September 43 bis in den Sommer 44 dokumentiert, ausdrückt, spüren lässt!
Spüren lässt, das entspricht wohl am meisten dieser Intensität durch Andeutung. Einerseits bleibt sie die innig grüßende und küssende, die das „Muttileinchen“ „lieb festhaltende“ „Ilsemaus“; andererseits schreibt sie: „Nun lass Dich so fest drücken und liebhalten, Dir einen festen Kuss geben von Deiner Dich nie vergessenden Freundin Ilsekind.“ Was für eine Synergie der Zärtlichkeit. Das darf niemand riskieren, der es nicht ist. „Sei nicht gar zu traurig. Denk an meinen Brief von gestern, Schatz.“ Und dann, spät abends, wieder ganz die Mutter ihrer Schwestern: „Jetzt ist endlich Ruhe. Die drei schlafen. Gleich gehe ich auch ins Bett. Aber erst gehe ich noch ans Fenster und sehe in Richtung nach Breitenau zu Dir. Wann wird wohl der Tag kommen?“ Daneben: „nervenaufpeitschender Alarm“; eine „Unmenge“ zu tun für die Schule; die „Bezugscheine“ für Gerhard; die Altstadt, inzwischen „ein großer Schutthaufen“; und sie soll noch einen Aufsatz schreiben über das Thema „Was bedeuten Dir Umgangsformen?“
An die Schwägerin schreibt die Mutter so: „Könnt ihr denn bei der Gestapo nicht erfahren, wie lange ich noch fortbleiben muss? ... Das Haus ist auch noch nicht geheizt. Und überhaupt dies Eingesperrtsein. Das weiß keiner, was das heißt. Ob Ernst nicht mal ein Gesuch machen kann. . . Er kann doch wohl noch einmal etwas für mich tun? Ich bin ohnehin so verlassen und zurückgestoßen!“ Verhaftet wegen eines Verstoßes gegen die Polizei-Verordnung, darauf stehen vier Wochen, die sind längst um. „Vielleicht kann das Gesuch durch die vorgesetzte Militärbehörde unterstützt werden.“
Und den Kindern schreibt sie, dass man einander sehen könnte, wenn Ilse und die Schwägerin in Malsfeld in den Zug einsteigen würden, mit dem sie jeden Tag zur Arbeit fährt und von der Arbeit zurück. Zwanzig Minuten. „Aber ihr müsst sehr vorsichtig sein ... und Euch und mich nicht verraten.“ Ilse könnte ihr im Tunnel vor Guxhagen ein Paket aushändigen, vielleicht mit Tabletten gegen ihre Schmerzen in den Armen und Händen. Daraus wurde, weil es zu riskant gewesen wäre, nichts. „Oh das war ein seltsames Thema“ schreibt Ilse dann über die „Umgangsformen“. „Ich habe über die Sitten: Hutabnehmen, die Dame rechts gehen lassen, das Alter achten und so weiter ... 4 Seiten lang geschrieben.“ Und hofft, sie bekommt eine „annehmbare Note“.
Tatsächlich darf Ilse ihre Mutter am 12. Dezember 1943 besuchen. Zehn Minuten lang! Mit Wärterin. Dass der Mutter ein Schneidezahn fehle, hat sie schon gewusst, jetzt sieht sie es. Im Januar erfährt Lilli, dass Ernst ein Gesuch um ihre Freilassung eingereicht hat. Sohn Gerhard wird„gemustert“ und meldet der Mutter: „Ich natürlich kriegsverwendungsfähig ErsatzreserveI, schnelle Truppe.“ Und Ilse wiederum beschreibt der Mutter haargenau, wo alles liegt und steht im Zimmer: „Rechts neben der Kommode steht ein kleines Puppenbettchen mit einem Männlein und einem Weiblein. An dem Bettchen steht , Stilles Glück‘.“ Aber sie meldet auch die erste Zigarette, die sie geraucht hat und hofft, die Mutter schimpfe nicht. Über die Umgangsformen hat es nur zu einer Vier gereicht.
Die Mutter schreibt: „Der Vater soll doch noch mal hingehen zur Stapo und darauf bestehen, dass ich endlich frei komme. Und er soll ganz bald hingehen! Bitte, bitte, bitte!“ Im März 1944: die Deportation. Nach Auschwitz. Der Brief, geschrieben am 21. März 1944 während eines siebenstündigen Aufenthalts im Bahnhof Dresden, ist schon Lillis Vermächtnis. Über Auschwitz kursieren Nachrichten. „Die Mitteilungen darüber, wie es dort sein soll, sind sehr widersprechend.“ Sie werde weiter tapfer sein, es beruhige sie zu wissen, dass der Vati sich um die Kinder sorge und sie sehr lieb habe. Und dem Vati lässt sie bestellen: „Er selbst und niemand anders soll nochmals alles versuchen, und wenn er sich bis an die höchsten Stellen nach Berlin wendet.“ Zuletzt nennt sie alle noch einmal mit ihren Zärtlichkeitsnamen: „Gerhard- Junge, Ilsemaus, Hannelekind und mein Dorle-Schatz! Gott behüte Euch! Wir bleiben unlöslich miteinander verbunden. Seid herzinniglich gegrüßt und geküsst von Eurer treuen Mutti.“
Dann die Sterbe-Urkunde.
Martin Doerry, Lillis Enkel und Ilses Sohn, hat dieses Buch herausgegeben und das dazugeschrieben, was die Briefe zeitgeschichtlich und ortskundlich ergänzt. Dass, zum Beispiel, der Sohn Gerhard später bei Willy Brandt Justizminister war. Die Gegenständlichkeit, die durch diese Briefe entsteht, hat ganz unmittelbar einen historischen Rang. Und eine Wirkung, die ein Roman nicht haben kann. Und eine Aussagekraft, die eine Darstellung durch einen Historiker nicht erreichen kann. Der bleibende Lese-Eindruck ist: vollkommene Glaubwürdigkeit. Der Meinungsanteil in diesem Buch ist überhaupt Null. Die Sätze der Briefe entstehen aus Notwehr. Und nicht nur Notwehr für den jeweils Schreibenden, sondern Notwehr für den anderen. Lilli und Ilse geben den Ton an. Aus Sehnsucht, aus Liebe, aus Not.
Genauer kann eine Mitteilung über dieses Deutschland in den Zeiten des Nazismus nicht sein. Das Personal der Diktatur wird durch seine Wirkung auf diese Familie vollkommen deutlich. Es gibt keine Darstellungsabsicht, deshalb ist das Dargestellte so glaubwürdig. Alle schreiben aus nichts als persönlicher Not. Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen. Das ist doch Geschichtsschreibung. Wenn ich das lese, kommt mir der Unterschied, den der Jargon macht zwischen Quelle und Schreibung, irreführend vor. Das ist Geschichtsschreibung, wie Klemperers Tagebücher und Borchardts Briefe Geschichtsschreibung sind. Es ist ein Buch der vollkommenen Zuständigkeit für diese deutsche Geschichte.
„Oh das war ein seltsames Thema“, schreibt die vierzehnjährige Ilse, als sie in dieser Situation den Aufsatz über „Umgangsformen“ schreiben soll. Diese Kinder und ihre Mutter sind ganz unwillkürlich vehemente Stilisten. Sie sind mitten im Grauen immer zart und immer zärtlich. So kommen Sprachdenkmäler der Menschlichkeit zusammen. Wenn diese Kinder, diese Erwachsenen nicht so hingebungsvoll, so liebevoll Buch geführt hätten, ohne zu wissen, dass sie das tun, wenn sie nicht Erleidende einer familiären Tragödie geworden wären, in der die politischen Bedingungen der Zeit krass zum Ausdruck kamen, unwillkürlich zum Ausdruck kamen, dann hätte dieses Buch nicht erscheinen können. Sie schrieben um ihr Leben, wir erkennen darin unsere Geschichte.
Martin Walser weist darauf hin, dass er diese Rezension verfasste, bevor die Debatte über seinen Roman „Tod eines Kritikers“ anhob.

Rezension
Kaum 30 Kilometer entfernt und doch unerreichbar
Von Eva Menasse
10. Aug. 2002 Ein
schweres Erbe hat der sozialdemokratische Politiker Gerhard Jahn, unter Willy
Brandt Bundesjustizminister, seinen Schwestern hinterlassen, als er vor vier
Jahren starb: ein Konvolut von 250 Briefen, die die Jahn-Geschwister als Kinder
in den Jahren 1943 und 1944 an ihre inhaftierte jüdische Mutter geschrieben
haben. Niemand hatte gewußt, daß diese Briefe noch existierten, und niemand
weiß, warum Gerhard Jahn sie lebenslang bei sich behalten, man könnte auch
sagen: seinen Geschwistern vorenthalten hat. Diese plötzlich wiederentdeckten
Briefe setzten nun bei den vier Schwestern einen Erinnerungs- und
Aufarbeitungsprozeß in Gang, der in seiner Schmerzlichkeit und Wucht wohl
unvorstellbar ist. Denn ihre Mutter Lilli Jahn wurde in Auschwitz ermordet.
Der Fund zog weitere Nachforschungen nach sich; nach und nach fand die Familie bei sich und anderen weitere dreihundert Briefe, darunter unzählige von Lilli Jahn selbst, die ihr Leben lang eine leidenschaftliche Briefschreiberin gewesen ist. Nun hat ein Enkel Lilli Jahns, der stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteur Martin Doerry, diese Briefe im Sinne der Familie veröffentlicht. "Mein verwundetes Herz - Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944" ist eine wahre Entdeckung, ein großes, ergreifendes Dokument über eine private Katastrophe inmitten der politischen.
Klug und bedachtsam schreibt Doerry in der Einleitung davon, daß die meisten autobiographischen Zeugnisse über den Holocaust naturgemäß von Überlebenden stammen. Wer "die dialektische Bedeutung solcher Berichte nicht begreifen kann oder will", für den ergäbe sich eine "merkwürdig verzerrte Bilanz: Es entsteht das Bild einer Schreckensherrschaft, der die meisten am Ende doch entronnen sind". Eine große Ausnahme - und daher rührt nicht zuletzt seine weltweite Bedeutung - ist das Tagebuch der Anne Frank. In Wirkung und Aussagekraft lassen sich die zärtlichen Briefe der fünffachen Mutter Lilli Jahn und ihrer Kinder mit den jugendlichen Bekenntnissen des Mädchens Anne Frank umstandslos vergleichen. Beide Dokumente reden vom Warten und Hoffen, von der Angst und ihrer Alltäglichkeit. Und weil diese Dokumente so dezidiert privat sind, machen sie aus dem unbekannten Opfer einen Menschen, dem man sich nahe fühlt und dessen sinnloser Verlust einem schier unerträglich wird.
Doerry ist bei seiner Arbeit bewundernswert pietätvoll vorgegangen. Die lautere, streng dokumentarische Art, mit der er Originalbriefe und erzählende Passagen verbindet, führt unversehens zu einer eminent literarischen Wirkung, da nämlich die Form den Inhalt widerspiegelt: Solange es ihr möglich ist, spricht Lilli Jahn selbst. Der erste Teil des Buches ist dominiert von den schwärmerischen, intellektuell anspruchsvollen Briefen ihrer Jugend und frühen Erwachsenenzeit, von Berichten über Lektüre- und Theatererfahrungen, vom hochfliegenden geistigen Austausch mit dem innig geliebten späteren Mann Ernst Jahn und verschiedenen Freunden.
Unter dem Druck der Repressionen und weil bald die meisten Freunde und Familienmitglieder geflüchtet oder deportiert sind, werden auch Lillis Briefe seltener und bedrückter. Gegen Ende, im Arbeitslager Breitenau bei Kassel, in dem sie, kaum dreißig Kilometer entfernt und doch unerreichbar für ihre Kinder, sieben Monate gefangengehalten wird, verstummt die so Beredte, Belesene gezwungenermaßen fast ganz. Dafür schwellen die herzanrührenden Kinderbriefe wie ein Chor an. Oft zweimal täglich schreiben die drei ältesten Mädchen ihrer Mutter ins Lager, bemüht um Normalität und Aufmunterung. Es sind Berichte vom Strümpfestopfen, Schularbeiten-Machen, vom Organisieren der Lebensmittel oder vom Tod eines geliebten Wellensittichs im Bombenhagel. Dieser zweite Teil mit seiner Flut von Alltäglichkeiten läßt nachempfinden, wie quälend und gleichförmig die sieben Monate ohne Mutter waren, in denen die Kinder immerhin noch die Hoffnung hatten. Wie ein Symbol für ihren Niedergang hat die hochgebildete Ärztin Lilli übrigens ihren allerletzten Brief nicht mehr selber geschrieben; sie hat ihn, zum Schreiben vermutlich schon zu schwach, in Auschwitz-Birkenau jemandem diktiert, der kaum richtig Deutsch konnte.
Leider, und das macht die Lektüre fast unerträglich bitter, ist das Schicksal der Lilli Jahn auch ein Lehrstück über die aktive Mitwirkung der sogenannten Nächsten an der Vernichtungspolitik. In der Fachliteratur geht man davon aus, daß sich viel mehr "arische" Männer von ihren jüdischen Frauen scheiden ließen als im umgekehrten Fall. Ein Mitarbeiter der von Eichmann gegründeten "Zentralstelle für jüdische Auswanderung" in Wien sagte nach 1945 aus: "Ich habe Fälle erlebt, da sind die ,arischen' Männer gekommen und haben gesagt: ,Holt's mei jüdische Frau.'" Man soll sich nichts vormachen: In jener Zeit, als Scheidung eigentlich eine gesellschaftliche Unmöglichkeit war, kamen manchen die Rassengesetze sehr gelegen. Andererseits hat erst jüngst Nathan Stoltzfus' Buch über die Frauen der Rosenstraße gezeigt, wieviel die Courage und der offene Protest von in "Mischehen" lebenden Deutschen bewirken konnten: Die anhaltenden Demonstrationen der "arischen" Frauen im Frühjahr 1943 veranlaßten das Regime, Hunderte jüdische Ehemänner wieder freizulassen, fünfundzwanzig davon wurden gar aus Auschwitz zurückgeholt. Auch vor diesem Hintergrund muß man "Mein verwundetes Herz" lesen: "Als der Krieg zu Ende war, machten mit Deutschen verheiratete Juden 98 Prozent der überlebenden jüdischen Bevölkerung Deutschlands aus", so Stoltzfus.
Und hierin liegt die Tragödie der Lilli Jahn, jene Tragödie nämlich, die sie selbst noch klar zu erkennen vermochte: daß sie ihre Liebe und ihre Leidenschaft einem Mann geschenkt hatte, der dafür viel zu klein war. Die stürmische, temperamentvolle Lilli Schlüchterer hatte den schwermütig-labilen, in allem zaudernden Ernst Jahn in den zwanziger Jahren zur Ehe geradezu überredet - beinahe war das schwieriger, als die eigenen, diesbezüglich traditionellen Eltern zur Zustimmung zu einem christlichen Schwiegersohn zu bewegen.
Ende 1942, obwohl von Freunden vielfach gewarnt, ließ dieser Ernst Jahn sich scheiden, ungeachtet der offensichtlichen Gefahr, ungeachtet der sechzehn gemeinsamen Jahre und der fünf Kinder, die Jüngste gerade zwei Jahre alt. Er hatte sich in eine junge Aushilfsärztin (Lilli durfte als Jüdin in der gemeinsamen Praxis nicht mehr behandeln) verliebt und sie geschwängert; bei der Geburt dieses Kindes im eigenen Haus leistete Lilli unvorstellbarerweise noch Geburtshilfe. Erst lebten Lilli und die Kinder trotz Scheidung weiterhin bei Ernst Jahn im hessischen Immenhausen, dann sorgte der engagiert rassistische Bürgermeister dafür, daß die Jüdin samt ihren Kindern verschwinden mußte. Lilli und die Töchter zogen nach Kassel, Gerhard, der Älteste, war inzwischen Luftwaffenhelfer und selten zu Hause.
Martin Doerry richtet nirgendwo über seinen Großvater Ernst. Er hat die verführerische Möglichkeit ausgeschlagen, die vier Töchter öffentlich zu einer heutigen Beurteilung ihres Vaters zu nötigen. Statt dessen beharrt er gerade auch hier auf den viel stärkeren Stimmen der Zeit. Lilli selbst, bis in den Tod loyal, hat im bestürzendsten Brief dieses Buches eine gemeinsame Freundin noch angefleht, Ernst Jahn nicht zu verurteilen. Sie schrieb den Fehler sich selbst zu, die rassistische Propaganda geradezu übernehmend, daß Ernst, der Protestant mit starker Neigung zu Katholizismus und Marienverehrung, eine Frau nach seiner Art brauche, denn sie habe ihm nie alles geben können.
Weitere Dokumente erzählen ganz von selbst Unfaßbares über Ernst Jahn. Nach Lillis Verhaftung Ende August 1943, als die Töchter im Alter zwischen vierzehn und zwei Jahren allein in Kassel saßen, rief eine Freundin mit Gestapo-Verbindungen in Immenhausen an und bat den Vater, seine verwaisten Kinder zu sich zu holen, da sie sonst auch in ein Lager kommen würden. Ernst Jahn lehnte ab; er wisse nicht, ob seiner zweiten Frau das recht wäre. Zwar haben sich Jahn und seine zweite Frau in der Folge um die Kinder gekümmert, sie schließlich, nachdem sie in Kassel ausgebombt worden waren, auch wieder zu sich geholt, doch wurden die Beziehungen zwischen der Frau und Lillis Kindern bald offen feindlich. Und selbst Lilli beschlich in ihren letzten Briefen der Verdacht, daß der Mann, den sie immer noch liebte, es nicht wagte, sich bei den Behörden mit Nachdruck für die Mutter seiner Kinder einzusetzen.
Wie die Kinder nach dem Krieg zu ihrem Vater standen, darüber geht Doerry mit diskretem Schweigen hinweg, so wie er überhaupt jede Dramatisierung klug vermeidet und gerade damit höchste Wirkung erzielt. Die Kinder hatten eben nur noch diesen Vater, der, wie es nur einmal zurückhaltend heißt, "bis zuletzt um die Liebe und das Verständnis seiner Kinder warb". Hinweise auf ein prekäres Verhältnis finden sich nur hier und da: So wollte Gerhard nach Kriegsende die Stiefmutter verklagen, ganz so, als wäre nicht der Vater verantwortlich. Seine Schwester Ilse, Doerrys Mutter, verhinderte diese Eskalation. Erst zwei Jahre nach Ernst Jahns Tod ließ Gerhard Jahn 1962 im Märtyrerwald von Yad Vashem zwei Bäume für seine Mutter pflanzen. Dem Vater hat er das wohl bewußt erspart.
Den ganzen Krieg über lebten Lillis Kinder in der schizophrenen Situation der "Mischlinge": Sie litten unter den Diskriminierungen und wollten um so mehr zum deutschen Volk "dazugehören". Gleichzeitig standen vor allem die Töchter solidarisch zur Mutter, deren Verhaftung sie aber ganz kindlich als Naturkatastrophe hinnahmen und nicht als Untat eines Verbrecherregimes begriffen. Noch im Zwangsarbeiterlager war absurderweise Lilli stolz auf ihren Sohn, den Luftwaffenhelfer: Sie wußte, wie schwer es Gerhard getroffen hatte, als "Mischling" nicht in die Hitlerjugend zu dürfen.
Die Älteste,
Ilse, übernahm wie selbstverständlich die Mutterrolle, vor allem für die
Kleinste, die erst zweijährige Dorothea. Zweimal ging sie bittend zur Gestapo,
bis man ihr drohte, sie beim nächsten Mal auch dazubehalten. Ein einziges Mal
konnte sie Lilli in Breitenau besuchen, zwei- oder dreimal reiste Ilse danach
unerkannt in jenem Zug, mit dem die Zwangsarbeiterinnen zur Arbeit fuhren. So
sah sie aus der Ferne zum letzten Mal ihre Mutter. Für Doerrys Buch haben die
drei älteren Töchter Ilse, Johanna und Eva nun alle ihre alten Briefe ins reine
geschrieben und sich, so viele Jahrzehnte später, ihren eigenen hilflosen
Gefühlen als von der Mutter gewaltsam getrennte Kinder noch einmal völlig
ausgesetzt. Man kann ihnen das, mit tiefem Respekt, gar nicht genug danken.
Martin Doerry (Hrsg.): "Mein verwundetes Herz". Das Leben
der Lilli Jahn 1900-1944. Deutsche Verlags-Anstalt, München und Stuttgart 2002.
351 S., geb., 24,90 [Euro].
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.08.2002,
Literatur (Feuilleton), Seite 40
Bildmaterial: DVA

10-08-2002
"Mein Mann war arisch, ganz arisch!"
Von Cordelia Edvardson
Aus über 500 Briefen hat Martin Doerry das außergewöhnliche Bild einer deutsch-jüdischen Familie gezeichnet Lilli Jahn wurde 1943 verschleppt und 1944 in Auschwitz ermordet. Doch Doerry lässt die Leser ohne jegliche Sentimentalität nicht nur an dem Leben und Leidensweg seiner Großmutter teilnehmen, es ist die Spontaneität, mit der die scheinbare "Normalität" des Lebens der Kinder Lilli Jahns während der letzten Kriegsjahre dargestellt wird, die besonders berühren.
Die vor geraumer Zeit in Festreden noch beschworene, angeblich einst vorhandene "deutsch-jüdische Symbiose" kam mir als Begriff, als Beschreibung eines Sachverhalts schon immer etwas merkwürdig vor. Eine Symbiose, meinte ich, setzt doch eine Gegenseitigkeit voraus. Eine gegenseitige Verquickung und Abhängigkeit. Das Verhältnis der deutschen Juden zu den Deutschen war jedoch eine sehr einseitige Affäre, wie wir heute wissen. Nachdem ich Martin Doerrys Buch "Mein verwundetes Herz" mit dem Untertitel "Das Leben der Lilli Jahn 1900 - 1944" gelesen habe, weiß ich auch, wie dieses verhängnisvolle Verhältnis richtiger zu benennen sei, nämlich: "Die Schizophrenie der deutschen Juden".
Oder sollte man vielleicht sagen "der Deutschen mosaischen Glaubens"? So wollten sich ja viele von ihnen bezeichnen. Sie meinten Deutsche zu sein, so wie ihre Nachbarn deutsche Katholiken oder Protestanten waren, das "hässliche" Wort Juden oder jüdisch wird durch das "unbelastete" mosaisch ersetzt. Der eine oder andere hoffte möglicherweise, dass "mosaisch" in deutschen Ohren zwar unverständlich, aber auch unschuldig klingen würde, wie beispielsweise "Mormonen". Erst als sie gezwungen wurden, den gelben Stern mit dem ganz unmissverständlichen Wort "Jude" zu tragen und an die Wohnungstür zu kleben, wurde ihnen klar, dass sie sich geirrt hatten. Oder doch immer noch nicht?
Wie kein anderes Dokument, das ich gelesen habe, macht Doerrys Bericht über das Leben der Lilly Jahn, später Lilly Sara Jahn, und ihrer Kinder diese Dinge und Geschehnisse unwiderruflich klar. Er stellt, um einen schwedischen Ausdruck zu benutzen, die Kirche und die abgebrannte Synagoge mitten ins Dorf. Das Dorf heißt Immenhausen . Hier lebte und arbeitete die Ärztin Lilly Jahn mit ihrem Ehemann, dem Arzt Ernst Jahn, hier gebar sie ihm fünf Kinder. Aus dem Familienalbum der Jahn s hat Doerry unter anderem zwei sehr aufschlussreiche Bildchen gewählt. Auf dem einen sieht man Vati mit zwei der Kinder vor der Tür des Ärztehauses in Immenhausen. Links und rechts der Tür hängen die Praxisschilder von Lilli und Ernst. Dieses Bild ist von 1931. Auf dem anderen Bild steht Gerhard, der Erstgeborene, auf der Treppe des Hauses, unter einem deutlichen weißen Fleck an der Stelle, wo vorher Lillis Praxisschild angeschraubt war. Dieses Foto ist von 1936. Es muss sehr weh getan haben, als die Schrauben gezogen wurden, ohne Betäubung, und Lilli ihren so sehr geliebten Beruf nicht mehr ausüben durfte. Oder war sie noch immer betäubt? Glaubte sie, dass dies, was jetzt geschah, ein Spuk wäre, der bald vorbeigehen würde? Ja, sie war Jüdin, auch nie zum Christentum übergetreten, aber sie war auch eine sehr beliebte Ärztin, mit einem "Arier" verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Vor allem aber war sie Deutsche. Tief in der deutschen Sprache und Kultur verwurzelt. Hier möchte ich einige Jahre in der Geschichte der Lilli Jahn vorausblicken. Es ist der 17. oder 19. Juni 1944 (Das genaue Datum kann, trotz deutscher Gründlichkeit, nicht festgestellt werden.) Es ist der Todestag von Lilly Sara Jahn in Auschwitz-Birkenau. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt arbeitet Cordelia Maria Sara Hoffmann in der Schreibstube des Todeslagers und wird abkommandiert, um bei der von Doktor Mengele durchgeführten Selektion in einer Baracke des Lagers behilflich zu sein. Es ist ihre Aufgabe, die Häftlingsnummern der von Mengele als "arbeitsunfähig" erklärten, nackten Frauen aufzuschreiben. Sie werden am nächsten Tag "durch den Schornstein gehen", wie man die Vergasung in Auschwitz nannte. Cordelia Maria Sara erfüllt ihre Aufgabe säuberlich und gewissenhaft. Noch ein Arm, noch eine Nummer, aber diesmal auch eine Stimme. Eine weinerliche, bettelnde Stimme: "Ach Fräulein, liebes Fräulein, bitte, bitte schreiben Sie doch, dass ich mit einem Arier verheiratet war. Mein Mann war arisch, ganz arisch!" Es hat der Frau natürlich nichts geholfen. Vielleicht war ihr "arischer" Ehemann verstorben, vielleicht hat er sich, so wie Ernst Jahn, von seiner jüdischen Frau scheiden lassen. Die Scheidung Ernst Jahns von der Jüdin Lilli Sara Jahn, der Mutter seiner fünf Kinder, wurde am 8. Oktober 1942 standesamtlich bestätigt. Wir wissen, dass Lilli bis zum letzten Tag kein schlechtes Wort über Ernst, ihren Amadé, wie er von ihr und im Freundeskreis genannt wurde, hören oder lesen wollte. Im Gegenteil, sie verteidigt ihn und seine Handlungen mit aller Kraft.
Doerrys einzigartiges und zutiefst erschütterndes Buch besteht zum größten Teil aus auf wundersame Weise erhaltenen Briefen. Lillis Briefe an ihren Amadé während der Verlobungszeit, an Freunde und Verwandte und an ihre Kinder. Vor allem aber auch Briefe der Kinder an ihre Mutter, die im September 1943 in das Arbeitserziehungslager Breitenau verschleppt wurde. Im März 1944 wird Lilli von dort nach Auschwitz abtransportiert. Die fleißigste Briefschreiberin ist Lillis älteste Tochter Ilse, ihre "Ilsemaus". Die zur Zeit der Verhaftung ihrer Mutter 14-jährige Ilse wird sehr schnell erwachsen und übernimmt, als wäre es selbstverständlich, die Rolle der stellvertretenden Mutter ihrer Geschwister. Der Vater war zu dieser Zeit als Arzt zur Wehrmacht eingezogen, der älteste, 16-jährige Sohn Gerhard ist, mit offensichtlicher Begeisterung, Luftwaffenhelfer in Obervellmar; auch er wird in rührender Weise von seiner Schwester Ilse bemuttert. Auch wenn sich zeitweise ein Erwachsener um die bis zu ihrer Ausbombung im Herbst 1943 in Kassel lebende Kinderfamilie kümmert, so ist die tägliche Betreuung der Kleinen doch der 14-jährigen Ilse überlassen. Zur Zeit der Inhaftierung der Mutter in Breitenau war ihre Tochter Johanna 13 Jahre alt, Eva zehn Jahre und die kleine Dorothea, das Dorle, drei Jahre. Ilse sorgt nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch und vor allem erfüllt sie das Bedürfnis ihrer Schwestern nach Liebe und Geborgenheit.
Nebenbei geht sie in die Schule, macht Hausaufgaben, schreibt lange Briefe an die Mutter, schickt Päckchen mit selbst gebackenen Plätzchen und anderen Nahrungsmitteln an die hungernde Mutter. Nein, Lilli hat ihren Kindern nie geschrieben, dass sie hungert, Ilse dürfte es aber geahnt haben. Man könnte seitenlang aus den Briefen von Ilse zitieren. Sie, und zuweilen die ihrer Schwestern, geben ein lebhaftes Bild des Lebens und Treibens der Kinderfamilie und ihrer Umwelt. Von Dorles neuem Kleidchen und der Jagd auf Hanneles heiß geliebten, aus dem Käfig entflohenen Wellensittich bis zu den Bombennächten im Luftschutzkeller wird der Mutter berichtet. Es ist die Spontaneität, mit der die scheinbare "Normalität" des Lebens der Kinder einer deutsch-jüdischen Familie während der letzten Kriegsjahre dargestellt wird, die den Leser, jedenfalls diesen Leser, zum verzweifelnden Weinen bringt .Der Eindruck dieses unvergesslichen Buches verstärkt und verschärft sich durch die vorbildliche Zurückhaltung des Autors. Ohne jegliche Sentimentalität erklärt er uns notwendige, in den Briefen nicht erwähnte Zusammenhänge und Umstände. Martin Doerry lässt uns nicht nur an dem Leben und Leidensweg seiner Großmutter Lilli Jahn teilnehmen, soweit dies möglich ist, er setzt auch seiner Mutter Ilse ein würdiges Denkmal.
Hier möchte ich noch einmal zu Lilli Jahn im Arbeitserziehungslager Breitenau zurückkehren. Das Arbeiten brauchte die tüchtige Ärztin und Mutter von fünf Kindern wirklich nicht zu lernen. Das Fürchten hätte sie lernen sollen! Die Furcht vor dem Volk, mit dessen Sprache, Geschichte und Kultur sie sich zutiefst verbunden fühlte. Und ja, die Furcht vor dem geliebten Mann, der sie, in der Stunde der höchsten Gefahr, einem ziemlich gewissen Tod ausliefert. In Briefen an einige der wenigen ihr gebliebenen Freunde und auch an Ernst Jahn selbst bittet Lilli eindringlich, dass Ernst doch bei der Gestapo vorstellig werden solle, um ihre Freilassung aus Breitenau zu bewirken. Schließlich war sie ja nur wegen eines geringen Vergehens, sie hatte vergessen, ihre an der Wohnungstür angebrachte Visitenkarte mit dem Namen "Sara" zu ergänzen, zu vier Wochen Haft verurteilt. Nun waren es schon mehrere Monate!
Es ist sehr, sehr fraglich, ob Ernst Jahn je den Weg zur Gestapo ging. Später erklärte er den Kindern, es wäre ja doch sinnlos gewesen, solche Versuche zu unternehmen. Das kann schon richtig sein, nach Ernsts Scheidung von Lilli waren wohl spätere Rettungsversuche sinnlos. An dieser Stelle möchte ich Lilli selbst zu Wort kommen lassen. In einem Brief aus Breitenau versucht sie, einer Freundin das Verhalten Ernst Jahn s zu erklären. Hier muss zunächst erwähnt werden, dass Ernst Jahn ungefähr ein Jahr vor der Scheidung von Lilli ein Verhältnis mit der, natürlich rein arischen, Ärztin Rita Schmidt, die ihn öfters in Immenhausen vertrat, anfing und mit ihr ein Kind zeugte. Während der letzten Monate ihrer Schwangerschaft wohnte Rita Schmidt mit Lilli, Ernst und den Kindern unter einem Dach im Ärztehaus in Immenhausen, wo auch, mit Beihilfe von Lilli, Ritas und Ernst Jahn s Tochter geboren wurde. Nun zitiere ich aus Lillis langem Brief an die Freundin. "In dieser schicksalhaften Begegnung mit jener anderen Frau, mit der Rita Schmidt, musste Amadé erkennen, dass er mit seiner Verbindung mit mir seinem eigensten innersten Wesen untreu geworden war. Und nun fand er plötzlich diesen weiblichen Mitmenschen, der ein unsagbares, bis dahin nie empfundenes Glück schenkte, der ihm Heimat wurde, der ihn zu sich selbst und ihn, den ja auch Du als Gottsucher kennst, zu Gott zurückführte. Ein ganz tiefes religiöses Moment ist bei Amadé die Wurzel dieser Liebe, zu der er sich bekennen musste, weil er sonst nicht mehr im tiefsten Sinne leben konnte." Ist doch alles klar, deshalb musste Lilli, im ganz realen Sinne, sterben. Lilli sieht jedoch die Dinge anders. Sie erklärt der Freundin: "Du kennst ja auch den Amadé mit all seiner weichen, zarten Empfindsamkeit, die es ihm unmöglich gemacht hätte, an einer Entsagung und Überwindung innerlich zu wachsen und zu reifen. Sein Bestes und Wertvollstes wäre zugrunde gegangen . . . Siehst Du Hanne, sie gehen zusammen zur Kirche, der Amadé und die Rita . . Und sie ist eine Frau deutschen Blutes und verwandterer Art für ihn." Erlauben Sie mir, es ganz grob auszudrücken: Am deutschen Wesen soll der Ernst genesen. Ich erinnere mich an etwas und blättere um etwa 100 Seiten zurück. 1925 schreibt Lilli an ihren Amadé, der sich auf Grund seiner unerwiderten Liebe zu einer anderen Frau in großer gefühlsmäßiger Turbulenz befindet. Die starke Lilli verspricht ihrem "kleinen Amadé", wie sie ihn so oft nennt, ihm den Schmerz um die abweisende Geliebte "zu lindern und tragen zu helfen". Und dann schreibt Lilli, "hab ich Sorge, ob nicht Dir die Ehe mit einer Jüdin in Deinem Beruf und Deinem Vorwärtskommen Schwierigkeiten bereiten wird, und ich bitte Dich von Herzen, mit aller Offenheit darauf zu antworten". Dies schrieb Lilli, wie gesagt, 1925, und dennoch: Weder konnte sie, noch wollte sie das Fürchten lernen.
Man möge mich nicht falsch verstehen. Meine Anklage gegen Ernst Jahn hat nichts damit zu tun, dass er sich in eine andere Frau verliebte und mit ihr ein Kind bekam. Das kommt vor und ist nur allzu menschlich. Aber warum ließ er sich 1942 von Lilli scheiden? Zu dem Zeitpunkt muss er gewusst haben, was das für Lilli und, wenn die Jahre der deutschen Schande noch länger gedauert hätten, auch für seine Kinder bedeuten würde. Das kann und will ich nicht begreifen. Auch wenn Lilli in dem vorher zitierten Brief ihre Freundin anfleht, "Amadé nicht gar zu schwarz zu beurteilen. Er verdient es nicht, denn weder Leichtsinn noch Herzlosigkeit noch Schlechtigkeit kann man ihm vorwerfen." Zum Schluss noch eine Bemerkung über das, was mich mit Lilli Jahn verbindet. Auschwitz-Birkenau natürlich, aber auch Adalbert Stifter, den wir beide trotz eines Altersunterschieds von 30 Jahren liebten. Als Lilli die Erlaubnis bekam, sich ein Buch in das Lager Breitenau schicken zu lassen, bat sie um Stifters "Nachsommer". Vor ihrem Abtransport nach Auschwitz widmete sie das Buch ihrer ältesten Tochter: "Meiner lieben, so rührend um mich besorgten Ilsemaus, in Liebe und Dankbarkeit von ihrer Mutti. Breitenau, März 1944." Wenn ich mich selbst zitieren darf (aus meinem Buch "Gebranntes Kind sucht das Feuer"): "Adalbert Stifters Welt von unendlichem Frieden, von Zeit jenseits der Zeit, ein Meer von Zeit für ein stilles Leben und Gedeihen, für Geduld, Aufmerksamkeit und unmerkliches Wachsen" - Es wurde uns nicht beschieden, Lilli. Dir nicht, Lilli, und, obwohl ich überlebt habe, auch mir nicht .Wir waren wohl beide Opfer der Schizophrenie der deutschen Juden. Ich habe mich redlich bemüht, mich davon zu befreien. Seit ich erwachsen bin, habe ich nicht mehr auf Deutsch geschrieben, meine Bücher und einige Artikel sind aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt. Dies ist das erste Mal, dass ich versuche, auf Deutsch zu schreiben. Für Dich, Lilli. Ohne die Hilfe und Korrekturen meiner Tochter Elisabeth, die in Deutschland lebende Germanistin, wäre es allerdings nicht möglich gewesen. So schließt sich der Kreis. Oder auch nicht.
Cordelia Edvardson wurde 1929 als Tochter der Schriftstellerin Elisabeth Langgässer in Berlin geboren und lebt heute in Jerusalem. In ihrem Buch "Gebranntes Kind sucht das Feuer" (dtv), das in mehreren Sprachen veröffentlicht wurde, erzählt sie, wie sie als 14-Jährige nach Auschwitz deportiert wurde und überlebte.
Martin Doerry:"Mein verwundetes Herz". Das Leben der Lilli Jahn 1900 - 1944.
DVA, München. 351 S., 24,90 E.
18-08-2002
WELT am SONNTAG: Ihr protestantischer Großvater, Ernst Jahn, hat sich 1942 von Ihrer jüdischen Großmutter Lilli Jahn scheiden lassen. Daraufhin wurde sie knapp zwei Jahre später in Auschwitz umgebracht. Haben Sie keine Wut im Bauch?
Martin Doerry: Ich habe meinen Großvater doch gar nicht erlebt. Als er starb, war ich keine fünf Jahre alt. Er hat sich in einer Zeit, die ich nicht erlebt habe, als schwach erwiesen, als jemand, der einer Situation nicht gewachsen war und der versagt hat. Aber darüber kann ich mich nicht erheben. Das war die Zeit des Krieges - wer Schwäche zeigte, konnte verheerende Folgen anrichten.
WamS: ...und er beging buchstäblich einen tödlichen Fehler...
Doerry: ...der zweifellos unverzeihlich ist. Er suchte seinen Vorteil, er ignorierte die Warnungen der besten Freunde, er ging kurz nach der Scheidung eine neue Ehe ein. Mein Großvater hat die fünfzehn Jahre nach dem Krieg bis zu seinem Tod sehr unter der Vergangenheit gelitten und immer wieder zu erklären versucht, dass die Nazis ihm versichert hätten, seiner Frau geschehe nichts.
WamS: Das ist ein hochgradig naives Verhalten - zumal es fünf Kinder gab, darunter Ihre Mutter, die vor dem Gesetz Halbjuden waren.
Doerry: Er hat sich auf diese Position zurückgezogen. Nach dem Krieg hat Ernst Jahn sehr um die Liebe seiner fünf Kinder gekämpft. Es gab eine gegenseitige Annäherung, bei der die erwachsenen Kinder zwar nicht verziehen, aber die Liebe ein Stück weit erwidert haben.
WamS: Inwieweit ist die unendliche, aufopfernde und fast erdrückende Liebe Ihrer Großmutter Lilli zu Ihrem Ehemann die Keimzelle der Trennung und somit auch all des Unglücks?
Doerry: Sie hat sehr um ihn geworben, und er hat diese Werbung irgendwann angenommen. Dadurch glaubte sie, wieder geliebt zu werden. Im Rückblick wird deutlich, dass sie sich etwas vorgemacht hat. Allerdings gehören zu einer Trennung immer zwei Menschen.
WamS: Ihre Großmutter war eine zähe, beharrliche Kämpfernatur, pragmatisch und fest mit der Realität verwurzelt. In den Briefen erscheint sie geradezu unerschrocken gegen das Leid und die Ungerechtigkeit. Wie hat sie all die Demütigungen ertragen?
Doerry: Ihre Kraft lag in einem unbeirrbaren Selbstvertrauen, das sie vor allem ihrem Vater verdankte. Die Liebesfähigkeit ihrem Mann gegenüber - sie verteidigte sogar die Scheidung - ist eine Stärke, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Andererseits muss sie unglaublich viel Energie gehabt haben, und schließlich war sie hartnäckig im Verfolgen der persönlichen Ziele. Sie hatte sehr konkrete Vorstellungen über ihr Leben. Sie wollte Ärztin werden und wurde es. Daneben räumte sie sich genug Freiraum für ihre Neigungen ein, der Musik, Literatur und Philosophie.
WamS: Inwiefern war Lilli Jahn ihr Schicksal nach der Inhaftierung bewusst?
Doerry: Über die systematische Vernichtung in Auschwitz, auch über die Gaskammer, gab es nur Gerüchte außerhalb der Konzentrationslager. Ich glaube, meine Großmutter wusste nichts Genaues. Aber sie hat gespürt, dass in Auschwitz etwas ganz Schlimmes mit ihr geschehen werde. Das wird aus einer Wendung des letzten Briefes vor der Ankunft im KZ deutlich in den Zeilen vom 21. März 1944: "Ich hätte so gerne Tante Lotte noch mal gesehen." So etwas schreibt man nur, wenn man weiß, dass es akut ist, ein Abschied für immer.
WamS: Als promovierter Historiker befassen Sie sich als stellvertretender "Spiegel"-Chefredakteur natürlich mit Zeitgeschichte. Was hat sich seit Ihrer Arbeit mit den familiären Dokumenten verändert?
Doerry: Seit dem Buch setze ich mich auch beruflich vermehrt mit der Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust auseinander. Dadurch lerne ich Woche für Woche hinzu. Doch gebe ich meine persönliche Betroffenheit in der Regel nicht preis.
WamS: Sind Sie gläubig?
Doerry: Ich bin in der evangelischen Kirche. Aber ob ich gläubig bin, weiß ich nicht.
WamS: Und wie sieht es mit dem Judentum aus?
Doerry: Eine Zeitlang dachte ich, es berühre mich mehr, als ich wahrhaben wollte. Aber inzwischen bin ich weit weg davon, obwohl ich nach der jüdischen Tradition als Jude gelte. In Israel bin ich ein Fremder und werde es immer bleiben, unabhängig von der Beziehung zu meiner Schwester, die sich seit zwei Jahrzehnten zum orthodoxen Judentum bekennt. Auch meine Mutter würde von einer besonderen Sympathie für die jüdische Kultur sprechen, aber nicht von einer Identität.
WamS: Demnach entstand das Buch nicht aus religiösen Motiven, auch wollen Sie nicht "abrechnen" mit der Vergangenheit. Warum haben Sie diese so persönlichen Briefe veröffentlicht?
Doerry: Die Erforschung der eigenen Familie enthielt viele Rätsel. Die konnte ich teilweise lösen, und das ist für mich ein großer Gewinn, denn es gibt mir Klarheit über mein eigenes Leben. Insofern habe ich das Buch sicher auch für mich geschrieben.
Das Gespräch führte Ivonne von Opel.
Martin Doerry (Hrsg.): "Mein verwundetes Herz". Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. DVA München, Stuttgart 2002. 352 Seiten, 24,90 Euro.

08 April 2004
Virtually no Jew was able to smuggle a letter out of Auschwitz, let alone receive one. Letters would have given a slender meaning to their lives and a sense of connection to the world they had lost. Without them, Jews felt more painfully estranged. As far as we know, Lilli Jahn managed to smuggle one letter out of Auschwitz. Dated 5 June 1944, it was addressed to a non-Jewish relative and contained the falsely consoling words: "I'm so very happy." Two weeks later, at the age of 44, Lilli Jahn had died.
My Wounded Heart, an epistolary memoir, is based on the 300 or so letters Lilli wrote to German friends and her five children over the turbulent years 1918-1944. As well as providing a fascinating record, her correspondence vividly recreates the atmosphere of wartime Germany. At first, Lilli could not believe she was at the same risk as her co-religionists elsewhere in Europe. Lilli was born into the cultivated German Jewish middle classes, virtually indistinguishable from the non-Jewish majority.
Her letters become more urgent after September 1935, when Hitler issued the most murderous legislative document known to European history: the Nuremberg Laws. German Jews were excluded from citizenship and forbidden to marry "Aryans". Lilli's five children, though "half-Jews", were turned overnight into biological heretics in danger of their lives.
Lilli's husband, a Protestant doctor based near Frankfurt, came under increasing pressure from local Nazis to separate from Lilli. In 1942 he divorced her, and life went from bad to worse. Next year, Lilli was arrested by the Gestapo and sent to a "corrective labour" camp at Breitenau, leaving her children unprotected. The eldest, 15-year-old Ilse, was forced to become a surrogate mother as she struggled to look after her younger siblings.
Miraculously, Lilli's letters to her children from Breitenau have survived. Her grandson, Martin Doerry, has edited them with explanatory passages, and performed a difficult task with exemplary tact. The letters are heartbreaking. Maltreated by prison guards, emaciated and in rags, Lilli struggles to reassure her children that there is nothing to worry about. By a superhuman resolve, she enquires after their school lessons and even their new pet budgerigar.
Her pretence of normality did not last long. In the spring of 1944, after six months at Breitenau, Lilli was deported by the Gestapo to Auschwitz. Most Germans knew by now that there was a death-camp in occupied Poland, and Lilli was under few illusions.
Though harrowing, her letters offer a moving portrait of resilience in the face of evil, and speak of a time when Germany had departed from the community of civilised human beings. We are still learning to understand the catastrophe to which Lilli Jahn bore witness; My Wounded Heart is an essential document.
The reviewer's biography of Primo Levi won the Royal Society of Literature Heinemann Award

'How am I to explain it all so that you understand?'
(Filed: 11/04/2004)
David Flusfeder reviews My Wounded Heart: the Life of Lilli Jahn by Martin Doerry and Let Me Go by Helga Schneider
Lilli Jahn was born in 1900, and hers was an exemplary 20th-century life, presented by Martin Doerry, her grandson, as an epistolary biography, with the background scrupulously filled in by the editor. The story begins with Lilli at the family home in Cologne, about to qualify as a doctor, passionate, erudite, in love with German and European high culture and in love, too, with a rather stuffy young man, who loved (and who seemed to have the capacity to love) less than she. The emotional balance between this future husband and wife is established from the start: "I shall get a thorough training in internal medicine, pediatrics and gynaecology, and then settle down with you as a general practitioner for women and children. Don't you think that's the right thing?"
It's unclear whether Ernst ever thought it was the right thing, but her desire proved stronger than his vacillations, despite misgivings on both sides. Lilli was Jewish, Ernst was Protestant, with Roman Catholic leanings; he was a depressive, she had a vigorous attitude to life; he was made anxious by her independence of mind and superior education, but Lilli, typically, tried to brush all doubts away with her sense of certainty: "I wish I could infuse you with some of my own life and happiness, with my own spirit of survival, with that optimistic feeling which lends a person so much strength and courage and prevents us from going under."
One of the fascinations of this remarkable, and heartbreaking, book is its presentation of history as it is authentically lived: the letter Lilli wrote to friends after the appointment of Hitler to Reich Chancellor is detailed on the subjects of domestic arrangements and a recent concert given by Jascha Heifetz, with only a brief, exasperated aside concerning the "two extremes of the National Front [ie, Nazis] and the Left".
But, just a few months later, in April 1933, with the "Judenboykott", Lilli's route towards obliteration was set. It began with professional exclusion and social ostracism and it moved on to identity cards and a ban on attending public functions such as theatres and concerts.
There were points along the way when she might have escaped: her sister and, later, her mother fled to Britain, many of her relations emigrated to Palestine, but Lilli remained, a loyal wife.
Her husband was not so loyal. Their five children had the protection of a so-called "privileged mixed marriage", which meant that their Jewish blood was mitigated by their Christian upbringing, but Lilli's sole protection was her husband, who took a lover, an impeccably Christian doctor, Rita, for whom he divorced Lilli to marry in 1942.
Her fragile protection from the Nazi state was gone. Rita took the family house, and Lilli and her children made the move to Kassel, where, for the double crime of putting a card by her doorbell that announced her prohibited status as a doctor and omitted the enforced Jewish marker of "Sara" in her name, she was arrested by the Gestapo in September 1943 and sent to the Breitenau corrective labour camp.
The remainder of the book is almost unbearably sad. The motherless children attentively sent letters, breezy postcards of domestic moments, and food parcels, and Lilli's letters (she was permitted one a month, but smuggled out more) disguise her pain and hunger and anguish with practical details, telling them in which drawers they can find their winter clothes and still trying to justify their father's behaviour: "How am I to explain it all - above all, how am I to render [his] behaviour comprehensible to you, so that you understand and don't condemn him?"
It didn't work, of course: they did condemn their father, and Lilli's own capacities for love and strength and the spirit of survival weren't enough to save her. She was transferred in March 1944 to Auschwitz-Birkenau, where she died three months later.
One of the female guards at Birkenau was Helga Schneider's mother, who abandoned her family in 1941 for the privilege of joining the SS. Mother and daughter met again twice – the second occasion in 1998, with the mother 90 years old and half-senile in an Austrian nursing home – and their ensuing dialogue, with its panics and cruelty worthy of a Fassbinder movie, provides this curious and disturbing memoir [Let Me Go by Helga Schneider, 149pp, William Heinemann, £9.99]. On one side is the old woman, proud of her work in the camps at Ravensbruck and Auschwitz-Birkenau (only "the hardest, the toughest… had been sent to Birkenau"), vain ("I'm still beautiful, I'm not decrepit in the slightest. How could I have a daughter who looks like an old bag?"), and finally needy for the love of the child she had left behind; and on the other is the abandoned daughter resentfully looking for revenge. The crime of being left will never be forgiven by the author, so she forces out confessions of larger crimes, against humanity in general and Jews in particular, and self-laceratingly rejoices in her mother's lack of remorse.
But the issue of remorse is a red herring. Unforgivable acts don't become any more forgivable if they are later repented. In the world of the Holocaust, as Lilli Jahn's descendants, and readers, would discover, categories of remorse and forgiveness have no application.