
Startseite, hier
ELIAS CANETTI
(1905 - 1994)

Artikel erschienen am Sa, 12. März 2005
Sven Hanuschek: Elias Canetti. Biographie. 800 S., 22,90 EUR. Werner Morlang (Hg.): Canetti in Zürich. Erinnerungen und Gespräche. 240 S., 19,90 EUR. Elias Canetti: Aufzeichnungen für Marie-Louise. Hg. von Jeremy Adler. 120 S., 12,90 EUR.
Bilder aus seinem Leben. Hg. von Kristian Wachinger. 176 S., 24,90 EUR. Alle erschienen bei Hanser in München.
Ein fragwürdiger Charakter. Auch wenn wir 2005 seinen 100. Geburtstag festlich begehen, wollen wir nicht um die Fakten herumreden: Es gibt Grund genug zur Annahme, daß der Humanist und Moralist und Literaturnobelpreisträger Elias Canetti - nebenbei oder zuvorderst? - ein absoluter Egoist, ein zuweilen ahnungsloser Apodiktiker und ein Menschenausnützer und -verächter von Graden gewesen ist.
Er liebte die Menschheit in der Theorie, praktisch hatte er mit den Einzelexemplaren durchaus misanthropische Schwierigkeiten. Die Kraft seines Hasses wirkt ebenso verstörend wie seine kaum je ermüdende Rachsucht. Schon die Veröffentlichung des - so nicht zum Druck bestimmten - autobiographischen Buches "Party im Blitz" vor zwei Jahren hat viele, nicht die schlechtesten, Leser vor den Kopf gestoßen. Wie da einem Greis der ewig jugendfrische Neid und der Zwang, andere - auch und gerade sexuelle Partnerinnen - im nachhinein verkleinern zu müssen, die Feder führten, ist gelinde gesagt betrüblich.
Das Jubiläumsjahr zeitigt naturgemäß eine Fülle von Publikationen über den auf Fotos meist streng und feierlich dreinblickenden Canetti und aus dessen Nachlaß. Generalstabsmäßig hatte er sein Fortleben jenseits des Grabes inszeniert: Zehn Jahre lang nach seinem Tod 1994 durfte keine Biographie erscheinen, beträchtliche Teile der in Zürich archivierten schriftlichen Hinterlassenschaft sind bis 2024 gesperrt. Sven Hanuschek hat aus dem Verfügbaren, infolge einer gewissen Weitschweifigkeit, vielleicht nicht das Beste, aber sicherlich viel Gutes gemacht. Sein monumentales Lebensbild, das sich auf unbekannte Quellen sonder Zahl stützt - so auf Canettis Aufzeichnungen und Briefe in Privatbesitz -, ist eine imponierende Leistung. Nie entsteht der Eindruck, der Biograph halte mit irgendeinem kompromittierenden Wissen hinter dem Berg, um dem Porträtierten wenigstens Reste seines Heiligenscheins zu bewahren. Was Hanuschek zitiert, spricht für sich und oft gegen Canetti. Denn dessen Leidenschaft des Schmähens war gewaltig. Fast niemand, zumindest aus der geistigen Sphäre, ist ihr entkommen. Selbst (oder gerade) einstige Förderer und Bewunderte wurden nicht begnadigt. In der Schar der mit Mißgunst Bedachten - keine üble Gesellschaft, ziemlich elegantes Milieu - finden sich Theodor W. Adorno ("das ekelhafteste Beispiel eines Philosophen") und der "Immer-rascher-Schwätzer" Claudio Magris.
Bei Karl Kraus, dem Idol seiner Wiener Studentenzeit, Canettis Huldigung anno 1927 "An den gewaltigen Schutzgeist, an den einzigen Richter Wiens!" wurde übrigens nicht beantwortet, scheint die Fallhöhe besonders groß: "Welch ein Goebbels im Geiste!" heißt es da später über Kraus, und: "So beschränkt und beinahe so ungebildet wie Hitler." Kommentar überflüssig.
Mildernde Umstände sind: Elias Canetti pflegte derlei - zumindest in dieser Drastik - in der Mördergrube seines Herzens zu verscharren. Offiziell, etwa bei Interviews, gefiel er sich in der Rolle des weisen, gütig abgeklärten älteren Herrn und Schriftgelehrten. Insgeheim freilich, hinter vorgezogenem Vorhang, war er eine Art entfesseltes Rumpelstilzchen, die Personalunion von öffentlichem Ankläger und Henker.
Seine Umgebung vermochte solche Abgründe bloß zu erahnen. Ein einprägsamer, die Diskrepanz glänzend illustrierender Fall ist jener von Friedrich Dürrenmatt. Sämtliche Zeugen in Werner Morlangs schönem, Erinnerungsberichte versammelndem Band "Canetti in Zürich" stimmen überein, Canetti habe Dürrenmatt "echten Respekt" entgegengebracht, ihn "sehr gemocht". In Canettis O-Ton liest sich das etwas anders. Er bescheinigte dem Kollegen "erstaunliche Dummheit". Das detailliertere Vernichtungsurteil: "Einfälle plump, wie von Schulaufsätzen. Die Sprache eines Fetten. Der Hohn kraftlos."
Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu: Bedeutende Künstler, insbesondere Literaten und Dichter, sind persönlich selten angenehme Zeitgenossen. Das mindert ihr ästhetisches Format nicht im geringsten, ist jedoch im Rahmen einer Biographie schwerlich auszublenden. Trotzdem: Elias Canetti präsentiert sich auf den 800 Seiten eben nicht ausschließlich als Monster. Er ist weiterhin eine - auch in ihren Extremen und Schwächen - faszinierende Gestalt.
Die Daten seiner Existenz sind rasch aufgelistet: Geboren 1905 als ältester von drei Söhnen einer sephardischen Familie im bulgarischen, damals noch türkischen Rustschuk an der Donau; aufgewachsen in Manchester und - nach dem frühen Tod des Vaters - in Wien, Zürich und Frankfurt am Main. Deutsch, das die Eltern bevorzugten, wenn die Kinder sie nicht verstehen sollten, war seine vierte, ihm von der dominanten Mutterwitwe buchstäblich eingebleute Sprache: Es wurde das Idiom seiner Literatur. Studium der Chemie in Wien; Liebesverhältnis im Zeichen der gemeinsamen Kraus-Verehrung mit der - politisch unkorrekt ausgedrückt - verkrüppelten, um acht Jahre älteren Erzählerin Veneziana (Veza) Taubner-Calderon, einer spaniolischen Jüdin. Ladino bildete die Geheimsprache des späteren Ehepaars Canetti. Unter Vezas Schutz brutale Abnabelung von der Mutter, Mathilde Canetti. 1935 Erscheinen des ersten und einzigen Romans "Die Blendung", der von Kennern gepriesen, indes kein wirklicher Verkaufserfolg wurde. November 1938 Emigration nach England. Arbeit an der von Canetti als Hauptwerk betrachteten kulturanthropologischen Studie "Masse und Macht". Erst die englische Übersetzung der "Blendung" etablierte das "Geheim-Genie" Elias Canetti als ernstzunehmenden Autor in Großbritannien. In Deutschland waren dazu "Masse und Macht" (1960) die dritte Ausgabe der "Blendung" (1963) und seine drei Dramen nötig. "Die Stimmen von Marrakesch" (1968) wurden sein erster Bestseller. Durch seine Memoiren-Trilogie (ab 1977) erlangte Canetti Weltruhm, den die Verleihung des Nobelpreises 1981 besiegelte. Mit seiner zweiten Frau Hera, die gleichfalls lange vor ihm starb, hatte er in Zürich eine Tochter. Elias Canetti, bereits zur Ehre der irdischen Altäre erhoben, verschied friedlich im Schlaf - in der Nacht zum 14. August 1994.
Das Spannende an Hanuscheks Band: Elias und Veza Canetti konnten offenbar miteinander nicht leben, aber auch nicht von einander lassen. Bruchlos übernahm die Gattin die Mutterfunktion von Mathilde Canetti. Die mit Selbstmorddrohungen gespickte Ehe zeigte Züge von Hardcore-Strindberg, was keineswegs verhinderte, daß Canetti Veza zwischendurch und nach ihrem Tod zur Heiligen stilisierte. Sie war ohne Zweifel eine charismatische Persönlichkeit, weit interessanter sogar als ihre Texte. Ein bezeichnendes Schlaglicht wirft Hanuschek auch auf die ungemein intensive Beziehung Canettis zu seinem jüngsten Bruder Georges, einem lungenkranken Lungenspezialisten, dessen Homosexualität Canetti diskret verschwieg. Veza Canetti wußte nicht nur vom Harem ihres Mannes, sondern förderte einzelne Nebenfrauen geradezu. Der Meister und Guru und Experte der Macht war ein unersättlicher Damen- und Mädchenverzehrer, "treu wie ein Faun". Seltsamerweise ist nicht zu entscheiden, ob seine "Opfer" (von der Schriftstellerin Friedl Benedikt über die Malerin Marie-Louise von Motesiczky bis zu Iris Murdoch) vor allem bedauernswert waren oder eher beglückt. Canetti dürfte im Psychologischen ein Magier und Menschenfischer gewesen sein, jedem Gegenüber jeweils das Gefühl vermittelnd, er/sie sei das wichtigste Individuum auf Erden.
Die jetzt von Jeremy Adler edierten "Aufzeichnungen für Marie-Louise", in Schönschrift notierte Aphorismen Canettis aus der Kriegszeit für seine Geliebte und Mäzenin Motesiczky, sind zwar kein Zeichen der Hingabe, aber einer starken Hinwendung. Manches daraus wird man sich merken müssen, zum Beispiel: "Die Ethik des alten Mannes ist seine Gesundheit."
Elias Canetti, ein Scheusal? Ja, doch. Wollte Gott, die deutsche Literatur hätte mehr davon.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Dokument erstellt am 12.04.2005 um 15:48:06 Uhr
Erscheinungsdatum 13.04.2005
Geschichte und Eigensinn
Eine große Biographie über den Mythomanen und Dichter Elias Canetti, der im Sommer vor hundert Jahren geboren wurde
VON HARRY NUTT
Sven Hanuschek:
"Elias Canetti." Biographie. Carl Hanser Verlag, München 2005, 800 Seiten, 29,90
Euro.
Elias Canetti: "Bilder aus seinem Leben." Hrsg. von Kristian Wachinger.
Carl Hanser Verlag, 175 Seiten, 24,90 Euro.
Elias Canetti: Aufzeichnungen für Marie-Louise. Carl Hanser Verlag,
München 2005, 120 Seiten, 12,90 Euro.
Elias Canetti: Aufsätze, Reden, Gespräche.
Carl Hanser
Verlag, 395 Seiten, 27,90 Euro.
Man kann Elias Canetti einen begnadeten Lästerer nennen. Im Laufe seines Lebens
waren es nicht wenige, darunter große Namen, die seine Lust am vernichtenden
Urteil erfuhren. "Stefan Zweig, das war der schlechteste", hat Canetti im
Interview gesagt, und an Franz Werfel missfiel ihm die "Neigung, alles, was er
aufnahm, sofort in Arien umzusetzen." Nicht besonders gut kam auch der Künstler
George Grosz weg. Er "mündete, kaum war er emigriert, ins Amerikanische ein und
erwies sich plötzlich als leer und unbedeutend. (...) Das hing mit seinem
Glauben ans Geld zusammen. Er hatte nie Widerstand gegen das Geld. Er ergab sich
blind und beinah servil seinen Mäzenen."
Die Schriftstellerin Iris Murdoch, mit der Canetti während seines Londoner Exils
in den vierziger Jahren vorübergehend eine Beziehung hatte, wird in dem nicht
mehr fertiggestellten autobiographischen Band Party im Blitz mit einer
ungezügelten Wutkaskade attackiert. Etwas besser erging es dem berühmten
Dirigenten Hermann Scherchen, der sich bloß als eine Art exemplarischer
Machthaber in Canettis großer Studie Masse und Macht wiederfand. Für
viele Zeitgenossen dürfte es ein zwiespältiges Vergnügen gewesen sein, den
scharfzüngigen Schriftsteller kennen gelernt zu haben. Dabei war Elias Canetti
bis 1960 ein weitgehend unbekannter, nur wenig veröffentlichter Autor, der allen
Wirrnissen des Krieges und der Emigration zum Trotz mit der Selbstsicherheit und
Eitelkeit eines Großschriftstellers auftrat.
Man kann Canetti aber auch einen großen Bewunderer nennen. Wer das nicht glauben
mag, für den hat es die Literaturwissenschaftlerin Beatrix Kampel schon vor
Jahren ausgezählt. In den drei Bänden von Canettis Memoiren finden sich 508
Belegstellen zu insgesamt 111 Autoren und 118 Werken. Positive Stellungnahmen
überwiegen, und die Liste der Nennungen ist enttäuschend konventionell.
Der belesene Canetti verehrt die Großen der Weltliteratur und überrascht
allenfalls durch die Eigenwilligkeit seiner Begründungen. So scheut er in seinen
Aufzeichnungen nicht vor einem Vergleich mit Fontane zurück. "Ich hätte ihn
verkannt. Er hätte mich gehasst. Wir hätten uns gegeneinander zu wehren gesucht.
Er hätte mich beleidigt und tagelang und nächtelang mit mir gesprochen. Wie
hätte ich seine Worte erkannt. Wie hätten sich meine eigenen davor verkrochen.
Er liebte die runden, die überrunden Sätze, ich liebe die spitzen. Jede Äußerung
von ihm aus der Zeit der Wanderungen ist mir kostbar, besonders jede, gegen die
ich mich sträube."
Solche Sätze lassen eine literarische Besessenheit erkennen, die sich in dem
Bedürfnis nach Rühmen und Rügen gleichermaßen entlädt. Elias Canetti, das ist
zunächst einmal der Büchermensch, jene wahnhaft selbstzerstörerische Figur Peter
Kien, die am Ende seines Romans Die Blendung in den Flammen eines
Bibliotheksbrands aufgeht. Erweist sich Kien als lebensunfähiger Bibliophiler,
so scheint sich Canetti von Kindheit an in eine frühzeitig entworfene
dichterische Existenz gerettet zu haben. Vor den Meisterjahren in eigenen Text-
und Mythenwelten, die er als erfahrener Textarrangeur souverän befehligt, ist
Canetti jedoch beinahe zwangsläufig durch eine Schule des Hörens gegangen.
Nichts drückt das besser aus als der Beginn seiner Autobiographie Die
gerettete Zunge, in der Canetti sein ursprüngliches Verhältnis zu Hören und
Sprechen ins Gedächtnis ruft. 1905 im türkischen Rustschuk (heute Bulgarien) als
Sohn sephardischer Juden geboren, ist das Kind von Anfang an einer fabelhaft
erscheinenden Vielsprachigkeit ausgesetzt. "Rustschuk an der unteren Donau, wo
ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind, und wenn ich sage,
dass sie in Bulgarien liegt, gebe ich eine unzulängliche Vorstellung von ihr,
denn es lebten dort Menschen der verschiedensten Herkunft, an einem Tag konnte
man sieben oder acht Sprachen hören. Außer den Bulgaren, die oft vom Lande
kamen, gab es noch viele Türken, die ein eigenes Viertel bewohnten, und an
dieses angrenzend lag das Viertel der Spaniolen, das unsere. Es gab Griechen,
Albanesen, Armenier, Zigeuner. Vom Gegenüberliegenden Ufer der Donau kamen
Rumänen, (...) Es gab, vereinzelt, auch Russen."
Anmaßung und Selbstentlarvung
Benötigt ein Autor, der eine dreibändige Autobiographie vorgelegt hat, für die
er 1981 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, eigentlich eine Biographie, die
die hinreichend dokumentierten Lebensphasen ausleuchten? Für einen Mythomanen
wie Canetti ist es wohl zwingend. Kaum ein Autor hat sich wie er eine
Dichterexistenz konstruiert, in der noch das kleinste Detail poetologisch
aufgeladen erscheint. Canetti schreibt nicht über Sujets und Themen, ihm dient
das Schreiben im emphatischen Sinn zur Errettung der Existenz. Ein nicht
unbeträchtliches Vergnügen für den Leser erwächst daraus, dass die Anmaßung des
Canetti'schen Schreibens nie zur bloßen Pose erstarrt.
Der stets auch Spuren zu seiner Selbstentlarvung auslegende Autor zelebriert
sich zwischen Zurückhaltung und Größenwahn in einem skurrilen Welttheater. Oft
geht es ums große Ganze, doch liegt seine Stärke im Gespür für das Kleinste. Das
Zucken im Maul eines Tieres kann eine Welt ausmachen.
Der Rückzug in die Welt symbolischer Formen erstaunt um so mehr, wenn man
Canettis turbulenten Weg durch das Jahrhundert der Extreme betrachtet. Von der
Faszination wie von den Katastrophen seiner Zeit wurde er mehrfach gestreift,
manchmal mitgerissen. Nach der Kindheit in Rustschuk geht die Familie nach
Manchester, wo der Vater an plötzlichem Herzversagen stirbt. Aus der glücklichen
Vaterbindung, in der die literarische Initiation eingeübt wurde, wird
schlagartig eine enge, aber stets auch gespannte Mutterbindung, die über die
Stationen Frankfurt und Zürich schließlich in Wien Halt macht, wo Canetti Chemie
studiert, aber vor allem zum hörigen Schüler von Karl Kraus wird.
Im Buch Canetti gibt es viele Kapitel, die es aufzuschlagen lohnte. Eines davon
müsste "Canetti und die Frauen" heißen. Klein und ein wenig dicklich, muss
Canetti eine enorme Ausstrahlung gehabt haben. In den berühmten
Kraus-Vorlesungen lernt er Veza Calderon kennen, sephardischer Herkunft wie er
und ebenso literarisch ambitioniert. Die Geschichte ihrer Flucht vor den Nazis
nach England wird Veza in ihrem Roman Die Schildkröten in rhythmischen
Strichen skizzieren. Doch die große Liebe des Schriftstellerpaares ist stets
auch eine belastete. Die existentiell Geforderten und intellektuell sich
Fordernden können nicht mit- und nicht ohne einander. Nach der Aufgabe der
sexuellen Beziehung (und nach einer Fehlgeburt), ist es Veza, die Canetti
wiederholt andere Liebschaften nahe legt, und so lebt er in England über einem
längeren Zeitraum mit der Schriftstellerin Friedl Benedikt, der Malerin
Marie-Louise von Motesiczky und Veza zusammen.
Das musste in der Phase des Ruhms einige Moralinspektionen nach sich ziehen. Der
Vorwurf der geistigen Ausbeutung von Veza ließ in den achtziger Jahren nicht
lange auf sich warten. Man wurde den Eindruck nicht los, dass hier ein
Indizienprozess gegen den Literatur-Pascha geführt wurde. Tatsächlich erschien
Vezas beachtliches Werk erst nach Canettis Tod. Der Verdacht lag nahe, dass es
Canetti war, der eine Autorin mit seinem Namen nicht neben sich dulden mochte.
Es gibt Aufzeichnungen, die diesen Verdacht nährten. Sven Hanuschek vermag jetzt
jedoch gut zu belegen, dass es Veza selbst war, die dem Erscheinen ihrer
Geschichten und Romane, von Depressionen geplagt, mehrfach im Weg stand. Die
Geschichte von Veza und Elias Canetti ist mit Skurrilitäten gespickt. In
Fackel im Ohr schreibt Canetti über Veza in den Kraus-Vorlesungen lapidar:
"Sie klatschte nie". Dass Veza von Geburt an nur einen Arm hatte, erfuhr man
aber erst spät aus der Autobiographie des langjährigen Canetti-Freundes und
österreichischen Kommunistenführers Fritz Fischer. Eine Indiskretion mit Folgen,
denn Canetti quittierte Fischer die Freundschaft, weil dieser Veza geschworen
hatte, ihr Geheimnis über den Tod hinaus zu bewahren. Sven Hanuscheks
Biographie, für die er privilegierten Zugang zum teilweise noch auf Jahrzehnte
gesperrten Nachlass Canettis hatte, liest nicht nur der geübte Canetti-Leser,
für den es viele Neuigkeiten gibt, mit Gewinn. Mehr noch als eine kenntnisreiche
Einführung in Canettis Denken und Werk, ist Hanuscheks Arbeit eine Art Gegengift
zu Canettis listigen und verklärenden Selbstauskünften. Hanuschek ist das
erkennbar aufwendige Kunststück gelungen, sich seinem Gegenstand mit
gleichschwebender Aufmerksamkeit zu nähern, ohne dem Verwandlungsexperten und
Fallensteller Canetti allzu sehr auf dem Leim zu gehen. Hanuschek hat Canettis
Lebensroman, der über die Bände der Autobiographie hinaus auch ein permanenter
Aufenthaltsort Canettis war, vor ein aufklärerisches Licht gehalten, ohne der
ambitionierten Werkarchitektur ihren Eigensinn zu rauben. Hanuscheks Arbeit
zeigt, wenn man so will, Canetti unplugged.
Lebenskluges Vademecum
Noch im hohen Alter gibt dieser den Unerschütterbaren, der seinen Werkplan immer
fest im Sinn gehabt habe. In einer Aufzeichnung von 1985 heißt es: "Er bereut
kein Hindernis, nichts, das ihn aufgehalten hat. Hätte er gewußt, dass er 80
wird, er hätte mit allem noch länger gewartet." Hanuschek vermag jedoch
freizulegen, dass anstelle der souveränen Gelassenheit über viele Jahre
Selbstzweifel, Schreibhemmung, Depression und materielle Not die Autorenexistenz
erschütterten. Der große Werkplan war immer auf reißbarer Folie gezeichnet.
Bereits in seinen Wiener Jahren ist der Werkplan für Masse und Macht
gefasst, dessen Zentralerlebnis der 15. Juli 1927 gewesen sein dürfte. Bei einer
kämpferischen Demonstrationen zwischen einem Frontkämpferverein und
Sozialdemokraten war es zu der Erschießung eines achtjährigen Jungen gekommen.
Als der Täter freigesprochen wird, kommt es zur Eskalation, in der Canetti die
wütende Masse nicht nur beobachtet, sondern als Demonstrant auch erlebt.
Canettis phänomenologischer Riesenessay Masse und Macht erscheint jedoch
erst 33 Jahre später, als der vielversprechende junge Autor der Wiener Jahre
bereits ins Rentenalter vorgerückt ist. Der späte Ruhm, auch das macht
Hanuscheks Biographie schonungslos klar, entschädigt ein entsagungsreiches Leben
nicht. Die dichterische Gelassenheit, die die Aufzeichnungen Canettis als
lebenskluges Vademecum erscheinen lassen, hatten nicht selten Ventilfunktion für
akute Enttäuschungen.
Erste Verkaufserfolge feiert Canetti erst mit der Reiseerzählung Die Stimmen
von Marrakesch, die 1968 erscheint und in der alle Themen Canettis auf eine
beinahe heitere Art versammelt sind. Die Reise nach Marokko hat einige Jahre
zuvor stattgefunden, aber auch in diesem Fall hatte Canetti von einer
vorschnellen Veröffentlichung abgesehen. Zur Heiterkeit dürfte in hohem Maße
Hera Buschor beigetragen haben, die nach Vezas Tod 1963 Canettis zweite Frau
wird. Trotz eines großen Altersunterschiedes erlebt Canetti beinahe demütig eine
anrührend große Liebe, die zugleich in seine Ruhmphase fällt. Nicht ohne
Augenzwinkern weiß der Biograph Sven Hanuschek zu erzählen, dass der
sephardisch-balkanesiche Macho, der Canetti stets geblieben ist, von Hera
widerstandslos zum Abwasch angeleitet wurde. Nur wissen sollten davon nicht
allzu viele. Doch das häusliche Glück währt nicht lange, Hera stirbt viele Jahre
vor Canettis Tod 1994 in Zürich.
Und? Ist Canetti ein großer, immer noch unterschätzter Autor? Masse und Macht
ist heute eher ein feuilletonistisches Schatzkästlein denn wissenschaftlich
anerkannt. Seine Theatertheorie zwischen Grundeinfall und Maskensprung ist
vielfach adaptiert, aber nicht wirkungsmächtig. Canettis Poetologie, die um den
Begriff der Verwandlung kreist, ist im buchstäblichen Sinn zu flüchtig, als dass
sie auf den T-Shirts kommender Dichtergenerationen getragen werden könnte. Seine
trotzig behauptete Tod-Feindschaft erscheint gegen das schnittige Theorie-Design
verschiedener Biopolitiken heute geradezu anachronistisch. Als kauziger
Selbstdenker ist Elias Canetti eher einer, der stillen Lesern die Ehrfurcht vor
akademischen Prunkgebäuden zu nehmen vermag. Auf seltsame Weise, dazu trägt Sven
Hanuscheks Durchleuchtung mehr bei als dass sie es zu überwinden vermag, liest
man Canettis immer noch als Geheimtipp. Canetti hätte das wohl als Lob
aufgefasst. Seinem Werkplan zufolge ist die Zeit des Dichters als Hüter der
Verwandlungen ohnehin noch nicht gekommen.

John
Bayley defends Iris Murdoch against memoir by former lover
By Chris Hastings, Arts Correspondent
(Filed: 29/05/2005)
The widower of Dame Iris Murdoch has launched a stinging attack on one of her former lovers, who described her as an intellectual lightweight and lousy in bed.
Professor John Bayley, 80, said that he was unable to recognise his late wife in the autobiography of the Nobel Prize-winning author, Elias Canetti, due to be published in Britain in July.
Prof Bayley, who is a fellow of St Catherine's College, Oxford, said the Bulgarian-born writer, who had enjoyed a three-year relationship with Murdoch in the 1950s, was "pathologically conceited and jealous of her success".
"I do not think it is worth paying any attention to what this man says about Iris," he said. "I certainly do not recognise her from his description. I think people who know what sort of man he is will not be surprised by what he says about her. They will put it down to his pathological conceit and his jealousy."
Canetti, a playwright and novelist, who won the Nobel prize for literature in 1981, arrived in Britain in 1939 and spent more than 40 years in the country. He was married at the time he began his affair with Murdoch in 1953.
The relationship was one of the most influential in Murdoch's life and inspired many of her most famous works, including the Booker prize-winning The Sea The Sea, which was published in 1978.
But in his memoirs, Party in the Blitz, which he began to write in the 1980s, Canetti launches a bitter attack on his former protege, claiming that it was impossible to take "her seriously any more" and describing her as an "illegitimate writer" who never suffered for her art.
His 20-page critique of his former lover begins: "Yesterday [I saw] the thick philosophical tome of Iris Murdoch, with her name on the cover in huge letters. I - unfortunately - sat down with it for a few hours. My antipathy against her has grown so strong that I must say something about her here."
Canetti continues: "You could call Iris Murdoch the bubbling Oxford stewpot. Everything I despise about English life is in her. You could imagine her speaking incessantly, as a tutor, and incessantly listening in the pub, in bed in conversation with her male and female lovers."
He is equally damning about their first physical encounter. "She lay unmoving and unchanged, I barely felt myself enter her, I didn't sense that she felt anything, perhaps I might have felt something if she had resisted in some form. But that was as much out of the question as any pleasure."
He adds: "While her lack of hospitality may have chilled me, her love never did, for the simple reason that it wasn't love, it was an indifferent act, endowed with a baffling significance for her."
Canetti said Murdoch had a hunger for knowledge which knew no bounds and would actively soak up other people's experiences. This eagerness to listen, however, is one of the few traits which appealed to the self-confessed egotist.
"I liked having Iris as a listener," he writes. "I sensed she was good at it, and thought that was what she came to me for. Nothing draws me to a person more than the feeling they want to listen to me. "
Prof Bayley, whose biography of his late wife, called Elegy For Iris, inspired the 2001 Oscar-winning film, Iris, with Dame Judi Dench and Kate Winslet, said there was no doubt that his wife had been bewitched by Canetti and that their relationship would find echoes in her work.
"Canetti liked to have a court around him. He had a sort of mystical power, particularly as far as women were concerned. He was always keen to show that Iris belonged to him and he had created her. He was never very happy when people moved on and established themselves in their own right.
"I think it's true to say that Iris went on being inspired by him in almost everything she wrote.
"She had a streak of masochism and that relationship frequently comes out in some of the novels, such as The Flight from the Enchanter, which I think tells you all you need to know."
Canetti completed four separate drafts of his memoirs before his death in 1994. His will prevented publication of his manuscripts and papers for a time, but Party in the Blitz became available in Germany at the beginning of 2004.
An English version of the book, translated by Michael Hoffman, is due to be published for the first time this summer.
Dame Iris, who wrote 26 books, died from Alzheimer's disease in February 1999. Prof Bayley remarried in 2001.
Fox on the
loose
Peter Conradi finds Elias Canetti's recollections of Iris
Murdoch in Party in the Blitz awash with bile, backstabbing and envy
Saturday July
9, 2005
The Guardian
Party in the
Blitz
by Elias Canetti
266pp, Harvill, £17.99
Elias Canetti arrived in England in 1939, fleeing Hitler, with his wife and (soon) two mistresses. He was known in his adoptive Vienna for a single novel Auto-da-Fé, a black comedy of justified paranoia and misogyny. In England he boasted one reader only, sinologist Arthur Waley. His first three autobiographies - which helped win him the 1981 Nobel prize for literature - chronicle Viennese literary life between the wars.
Now, 11 years after his death in Zürich, here are his memoirs of the war years in England. Despite carelessnesses - Herzog von Northumberland stays in German; Margaret Gardiner and JD Bernal were unmarried; it was not Churchill who lost India - they are splendidly entertaining. Canetti's method is to string together small scenes, like beads, into a continuing story. Here are vignettes of London in 1940, of life among Amersham and Hampstead expatriates, of awful war-time parties. Downshire Hill was a street to delight in. His mistress Friedl's lodgings at number 35 had a private gallery of Ben Nicolsons and Hepworths; Mountbatten visited; Lee Miller and Roland Penrose, who had organised the International Surrealist Exhibition, lived diagonally opposite at number 21. And Canetti, unencumbered by any war work, was free to survey the battle of Britain from the Heath.
The English impress and move him for their war-time courage, and invite his sneers for their lack of inner life and cold arrogance. Canetti became confidant to a coterie of friends that included the poet Kathleen Raine and Gavin Maxwell, whom Raine obsessively and unreasonably loved, and Maxwell's elder brother Aymer: grandsons, he frequently reminds us, of a duke. Both were predominantly gay. A grand Maxwell relative, on being told that Canetti is a Jew, tries crassly to put him at his ease by inviting him to value a diamond. Canetti collects insults.
He also delights in human difference. In Amersham he is sheltered by innocent Mr and Mrs Milburn who go in for consulting prophetesses, and seek to reassure him during the blitz that "the bombs are imaginary". The Empsons, William and Hetta, are friends, and he admires Empson's omnicompetence, and generous party-giving, and watches how the English move at social gatherings. Canetti learns to decrypt the secret codes of conduct, a key to getting on in London, where he stayed for 40 years.
He relishes the extended intelligentsia family of Veronica Wedgwood, who translated his novel in 1946, winning him new readers. The question as to whether each new friend has read Canetti is perennially fresh and absorbing: William Empson, for example, is among those who fascinate Canetti by refusing to disclose whether or not he has read Auto-da-Fé
So one motive for writing Party in the Blitz is for Canetti to insert himself into what he deems the world's greatest literature (English), just as his earlier memoirs effected his infiltration of the German writing scene. It should not surprise us therefore that he attacks the leading poet of the 1940s - TS Eliot - and one leading novelist thereafter, Iris Murdoch. Most writers, Canetti acknowledged in his earlier memoirs, displeased him due to the fact that "perhaps one would like to be the only one". His attack on Eliot's emotional impotence is more remarkable for its bile than its originality. But he tries to destroy the reputation of Murdoch, his lover then life-long friend-at-a-distance, from many directions at once, and - no gentleman - uses intimate knowledge too. Does he succeed? Only partly.
Their three-year love-affair began soon after a mutual friend, the poet Franz Steiner, died in late 1952, and resembled a battle of two hypnotists in a closed room. Murdoch acted as victim to Canetti's jealous Pasha, but both enjoyed power-play. Canetti shocked many friends for 40 years by claiming (possibly truthfully) that love-making with Murdoch stopped Steiner's ailing heart. Here, by contrast, Canetti announces prettily that Steiner died when Murdoch proposed marriage. Truth is a commodity Canetti feels licensed to conjure with. Some friends he idealises; others he "dunks in pitch".
Each instantly started writing about the other. Murdoch portrayed Canetti in her second novel, The Flight from the Enchanter, as the cunning Mischa Fox, a mystery-man who tries to seize and destroy a Suffragette newspaper called the Artemis, Fox being no friend to independent women. She dedicated the novel to Canetti, but he resented this depiction.
Fox is presciently described as "capable of staging a careful revenge after 10 years". Canetti waited 40. Some scatter-fire misses its mark. Calling Murdoch "an unutterably petit bourgeois shop-girl" is merely snobbish: both she and Canetti were provincial adventurers, and Protestant Ireland isn't a lowlier origin than Canetti's Ruschuk on the Ottoman Danube. Murdoch said to Canetti and, he claims, others, "You're beautiful", meaning only "I'm hungry, come". Isn't this what people do say (and mean) in bed? Both were narcissists who collected admirers, leading complicated, deceitful love-lives. They resembled each other.
But some fire seems lethal. Nothing touched her deeply, he claims. He was not alone in thinking her coated in ice, or - as Stuart Hampshire put it - "utterly unwounded". Canetti brilliantly points to the mix in her of school-girl and head-mistress which indeed hurts her novels. Canetti calls her - tellingly - "ambitious as an arch-criminal". Ambitious she certainly was. What were her crimes ? She wore a transparent blouse, on which he lavishes pages, to seduce Sir Aymer Maxwell, a famous pederast. Since she served up inadequately sexy lunches, wore bad underclothes and put her large feet into ugly sandals, he had thought seductiveness beyond her. Her crime was to try it out - and obsequiously - on someone else. He self-pityingly concludes: "It seemed not to have crossed her mind to wonder what it [her seductiveness] might do to me."
What precisely it did to him is revealed in Iris's journal, whose account differs from his. Soon after this meeting Iris recorded feeling both exasperated and touched by Canetti's warnings that Aymer was a "werewolf" and "would do anything he could to drive a wedge between us, even to trying to seduce me. He added, if you do do anything you regret, remember that I am merciful!"
Canetti's jealousy and paranoia illuminated many such scenes: he accused his staid mistress Marie-Louise of flirting with a postman. As Iris's cool record predicts, she survived Canetti. Not all his "creatures" did. Murdoch was, he notes incredulously, the only woman in his life who never sought to capture him. She went on to publish 24 novels, a tally he repeats, 23 more than him. And she - a woman moreover - won greater literary and social acclaim than he. He terms this - enviously - "vulgar" success.
But her least forgiveable crime I suspect was this: she was the only person who listened more than he - "greedily", he records. He secretly liked talking better than listening: she spotted and elicited his Mr Toad-like boastfulness. There can be such a thing as "listener's rape", where the person confiding comes to feel his privacy has been violated, his inner being "robbed". Canetti himself gloats over Carol Stewart's and Raine's confidences and dependency on him alike. Murdoch's ultimate crime was to listen, steal and cannibalise her friends' lives with more inwardness than Canetti.
Few read Canetti's Auto-da-Fé twice. Fewer still read his Crowds and Power, with its banalities such as "The Englishman sees himself as captain on board a ship". Murdoch gave it a rare favourable review. Canetti has a cult audience and is now remembered partly because of his liaison with Murdoch. Her worldwide readership remains. His image of the scheming yet obtuse slut showing off her breasts takes its place in the complex gallery of Murdoch portraits. By contrast he spawned in her not just mysterious power-broking Mischa Fox, but also demonic puppet-master Julius King in A Fairly Honourable Defeat, and rapacious woman-hating tyrant Charles Arrowby in her Booker-winning The Sea, The Sea. Her answer to Canetti's misogyny is exactly this showroom of monstrously egotistical men. Each novel features a Wizard of Oz who saves the fiction from high-mindedness before being exposed as pitiful. He used to boast that he had helped make her a writer. This was truer than ever he understood. Where she draws blood in her fiction, a reflection of Canetti can often be found. "I told her everything," he bitterly laments. Small wonder he came to detest her.
Peter Conradi's biography of Iris Murdoch is published by HarperCollins.
![]()
July 17, 2005
Partying in the Blitz by Elias Canetti
PARTY IN THE BLITZ: The English Years
by Elias Canetti
translated by Michael Hofmann
Harvill £17.99 pp266
Elias Canetti escaped from Hitler’s Germany to London in 1939, and disliked it very much. He was 34, and had gained some renown back home for his novel Auto da Fe. But the English had no idea who he was, and he found their cold-hearted indifference a “torture”. At literary parties in Hampstead he felt sure they were eyeing him contemptuously. They addressed him, if at all, with icy politeness which, he was convinced, was their way of insulting foreigners and other nobodies. He began to suspect that he did not really exist, and in a bid to restore his self-confidence he would sit for hours in Hampstead cemetery, because he could at least feel superior to the occupants of the graves. The English, he concedes, behaved well in the blitz. Their calm while the bombs were falling made him “gawp in dis-belief”. But, he insists, this was merely the flip side of their unparalleled arrogance. To have shown fear would have been to behave like lesser breeds, and that was unthinkable.
In his hypersensitive state, the mere sight of people with established literary reputations brings on paroxysms of jealousy. TS Eliot, whom he scarcely knew, is denounced as a “miserable creature” exuding a “stink of enfeeblement”. His poems are “spittoons of failure”. That he should have worked as a bank clerk is regarded as a deliberate offence against Canetti’s ideal of the pure, unmercenary artist. Successful women friends prove even harder to stomach. The poetess Kathleen Raine was remarkable only for “social rapacity and snobbishness”. The historian CV Wedgwood, who generously gave up time to translate Auto da Fe into English, and persuaded Jonathan Cape to publish it, “had no ideas of her own about anything”. Iris Murdoch is recalled with particularly devastating ferocity. She and Canetti had been lovers in the early 1950s, before she published any books. In those days he was the maestro and she the humble acolyte. But by the time Canetti came to write this memoir 40 years later, their positions had reversed. He was an old has-been, she a famed sage with 24 bestsellers to her credit. The injustice of it reduces Canetti to gibbering fury. He deplores her “vulgar success”. Her origins were, he protests, “utterly petit bourgeois”, and she “had not one serious thought”. She encased her large, flat feet in “grotesque sandals”, and walked like a “repulsive bear”. Their love-encounters are maliciously recorded. She would shed her “woollen and ungainly” underwear and lie numbly on the couch awaiting his attentions. It was all utterly mechanical. The only thing that excited her was a ludicrous erotic fantasy in which she was a hapless maiden and he a brigand dragging her to his cave.
It might occur to readers to wonder why, if Murdoch was so awful, Canetti bothered to pursue the affair. But that would be to treat his account seriously, whereas it is clearly just an outflow of venom and envy. He admits that he is “shaking with rage” as he writes it. It is only when the people he meets are no threat to his self-esteem that he becomes capable of a reasoned response. He feels most comfortable when they are his social or intellectual inferiors. A philosophical street-sweeper in Chesham Bois, who talks like an Old Testament prophet, gains his affection. His funniest sequence is about a couple called the Milburns with whom he and his wife Veza lodged when they moved out to Amersham to escape the blitz. Mrs Milburn was mystically inclined and believed that evil was not real but a projection of the psyche. “What about the bombs?” demanded Veza. “The bombs are imaginary,” countered Mrs Milburn. Despite this faith, as soon as the sirens sounded both Milburns would crawl under a stout kitchen table and lie side by side, keeping as quiet as mice lest they should attract the attention of the German pilots. Mr Milburn, a retired clergyman, was regularly visited by itinerant prophetesses. One of them, whom Canetti got to know, confidently expected the second coming of Christ in the near future, and had bought a small hill in Cornwall on which, according to her calculations, he was scheduled to land.
Canetti’s observations of the English were not merely mischievous but intended as research for his treatise on mass psychology, Crowds and Power, which was eventually published in 1960 and helped win him a Nobel prize. These memoirs, released by his literary executors two years ago, and first published in Germany, reflect the same contradictions about people and his relations with them as that muddled magnum opus. He had been fascinated by crowds ever since his student days in Vienna. In July 1927, he had found himself caught up in a mob marching on the Palace of Justice. The excitement, and the feeling of being absorbed into a greater whole, remained with him, and gave him a vision of the crowd as the salvation of mankind, in which the individual escapes the burden of distance from his fellow beings. But as a Jewish refugee from Nazi Germany he was also conscious of the crowd as a mindless persecuting agent, obedient to the will of power-hungry demagogues.
The two views constantly clash. In these memoirs he laments the cold aloofness of the English, which prevents them touching one another and merging into gladsome unity. Yet his segregation of himself from such people as the Milburns, let alone Eliot and Murdoch, makes it clear that any notion of merging with them would be repellent. The figures who intrigue him are always wielders of power, whether intellectual or political. He remembers the formidably intelligent Enoch Powell quoting huge chunks of Dante and Nietzsche in their original languages, simply in the course of conversation. One of only two Conservative MPs from a humble background, Powell had had a brilliant war as a brigadier in Montgomery’s desert army, and was offered a professorship in classics at the age of 25. His racial views were abhorrent to Canetti, yet his aura of power was unmistakable.
Bertrand Russell was another centre of potency. He spoke in immaculate and serene 18th-century English, reminiscent of Horace Walpole’s letters, but would suddenly break out into a wild, goat-like laugh that betrayed his animal passions. Canetti remembers watching him at a glittering reception, arguing incisively with a group of powerful and famous men. Nearby stood a stunningly beautiful young woman. It was clear they had never met before. But when he saw her he burst into his goatish laugh and they promptly left together as if they had an assignation — the 80-year-old, with the 20-year-old trotting obediently beside him. “As he left, he continued to laugh, while she became more beautiful at every stride.” With writing of that quality, mediated through Michael Hofmann’s versatile translation, you need no further incentive to go on reading Canetti, for all his self-pity and paranoia.
READ ON...
websites:
http://nobelprize.org/literature/laureates/1981
Canetti on excellent Nobel
site

Issue: 23 July 2005
The God-Monster of Hampstead
Reviewed by Ferdinand Mount
Party in the Blitz: The English
Years
Some quite bad writers have won the Nobel Prize for Literature —Pearl Buck is the most notorious. So have some great men who are better known for other, not strictly literary endeavours, such as Churchill and Sartre. Many more laureates have written in small-circulation languages which you wonder if the judges are qualified to judge.
But I can think of only one Nobel literary laureate of whom you might be tempted to ask: what exactly has he won it for? When Elias Canetti was awarded the Nobel in 1981, he had published only a scattering of assorted things, mostly rather slight: three farces, a travel book, a few essays, one novel published 45 years earlier, two-thirds of an autobiography (his most evocative and attractive work), plus what I suppose might be described as a work of popular social anthropology, Crowds and Power.
Yet nobody much at the time gainsaid Canetti’s claim to the Nobel. For it was tacitly (and sometimes openly) agreed that his supreme work of art was himself. When he arrived in England, as Jeremy Adler remarks in his introduction to Party in the Blitz, a posthumous montage of Canetti’s writings about England, ‘initially he did not owe his reputation to his publications but rather to the force of his personality’. And that remained the case even as his fame grew. For his lover Iris Murdoch, he was the magus, both the subject and the dedicatee of her second novel, The Flight from the Enchanter. Her husband, John Bayley, less enchanted by Canetti, particularly by his cruelty to Iris, christened him the God-Monster of Hampstead. Canetti himself says, ‘My chief trait, much my strongest quality, which has never been compromised, was the insistence on myself … It may be a sort of virtue.’ Or it may not.
This self-centredness reaches marvellous heights in his contempt for other living writers. T. S. Eliot was a ‘miserable creature’. Kathleen Raine was a tedious whinger who committed the unforgivable sin: ‘Not for a moment did she see me as a writer, the little she was able to read of mine struck her as tasteless, though she was careful never to tell me so. I, however, always knew it, and thought with some satisfaction how little her poems did for me.’ As for Iris, ‘she has not one serious thought … Everything I despise about English life is in her … I don’t think there is anything that leaves me quite so cold as that woman’s intellect.’ Except perhaps her body — which he nonetheless took advantage of whenever she offered it. His descriptions of their lovemaking are so chilling that you have to read them twice to make sure you have read them properly.
There is one shining exception to these bilious denunciations of his literary contemporaries and supposed friends and lovers: the great Chinese scholar-translator Arthur Waley. No prizes for guessing why. Waley was the only man in England who had read Canetti’s novel before the war and loved it.
At times, Canetti reminds me disgracefully of the Russian novelist Vladimir Brusiloff in The Clicking of Cuthbert: ‘No novelists any good except me. Sovietski-yah! Nastikoff-bah! I spit me of zem all. No novelists anywhere any good except me. P. G. Wodehouse and Tolstoi not bad. Not good, but not bad.’
He was born 100 years ago this year into a cultivated Sephardic family of a line long settled in Turkey but more recently in Bulgaria. En famille, he and his wife Veza spoke Ladino, the Spanish dialect amazingly preserved among Jewish families expelled from Spain four centuries earlier. But English was the first language he learnt to read in, though he always wrote in German, and he first came to England in 1911, to Manchester where his father died of a stroke the day after his wife had told him she had fallen in love with her doctor — a crucial trauma in Canetti’s life and movingly recounted in his first memoir, The Tongue Set Free. After fleeing the Nazis, he and Veza finally settled in Hampstead in February 1939, amid the large refugee community which at that time constituted nearly half the borough’s population. Apart from a brief intermission in Chesham Bois during the Blitz, they lived there until Veza’s death. In his last years he moved to Zürich with his second wife, where he died in 1994.
Throughout the war and for some time afterwards, he was deeply admiring of the fortitude and tolerance of the English, and he became a British citizen. In 1951 he declared, ‘I now feel completely at home in England, especially in London. I can now become an Englishman with a good conscience.’
But this fellow feeling curdled with the passage of time. He began to detect ‘a smell of weakness’ in the English. He had come to loathe the insipidity of their conversation, the coldness of their manners, their awful stodginess. Even their famous tolerance was linked to their Gefühlsimpotenz. Above all, he loathed their parties, those appalling Nichtberührungsfeste. Professor Adler calls this term utterly untranslatable, but I think ‘non-contact sports’ will do quite nicely. These postwar gatherings in Hampstead or Chelsea or Kensington struck him as ‘senseless and heartless, every bit in keeping with such cold people’. There was no touching, no intimacy, no curiosity. Adler points out that Canetti failed to take in (or did not live long enough to see) the kissing, hugging, crying, confessing post-Diana England. One can, however, be sure that he would have abominated that too.
Canetti’s portrait of England is frozen in time, as most such portraits of national character tend to be. It took me a while to think what it most closely recalled. Then I realised that it was just like The British Character, that series of drawings by Pont of Punch first collected in book form in 1938. There they all are, the qualities first admired and then denounced by Canetti: Refusal to Admit Defeat, Importance of Not Being an Alien (the squat, underdressed Continental amid the horse-faced English in white ties even bears an eerie resemblance to the younger Canetti), Love of Keeping Calm, Absence of the Gift for Conversation, Importance of Not Being Intellectual, and above all Reserve.
The actual party in the Blitz took place in Roland Penrose’s house in Downshire Hill. It was a lascivious, unbuttoned affair, not at all a Nichtberührungsfest. On each floor there were couples embracing and dancing, while down in the basement sweating firemen were passing out buckets of sand to protect the houses that were burning in the neighbourhood. The firemen and the dancers seemed quite oblivious of each other. One can imagine one of Pont’s furiously crowded, smoky, cross-hatched drawings depicting the scene, entitled no doubt The Blitz Spirit.
This then is a period piece which suffers from being written at the end of Canetti’s life, half a century after the period it describes. It is assembled from a jumble of shorthand manuscripts, notes and diaries, although it excludes (wrongly, I think) those passages that Canetti explicitly classified as ‘Diaries’ and stipulated were not to be published until 30 years after his death. So the book has a thin, spatchcocked feel. Adler candidly tells us that there was some discussion as to whether the book should have been published at all. Moreover, Canetti himself in extreme old age confesses, ‘When I talk about England, I notice how wrong it all is.’
Wrong quite often in details. He speaks of a Church of England clergyman who begins to doubt the Thirty-Seven Articles of his Faith. He admires Bertrand Russell for nobly declining the dukedom of Bedford. He tells us equally breathlessly and erroneously that Enoch Powell was one of only two Tory MPs from humble backgrounds and had distinguished himself by his bravery as a brigadier in Montgomery’s Desert Army. No doubt Powell would have, given half a chance, but in fact he served out the war as a staff officer of Widmerpoolian assiduity.
For all that, Canetti’s description of Enoch discoursing unstoppably on Dante and Nietzsche at a staid Tory soirée has a bite and vivacity to be found in others of his vignettes of English intellectual life, of dinner with Bertrand Russell with his ‘goatish chuckle’, of visiting that tragic Professor Branestawm figure, Geoffrey Pyke, who almost persuaded Mountbatten to build battleships out of blocks of ice, to be known as Pykrete.
These portraits achieve that pithy, abrupt quality that Canetti so admired in Aubrey’s Brief Lives. And for them alone Party in the Blitz was well worth publishing, even though it is spoiled by Canetti’s irrepressible habit of generalising from insufficient evidence. For instance, he repeatedly curses the English obsession with saving time, giving as his prime example the Labour politician Douglas Jay saying to a woman, ‘I’ve got five minutes’ before taking off his trousers. But that is surely the impatience of lustful politicians the world over. Why else is President Chirac nicknamed ‘Fifteen-minutes-including-the-shower’? Marlene Dietrich claimed that JFK fitted her into a half-hour slot. Mussolini too was no slouch, given any convenient flat surface to lay a woman on.
In the end, Canetti only seems to like people in England to the degree that he can identify them as not English, for example, the historian C. V. Wedgwood, who, he says, had none of the sluggish reserve of so many English people, her dark looks, warmth and quickness coming from her Celtic ancestors. Of course, ‘I do not think much of her own writings, she was unoriginal, had no ideas of her own about anything’ and — this was the limit — she adored Mrs Thatcher (Canetti never quite abandoned his leftist politics, though he kept his prewar association with Brecht rather dark). However, Veronica could be forgiven much because she was an enthusiast for Canetti’s novel, persuaded Jonathan Cape to publish it and volunteered to translate it herself.
And it is her translation which Harvill has used in reissuing, for Canetti’s centenary, Auto da Fé as it was called when it came out in Britain in 1947. The book was first published in 1936 as Die Blendung — the Blinding or Deception — and later in the US as The Tower of Babel, this variety of titles suggesting a smidgeon of uncertainty as to what the book was actually about. Veronica Wedgwood’s translation is stilted and clumsy and now and then, I think, mistakes the sense. I doubt whether this matters. Even if Englished by a master craftsman like Michael Hofmann (who has done Party in the Blitz beautifully), Auto da Fé would still be unendurable.
I do not mean that it is impossible to be carried along for a few pages by Canetti’s prose, which is never less than lucid and fluent. It is just that the story is at the same time so whimsical and so crass, its allegorical subtext so leaden and brutish that it subverts its own subversion, or, to put it less politely, disappears up itself. A distinguished sinologist, Peter Kien, who lives a crazy, reclusive life obsessed by his enormous library, is tricked out of his inheritance by, among others: his housekeeper, later wife, a lubricious, greedy peasant woman; an evil, chess-playing, hunchbacked dwarf; and a lecherous blind man. From time to time he is abused and beaten up by a crowd of Bosch-like lumpenproles. And all this happens over and over again, quite relentlessly, for nearly 500 pages.
The blurb claims that Auto da Fé still ‘towers as one of the greatest novels of the 20th century’. I find it hard to believe that it towered as one of the greatest novels of 1936. The epithet ‘Kafkaesque’ will no doubt be trotted out for the occasion. But if Kafka had treated the theme, he would have done it in 20 light, haunting, allusive pages which would have left the reader dangling in an exquisite uncertainty. Another point much insisted on by Kafka’s compatriot Milan Kundera is that Kafka manages in some mysterious way to be very funny. Auto da Fé is no joke.
Those drawing up the Nobel citation obviously had some difficulty deciding precisely what Canetti was on about, referring cautiously to ‘his broad outlook’ and ‘his wealth of ideas’. In fact, I think that his outlook was quite narrow and his governing idea was a relatively simple one. In all his work he is haunted by the fear of the crowd.
In Crowds and Power, he purports to offer a typology of crowds, dividing them up into the open crowd, the closed crowd, the baiting crowd (or lynch mob), the lamenting crowd (or cortège), the flight crowd (or panic-stricken mob), the feast crowd and so on. Then he moves on to draw analogies between these modern types of crowd and the war packs of the Amazonian Indians, the rain dances of the Pueblo Indians, the kangaroo hunts of the Australian aborigines, the Bushmen etc. Except that he does not actually draw such analogies, but for the most part merely displays his examples alongside one another, leaving readers to draw their own conclusions. These examples are collected from a wide variety of sources — the book took more than 20 years to write, but despite this long gestation it is remarkably free from analytical thought. Large parts of it read like an upmarket version of Desmond Morris’s books in which the behaviour of chimps and hyenas is assumed to throw important light on human behaviour, but only by a loaded reasoning that selects only those features of animal behaviour that resemble human behaviour and discards those that do not.
‘The crowd is the same everywhere,’ Canetti asserts, ‘in all periods and cultures; it remains essentially the same among men of the most diverse origin, education and language. Once in being, it spreads with the utmost violence. Few can resist its contagion.’ This sweeping thesis is assumed throughout the book but never proved. Nowhere does Canetti bother to refute the possibility that evolution or history might have modified crowd behaviour. Nor does he offer proof that violence, panic or persecution is confined to men acting in crowds. Yet surely people also fight, lynch, murder, persecute, take fright, feast, mourn and hunt in one and twos and fours and dozens, according to time, circumstance and convenience.
Crowds and Power is in no sense a rational inquiry. It is a violently tendentious tract, inspired, like Auto da Fé, by the ghastly experiences of the mob which, quite understandably, obsessed the European intellectual in the 1930s. Although not actually published until 1960, it belongs on the same shelf as Ortega y Gasset’s Revolt of the Masses (1929). You can find this fear of the masses almost anywhere you look in the highbrow English literature of the period, in Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Aldous Huxley.
It would of course be possible to argue the precise contrary, that, then as now, it is small vanguards of pseudo-intellectuals, usually armed with some debased ideology, who inject the real poison and that crowds are a neutral phenomenon capable of just as wide a range of behaviour as individual human beings. But that is not what the intellectual wishes to believe. For him the only hope lies in the solitary, unillusioned mind, that is, in himself.
Need we look further for an explanation of the huge success that Canetti enjoyed in his later years? He was indeed a writer of some grace, wide learning and considerable critical acuity, and he had paid close attention to the terrible events of the century he nearly spanned. But none of this would have elevated him to the status of magus. What he illustrated as much by his life as by his work was that a solitary intellectual, without friends or funds or even a country to call his own, could come out on top, that the life of the mind was the life that mattered. What did the trick was his appeal to the self-esteem of intellectuals everywhere. He raised them above the dangerous, dull-witted crowd, and they in turn raised him.
22-7-2005

taz Nr. 7722 vom 22.7.2005, Seite 15, 336 Zeilen (Kommentar), OLIVER PFOHLMANN
Sven Hanuschek: "Elias Canetti. Biographie". Carl Hanser Verlag, München, Wien 2005. 800 S., 29,90 Euro
Kristian Wachinger (Hg.): "Elias Canetti - Bilder aus seinem Leben". Carl Hanser Verlag, München, Wien 2005. 176 S., 25,90 Euro
Früh vollendet, spät gezündet
Hüter der Verwandlungen, ständig verstrickt im intellektuellen Kampf mit dem Tod: Zum 100. Geburtstag von Elias Canetti am Montag liegen die erste Biografie und ein Bildband zu Leben und Werk des Nobelpreisträgers und geplagten Paschas vor
VON OLIVER PFOHLMANN
Er war der Herr der Bleistifte. Gespitzt und pedantisch nach ihrer Größe geordnet, lagen immer bis zu 40 Stück auf seinem Schreibtisch. Die Gewissheit, dass ihm sein Schreibgerät im Schaffensrausch nicht ausgehen würde, war ihm wichtig. Vermutlich ebenso, mit den Bleistiftkolonnen Besucher beeindrucken zu können. "Zwanzig Bleistifte abgeschrieben, in einer Nacht", heißt es einmal im Nachlass des großen Übertreibungskünstlers. "Man könnte denken, dass ich etwas tue." Die längste Zeit seines Lebens war der am 25. Juli 1905 im bulgarischen Rustschuk als Sohn sephardischer Juden geborene Elias Canetti eine Art Geheim-Genie ohne Werk. Nur Eingeweihte kannten seine Bedeutung. Sich dem Publikationszwang verweigernd, der seine künstlerische Reinheit befleckt hätte, bekannte er hochmütig seine "Verachtung für Leute, die ihren Erfolg nicht bald abzuwürgen verstehen". Schon 1928 will er sich als literarischer Nobody in Berliner Kaffeehäusern mit Bertolt Brecht angelegt haben, weil der sich und seine Kunst verkaufte. Canetti blieb bis Ende der Sechzigerjahre lieber auf Zuwendungen von Angehörigen oder Geliebten angewiesen. Zur Freigabe selbst marginaler Auftragsarbeiten musste ihn seine erste Frau Veza geradezu nötigen, mitunter drohte sie mit Scheidung.
Dass es nach Erscheinen seiner Stücke "Hochzeit" und "Komödie der Eitelkeit" und seines grandiosen Romansolitärs "Die Blendung" im Wien der Dreißigerjahre noch mehr als drei Jahrzehnte dauerte, bis Canetti berühmt war, lag gewiss nicht allein an den Zeitläuften, die ihn aller Fiktion abschwören ließen. Im englischen Exil brütete der von einer grenzenlosen anthropologischen Neugier angetriebene Menschensammler über seiner Theorie der Masse, als wäre ausgerechnet seine Lebenszeit nicht begrenzt. Noch in seinen letzten Lebensjahren kündigte Canetti vollmundig neue Romane an, ebenso eine Fortsetzung seines 1960 endlich doch erschienenen Riesenessays "Masse und Macht", mit dem er sein "Jahrhundert an der Gurgel zu packen" suchte, und, natürlich, seine definitive Anklageschrift gegen seinen größten Feind, den Tod. Leser seiner Autobiografie, die Canetti 1981 den Nobelpreis bescherte, wissen: Seiner eigenen Bedeutung war sich der Monomane stets und schon früh gewiss.
Dass er auch Selbstzweifel hatte, dass er seinen berüchtigten bösen Blick ebenso auf sich selbst richten konnte, erfährt man erst jetzt, nach Ablauf der ersten von ihm verhängten Sperrfrist für den in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrten Nachlass. Sven Hanuschek hat nun als Erster die über hundert Schachteln voller Materialien, Entwürfe und Verworfenem erkundet, hat auch das, wie er es nennt, "Zentralmassiv" Canettis bestiegen: all die Hefte mit den in mehr als fünfzig Jahren nahezu täglich verfassten "Aufzeichnungen". Von diesen abertausenden von funkelnden Aphorismen, abgründigen Gedankenexperimenten und waghalsigen Selbsterkundungen ist bislang nur etwa ein Zehntel publiziert; für Hanuschek bilden sie das eigentliche Hauptwerk des "Hüters der Verwandlungen".
Das Allerheiligste blieb dem Biografen allerdings verschlossen, nämlich der noch bis 2024 gesperrte lebenslängliche Dialog Canettis mit dem "grausamen Partner" Tagebuch. Hanuscheks Pionierarbeit verrät: Privatim lamentierte Canetti unentwegt darüber, dass sein Schreiben keine greifbaren Ergebnisse mehr zeitigte. Er erteilte sich selbst Arbeitsaufträge, um sie dann doch nicht auszuführen, beschimpfte sich als "brunnenfaul" und rechtfertigte sich am Ende mit der wenig tröstlichen Einsicht, eben kein Künstler zu sein.
Hanuscheks Biografie bietet jedoch auch eine einleuchtende Erklärung für dieses literarische Desaster: Es war vor allem das im englischen Hampstead seit den Vierzigerjahren von Canetti selbst geknüpfte Beziehungsnetz, das sich verselbstständigte und den Autor zunehmend lähmte. Da spielte Canetti, erstaunlich genug, als mittelloser Exilant für eine wachsende Gemeinde aus Künstlern und Intellektuellen den Guru und Propheten. Da hatte er, nicht weniger erstaunlich, als kleiner, dicklicher Mann gleich einen ganzen Harem von anspruchsvollen Geliebten am Hals, darunter vor allem seine Schülerin Friedl Benedikt und die vermögende Malerin Marie-Louise von Motesiczky, alle offiziell geduldet von seiner Haupt- und Ehefrau Veza, die Canetti offenbar nach einer Fehlgeburt alle Freiheiten gab und ihm gegenüber in die Mutterrolle schlüpfte. "Eine klagt, die Andre torkelt, und die Dritte atmet durch Kiemen. Der glückliche Besitzer von drei ganz verschiedenen Frauen", zitiert der Biograf den geplagten Pascha. Und prophezeit, dass die Tagebücher dereinst genauere Auskunft über Canettis erste Ehe geben werden, ein "Horrorkabinett" an wechselseitigen Abhängigkeiten. Besonders Vezas Suizidfantasien waren es, die Canetti jahrzehntelang terrorisierten.
Das hinderte ihn freilich nicht, sie nach ihrem Tod 1963 heilig zu sprechen. "Wer wirklich geliebt sein will, der braucht nur zu sterben", hatte er bereits zehn Jahre zuvor beim Tod der von ihm verstoßenen Friedl Benedikt notiert, nun schien er aus der Trauer gar nicht mehr herausfinden zu wollen - und war doch schon längst mit der fast dreißig Jahre jüngeren Hera Buschor zusammen, einer Schweizer Restauratorin, die 1971 seine zweite Ehefrau wurde. Canetti, der "Oger", der "Menschenfresser": Spätestens seit Peter Conradis 2001 erschienener Biografie über Iris Murdoch ist das Bild vom Humanisten und Kosmopoliten Canetti verdrängt worden von dem des "Gott-Monstrums von Hampstead", das intrigierte und manipulierte, Frauen hörig machte und durch seine manische Eifersucht in den Wahnsinn trieb. Nicht ohne ironischen Unterton stellt daher Hanuschek die Frage: "War Elias Canetti ein ,guter' oder ein ,böser' Mensch?"
Die Vorwürfe zugleich bestätigend wie relativierend, kommt er zu einem wenig befriedigenden, weil ganz Canettis Selbstbild verhafteten Ergebnis: Canetti sei eben ein "proteischer" Autor gewesen, der alle menschlichen Möglichkeiten in sich hatte und erkunden wollte - damit ließe sich freilich selbst ein Mord rechtfertigen.
Die Widersprüche zwischen Fremd- und Selbstbeschreibung im Fall Canetti bekommt Hanuschek zu wenig in den Blick. Hanuscheks Handicap ist jedoch die vom Dichter selbst vorgelegte dreibändige Lebensgeschichte. Da er das vermeintlich längst Bekannte nicht einfach nacherzählen will, beschränkt er sich für die erste Lebenshälfte Canettis darauf, die Autobiografie mit den Entwürfen und verworfenen Kapiteln aus dem Nachlass zu konfrontieren und zu ergänzen. So wird die "Dokumentarbiographie" zu einem eindrucksvollen Kommentar und Korrektiv und trägt bedeutende, aber verschwiegene Freundschaften nach wie die mit dem Sozialisten Ernst Fischer: Veza fehlte, wie jeder sehen konnte, der linke Arm, aber Canettis machten daraus ein Tabu, und als Fischer es brach und die Behinderung publik machte, wurde er kurzerhand aus der Autobiografie gestrichen.
Ebenso zeigt Hanuschek, dass der für Canetti typische Mechanismus der nachträglichen Aufwertung bereits beim Tod der übermächtigen Mutter Mathilde 1937 ablief. Canetti-Kenner werden Hanuscheks Biografie daher mit Gewinn lesen; für diejenigen, die diesen Autor erst entdecken wollen, dürfte sie sich dagegen als sperriger Einstieg erweisen, setzt Hanuschek doch merkbar die Kenntnis von Canettis Darstellung voraus. Viele folgenreiche Begebenheiten gehen in der vom Biografen aufgehäuften Faktenmasse unter, darunter das vom Großvater verhängte "Ur-Verbot", zu töten, nachdem der kleine Elias, die Axt in der Hand und ein entschlossenes "Jetzt werde ich Laurica töten!" auf den Lippen, auf seine Cousine losging. Oder sie fehlen ganz wie jener im Dienste der emotionalen Abhärtung verordnete Klassenausflug in ein Züricher Schlachthaus, wo der Musterschüler seinem Lehrer ein entsetztes "Mord!" entgegenschleudert.
So sind die letzten Kapitel, für die keine erdrückende Vorlage Canettis existiert, die gelungensten. Sie erzählen die Geschichte einer späten Sozialisation, einer privaten wie literarischen. Denn Canetti war nicht nur ein Frühvollendeter, er war auch ein Spätzünder. Seiner jungen zweiten Frau gelingt es spielend, den "faunischen Charakter" in Zürich an die häusliche Leine zu legen, und sie macht den 67-Jährigen zum glücklichen Vater einer Tochter. Parallel dazu entfaltet sich endlich der literarische Ruhm Canettis, der sich jetzt über jeden Literaturpreis freut, als sorgendes Familienoberhaupt nun wie um sein Leben publiziert und bald schon seine Verleger mit immer höheren Honorarforderungen drangsaliert. Werke wie "Die Stimmen von Marrakesch" (1968) und "Die gerettete Zunge" (1977) machen ihn zum Bestseller-Autor.
Das Glück des späten Ruhms spiegelt sich auch in den Fotografien wieder, die der von Kristian Wachinger zusammengestellte Bildband zu Leben und Werk enthält. Denn der Band beschert dem Leser nicht nur eine Begegnung mit vielen Gestalten des Canetti-Kosmos wie dem gelähmten Thomas Marek alias Herbert Patek oder dem Kaffeehaus-Weisen Abraham Sonne, der so gesprochen haben soll, wie Musil schrieb: Er zeigt auch auf vielen der späten Porträts einen gelösten, ja herzlich lachenden Canetti - und das, obwohl ihn das Schicksal immer mehr zu dem werden ließ, was er am wenigsten hatte sein wollen, einem "Überlebenden". Selbst seine zweite Frau musste er 1988 noch zu Grabe tragen. Doch sogar mit seinem größten Feind schloss Canetti am Ende eine Art Waffenstillstand. Die Aussicht auf ein Ehrengrab gleich neben James Joyce mag ein wenig geholfen haben. In der Nacht vom 13. auf den 14. August 1994 starb der zeitlebens gegen den Tod Protestierende friedlich im Schlaf.

04.07.2005
Sven Hanuschek:
Elias Canetti. Biographie. Hanser Verlag, München 2005, 800 Seiten,
Preis 29,90 Euro,
ISBN 3-446-20584-5
Elias Canetti hat seinen Biografen gefunden. Wenn auch nur seinen vorläufigen,
sind doch wichtige Teile des Nachlasses immer noch gesperrt. Die umfangreiche
Biografie von Sven Hanuschek erschien zum frühestmöglichen Zeitpunkt, denn
Canetti verfügte 1994, in seinem Sterbejahr, dass in den ersten zehn Jahren nach
seinem Tod keine Biografie erscheinen dürfe.
Hanuschek ist sich bewusst, dass Canetti, der alles kontrollieren wollte und
einen früheren biografischen Versuch verhindert hat, sein Buch nicht
beeinflussen konnte: „Canetti hat mich nicht gewählt. Er hat einige
Anstrengungen unternommen, gar nicht zum Thema einer Biografie gewählt zu
werden.“
Hanuschek konnte vor allem auf die seit Sommer 2002 zugänglichen 130 Schachteln
des Nachlasses, die zusammen mit Canettis 20.000 Bände umfassender Bibliothek in
der Zürcher Zentralbibliothek aufbewahrt werden, zurückgreifen. Weitere 20
Schachteln sind bis Sommer 2024 gesperrt. Daher Hanuscheks Anmerkung: „Elias
Canettis Lebensgeschichte enthält weiterhin eine Fülle von Geheimnissen, die mit
diesem Buch offen gelassen, zum Teil auch erst als Geheimnisse sichtbar werden.“
Der Autor hat ein sensibles und überzeugendes Buch geschrieben. Er hat an den
vielen Lebensorten Canettis - Rustschuk, Manchester, Wien, Zürich, Frankfurt,
Berlin, London - recherchiert und konnte auch auf wichtige Dokumente und
Korrespondenzen aus dem Besitz Georg Canettis - des Bruders des Schriftstellers
- zurückgreifen. Neben einer Interpretation von Canettis Werken hat er auch
dessen intellektuelle Freundschaften analysiert, wobei die Passagen über Gershom
Scholem am gelungensten sind. Sie erinnern an Canettis Bücher in Fania Scholems
Wohnung; sie blieben dort noch bis zu ihrem Tod, während sich die meisten
anderen Bücher der Bibliothek Scholems bereits in ihrem neuen Zuhause in der „Scholem
Library“ in eigenen Räumen in der Hebräischen National- und
Universitätsbibliothek befanden.
Canetti war zwar nie in Israel - Scholem versuchte ihn zu einem Besuch zu
überreden -, aber er weigerte sich, „solange es keinen Frieden zwischen Juden
und Palästinensern gibt.“ Aber mit dem großen israelischen Gelehrten Scholem
verband ihn eine intensive Beziehung. Canetti warf Scholem die „Verblendung“
vor, „mit der er alles liest, was sich auf die Haltung von Menschen zu ihrem
Judentum bezieht“. Scholem dagegen respektierte Canetti auch wegen seines
Großonkels, „der eine sechsbändige Geschichte der Juden auf dem Balkan
geschrieben hat“.
Hanuschek verschwieg aber auch nicht Canettis polygame und prägende Beziehungen
zu den Frauen seines Lebens - Veza Canetti, die Malerin Marie-Louise von
Motesiczky, die aus der berühmten Familie Todesco und Lieben stammt, die
Schriftstellerin Friedl Benedikt, die Enkelin Moriz Benedikts, des Herausgebers
der „Neuen Freien Presse“, die unter dem Namen Anna Sebastian publizierte, und
die Schweizer Restauratorin Hera Buschor, Canettis zweite Frau und die Mutter
seiner späten Tochter Johanna - und die aus den teils parallel laufenden
Beziehungen entstandenen Verletzungen. Ebenso würdigte er die eigenwillige und
willensstarke Persönlichkeit Veza Canettis und ihr spät entdecktes
schriftstellerisches Werk. Ihr Geheimnis, das Fehlen ihres Armes, dessen Gründe
nicht bekannt sind, wurde vom Ehepaar Canetti bewahrt, niemals angesprochen und
schließlich von Ernst Fischer in dessen Erinnerungen nach dem Tod Veza Canettis
enthüllt, was den Bruch zwischen Canetti und Fischer zur Folge hatte.
Was das Buch aber vor allem so lesenswert macht, ist, dass sich Hanuschek trotz
aller Empathie der Schattenseiten von Canettis Charakter bewusst ist: seiner
Eitelkeit, seiner Eifersucht und seiner Depressionen, die ihn die Reinschrift
des vierten Bandes seiner Autobiografie vernichten ließen. Auch die Motive für
die Vernichtung seiner Korrespondenz mit Veza Canetti bleiben im Dunkeln.
Hanuscheks Biografie ist bisher in Wien nicht vorgestellt worden. Aber
anlässlich seines 10. Todestags wird das Wiener Jüdische Museum Ende Juli eine
bereits in Zürich gezeigte Ausstellung über Canetti übernehmen.
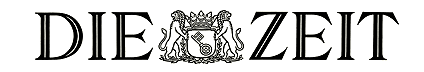
29/2005
Elias Canetti
der 1981 den Literaturnobelpreis erhielt, wäre am 25. Juli 100 Jahre alt geworden. Wir drucken vier zum ersten Mal veröffentlichte Erzählungen und Prosaminiaturen. Sie stammen aus den so genannten Stenogrammen, die im Nachlass der Züricher Stadtbibliothek liegen und bis zum Jahr 2002 gesperrt waren, dem Willen des Autors entsprechend. Schon in jungen Jahren gewöhnte Canetti es sich an, seine Texte in Kurzschrift zu notieren, die er als Geheimschrift bezeichnete. Später übertrug er sie in normale Schrift und überarbeitete sie. Die Stenogramme, die allesamt aus den Jahren 1933 bis 1942 stammen, sind erst jetzt entziffert worden. Canetti übt in ihnen den Dialog, die Parabel, das Porträt. Man begegnet ihm hier schon ganz: seinem unerschrockenen Zugriff, dem analytisch geschärften Blick und der ins Groteske hineinspielenden Fantasie.
In einer sehr späten Zeit, als die Erde schon alt und übervölkert war, erschien plötzlich, niemand wußte woher sie kam, eine Frau, die viel Platz brauchte.
Die Menschen waren schwer und reich geworden. Einer hockte neben dem andern auf eigenem Besitz. Auf jeden kamen vier Quadratmeter Boden. Alle Meere waren entwässert und alle Gebirge abgetragen. Die Gebirge lagen in den Meeren. Doch hatten sie zur Füllung nicht ausgereicht; die gesamte Erdoberfläche lag um ein Beträchtliches unter dem früheren Meeresspiegel. Jahrhunderte hatten zu diesem nivellierenden Werke beigetragen, auf das die dicken Menschen nicht wenig stolz waren. Sie lebten in erstaunlicher Enge. Glatt wie ihre Erde war auch die Haut geworden, die sich über ihre fetten Körper spannte. Mit der Eroberung der Meere hatte die Vermehrung der Menschen Schritt gehalten. Sie waren zahllos wie der Sand, den es jetzt nicht mehr gab, sehr viel weniger beweglich; kein Wind trieb sie davon, kein Sturm kam von den alten Meeren her, nach Menschendünen hätte man vergeblich gesucht. (…)
In einer so eingesessenen, festgesessenen, ganzversessenen Zeit bewegten sich die Menschen überhaupt nicht mehr. Zwei Schritte hin, zwei Schritte her war alles, was sie sich erlaubten, und selbst das wurde ihnen oft zu viel. Man rief einander über die halbmannshohen Zäune zu: »Wie geht es, sind Sie heute schon gegangen?« – »Leider nein, ich habe heute noch zu gehen, ich bin ja so verzweifelt.« – »Ärmster, ich hab es heute schon hinter mir.« – »Wirklich, wie ich Sie beneide!« – »Sonst gehe ich eigentlich immer später als Sie. Wie ist Ihnen? Fühlen Sie sich nicht wohl? Vielleicht eine kleine Unpäßlichkeit.« – »Ich weiß es selbst nicht. Meine Beine sind so müde. Ich fürchte, heute werde ich viel Plage mit ihnen haben.« – »Dann lassen’s Sie doch heute. Einen Tag können Sie aussetzen. Was schadet das?« – »Meinen Sie.« – »Glauben Sie, Ihr Sitz wird schlechter davon?« – »Ich glaube gar nichts. Sie jedenfalls sind schon gegangen.« – »Das leugne ich gar nicht. Das habe ich Ihnen ja eben selbst erzählt.« – »Aber ich soll nicht gehen.« – »Wenn Sie sich so elend fühlen.« – »Das hab ich nicht gesagt.« – »Ich entnehme es Ihren Worten.« – »Es liegt Ihnen viel daran, mich zu mißverstehen.« – »Im Gegenteil. Ich verstehe Sie jetzt gar nicht mehr.« – »Bitte.« – »Bitte.«
Beleidigt pflegte man einander den Rücken zu kehren, man hatte ja noch andere Nachbarn. Zum Glück war man auf diesen einen nicht angewiesen. Da die Nachbarn einander sehr glichen, verliefen die Gespräche alle gleich. Es blieb nach ihrer Beendigung eine tiefe Unzufriedenheit zurück. Man überstand sie, indem man dann wirklich ging. Zwei Schritte hin, zwei Schritte her, und das wiederholte man oft ganze fünf Minuten lang, bis man erschöpft in sich zusammensank (und dann gab man sich den letzten Stich und sank hin und war tot).
Der Ruhelose kommt an einen Platz, der mit allem versehen ist, was er zu seinem Leben braucht. Nach einer Seite ist der Platz offen. Auf der andern Seite direkt eine große Station für die Straßenbahn der Stadt. Sie lief bis an diesen Platz, der nach einem Tor benannt ist und stellt sich nachts wie die Pferde in ihren Stall schlafen. Manchmal klingelt sie vor Ungeduld wie Pferde wiehern. Wenn der Ruhelose das lebende Klingeln hört und die Schienen, die aus dem Stall hinaus führen, in Erwartung des Morgens leise beben, packt es ihn wieder und er horcht und wird in diesem Horchen für wenig Zeit und für schlechte Zeit still. Aber es ist nicht nur dies allein, was in sein Leben gehört. Durch die Straßen fahren nachts schwere Autobusse. Geht man aber bei beiden Straßen je einige Treppen in die Tiefe hinab, so stößt man auf die ganze unterirdische Welt der Untergrundbahn, eine geheime Stadt für sich, Beschleunigung der Linie über der Erde, man freut sich dieser Treppe nicht mehr. Sie sind unbescheiden. Eigens hergerichtete Straßenecken sind mit Kaffeehäusern überzogen, deren rotes Licht viel zu weit und unverständlich hell auf die lebenden Straßen hinaus scheint. Man darf sich durch die scheinbar sitzenden Leute nicht beirren lassen. In Wirklichkeit sind alle sehr gehetzt, selbst die Sitzenden laufen und die Stehenden laufen immer auf einem Fleck. Es gibt keine ruhenden Menschen, nichts ist fest, nichts ist sicher, und das einzige, was im Haufen noch Sicherheit in sich hätte, die Häuser, ist in Wahrheit furchtbaren Gefahren unterworfen, die zu schildern hier zu weit und bis auf die Planeten hinauf führen würde. Das Bauen ist eine Illusion, die Menschen davor zu warnen. Vielleicht hat der Ruhelose seinen Weg vorzeiten angetreten.
Wenn er Leute Kartenspielen sieht, denkt er, daß die Karten eigentlich fliegen müßten, er hat in seiner Jugend schon Karten fliegen sehen, und er muß sagen, Karten fliegen schön und besonders gerade.
Sessel aber, Teppiche, Betten usw. sind für Schwächlinge erfunden worden. Es gibt Menschen, die ihre Wahrheit nicht vertragen. Die Wahrheit ist stark und hat so lange Beine wie die Lüge kurze. Um der Wahrheit zu entgehen, gibt es allerhand Erfindungen für schwache Menschen. Diese glauben manchmal in keiner Bewegung zu sein. Es macht dem Ruhelosen Spaß, ihnen zu zeigen, daß sie es sind. Er stört sie gern aus ihrer Ruhe auf und freut sich ihres Erschreckens, und ein einziges gewaltiges Erschrecken, eine rasende Angst, ist sein eigenes Leben. Warum sollen die andern sich davor drücken?
Liebespaaren zieht er den Samen aus den Hoden und das fertige Kind aus dem Mutterleib hervor. Dinge bringt er in Fluß, indem er es regnen läßt. Es regnet gern über Dinge. Zum Himmel hat der Ruhelose kein rechtes Glück. Zu oft erscheinen Gestirne an deren Stelle. Zu oft glauben ihnen die Menschen ruhig. Er wird ihn einmal rascher ins Drehen bringen.
Am wohlsten fühlt er sich im Bahnwärterhäuschen. Das existiert eigentlich nicht. Nachts sausen die Schnellzüge mitten durchs Zimmer, durch seine Träume, durch seinen Schlaf, den er nie sicher hat, durch die Stunden, zu denen Züge je eine ganz sonderbare Beziehung haben.
Züge und die Zeit durchzudenken – entscheidend für den Ruhelosen. Er vernichtet die alten Fahrpläne und führt merkwürdige neue ein.
Der Ruhelose steuert die Zeit bis zu ihrer Abschaffung.
Auch die Neugier des Ruhelosen läuft auf Schienen. Der Ruhelose haßt den Regen, der die Linien zu wild und die Straßen zu weich macht. Der Ruhelose verwirrt die Welt lieber und was aufzuklären ist, verwirrt er wieder. Er haßt Spinnennetze, wie alles was konzentrisch ist, und als seinen eigentlichen großen Feind sieht er den Kreis an; die Linie, die in sich zurück führt. Die Linien des Ruhelosen gehen in die Unendlichkeit. Er nimmt sie so ernst, daß er eigentlich an keinen Schnittpunkt glaubt.
Der Ruhelose holt die Leute aus ihren Arbeitsstätten heraus. Alle Bänder und Transmissionen sollen aneinandergereiht werden und nicht in einer Fabrik versperrt bleiben. Er weiß, daß die Telegrafendrähte eigentlich Saiten sind, und auf ihnen spielt sich die Kernharmonie der alten Pythagoräer ab. Der Ruhelose lacht über Flüsse, ihre vorsintflutliche Geschwindigkeit geht ihm nie ganz ein, er läuft jeden Fluß mit Freude hinauf, denn nie wird er die Richtung einer Bewegung eigenwillig ändern oder gar in ihr Gegenteil verkehren. Er hat Pietät vor der Richtung. Aller Streit ist ihm ein Streit verschieden gerichteter Flüsse. Das Unglück der verschiedenen Richtung hängt von der Kugelform der armen Erde ab. Arme Kugel Erde! Er läuft vielleicht um zu beweisen, daß die Erde keine Kugel ist, oh könnte er die Erde zu einer Linie ausziehen, wie eine Nudel. Und das Sitzen, das Sitzen, das Sitzen muß überwunden werden. Er behauptet, daß die fixen Ideen, an denen wir alle leiden, nicht nur etymologisch vom Sitzen herrühren.
Über das Warten: Was man erwartet, das sieht man auf sich zugehen. Der Erwartete kann mit dem oder jenem beschäftigt sein, immer geht er zugleich, das Gesicht einem zugewandt, genau so viel lächelnd, als die Freude beträgt, mit der er erwartet wird.
Der Ruhelose: Die Geschwindigkeitsunterschiede spielen in seinem Leben eine entscheidende Rolle. Es ist aufreizend, zu einem Fenster hinaus zu sehen und draußen auf der Straße zu bemerken: Fußgänger mit sehr verschiedenem Gang, selten Pferde, die kaum voran kommen, hie und da Radfahrer in lächerlicher vorgebeugter Haltung, elektrische, die alle voraus klingeln; ihre Bewegung wird durch die rote Farbe noch hervor gehoben, es sind rote eilende Flächen, beinahe Fahnen, und man ist erstaunt, keine schreienden Massen dahinter her zu hören. Überhaupt empfindet man die zu häufige Verwendung der Farbe Rot als schreienden Mißbrauch. Rot ist ja die Farbe der Flamme, und die Flamme ein hochwichtiges Massensymbol. Dann gibt es auf den Alleen der Großstädte: Blätter an den Bäumen, die eine ganz andere, mehr kreisende Bewegung vollführen. Es ist quälend, sie immer am selben Fleck herumzittern zu sehen. Die Automobile aber, die von den Fensterrahmen unten in zwei glatte Hälften zerschnitten werden, erregen durch ihre metallene Fracht. In der allgemeinen Hetzjagd von Hupen, Klingeln einige ganz feste und starre Dinge: Der Lichtmast, aus Gußmetall, grau, schlecht spiegelnd, beschattet. Die Plakatsäule von allerhand behängt, gleich dahinter, ein angefressener Lichtmast, der die Schatten des wirklichen Lichtmasts nicht bricht. Manche Menschen bestehen nur aus Hüten, und in viel zu vielen Läden stehen Blumen. Wie kommen Blumen in eine Großstadtstraße? Oder besser gesagt: Worin besteht ein Unterschied zwischen den verachteten künstlichen Blumen aus Papier und Draht und denen, die angeblich leben? Sind nicht die andern weniger künstlich, weil an ihnen wenigstens das Papier echt ist? Es gibt Tage, in Wien z. B., zu den Firmungszeiten, da die ganzen Straßen von häßlichen Papierblumen in allerhäßlichsten Farben übersät sind.
Zweierlei verfolgt ihn: die geschändete gerade Linie und der Geschwindigkeitsunterschied all dessen, was sich bewegt. Der Ruhelose kennt keine Haufen. Seine Massen bilden sich im Verlauf und Verfolgen der Linie.
Die Möglichkeit, eine Szene von drei Seiten zu beobachten, bringt einem den Schauspielern sehr nahe. Man betritt einen kleinen Raum, der von einem scheinbaren Liebespaar in der Ecke besetzt ist. Die übrigen Tische sind leer. Man setzt sich an einen in der Nähe des Paares. Durch die Spiegel, die in die Wände des Raumes eingelassen sind, wird man eines besseren belehrt. Neben den leibhaftigen zwei in der Ecke hat man weitere zwei im Spiegel links und noch einmal zwei im Spiegel gegenüber vor sich. Sie sind im Profil, en face, und in Wirklichkeit zu sehen. Ihren Ton vernimmt man einfach. Sie ist blutjung, klein und mager. Das geschminkte Gesicht täuscht ein doppelt so hohes Alter vor. Von der Nase zu den Mundwinkeln laufen zwei scharfe Schnitte. Die Augen, zwei tiefe, finster beschattete Gruben, sind beide auf ihre wahre Natur hin zu untersuchen. Wenn sie lacht, ist man davon überzeugt, daß sie weint. Blickt sie ruhig vor sich hin, so erschrickt man über ihre schmerzverzerrten Züge. Das blonde, hübsch auseinander gebundene Haar wirkt wie eine Erinnerung an ein früheres Leben. Sie zählt höchstens sechzehn Jahre. Ihre grellen Züge reizen den Mann bis zu seiner Weißglut. Er ist mager und klein wie sie, aber kohlschwarz und summt sein Deutsch wie ein Rumäne oder ein Pole. Was ihm an Leidenschaft fehlt, ersetzt er durch großartige Gebärden. Sie soll zu ihm kommen. Sie wird sehen. Sie werden sich unterhalten. Er hat ein Klavier und einen schönen Teppich, sie ist auf nichts neugierig. Er singt gleichmäßig weiter. Keine Ablehnung beirrt ihn. Er erfindet die Geschichte von einem Mädchen, dem er eben den Laufpaß gegeben hat, ihretwegen. Sie findet das unvorsichtig. Sie wird doch nicht mit ihm gehen. Die Mädchen sind kein Spielzeug. (…) Ihr Gesicht wird um ein Stück noch schmerzlicher. Demnach hat sie seine Mitteilung aufgeheitert. Er packt sie mit seinen schmalen Fingern am Kinn und blickt ihr mit Energie in die Augen. Sie entzieht sich ihm mit Verachtung. Er legt ihre Finger in seine Hand und leckt jeden einzelnen ab. Sie kümmert sich indessen nicht um ihn und runzelt die Augenbrauen über ein Bild, das ihr vorschwebt und in dem er bestimmt nicht vorkommt. Schließlich blickt sie auf und sieht sich seinen Nacken an. Es interessiert sie, ob sein Kragen sauber ist. Er beginnt wieder mit seiner leisen unaufhörlichen Melodie. Sie weint, das heißt sie lacht und verhöhnt ihn. Er ist doch gescheit. Er ist ein Psychiater. Warum weiß er das nicht? Er soll warten. Er muß sich gedulden. Ihre Stimme bleibt immer gleich kalt, seine immer gleich warm. So wie sie nicht mehr Hoffnung gewinnen kann, scheint es ihm unmöglich zu sein, die seine zu verlieren. Sie geht auf einen Augenblick hinaus. Sie will die Zeit wissen, und er hat keine Uhr. Ihre Meinung über ihn sinkt auf den Nullpunkt. Während sie nach der Zeit hinaus geht, suche ich sein Gesicht im Spiegel und erwarte seinem dreckigen Lächeln zu begegnen, mit dem unbekannte Männer einander über eine Frau verständigen, sofern sie es nicht sehen kann. Er lächelt nicht, er blickt mich ganz ernst an; er hat melancholische Grundseiten. Wahrscheinlich ist er Musiker. Sonst würde er nicht als erstes sein Klavier anpreisen. Den Teppich hat er um ihretwillen hinzu gefügt. Frauen neigen zu Teppichen. Luder sind mit Teppichen zu kaufen. Er ist kein Menschenkenner. Er merkt nicht, daß sie durch nichts mehr zu beeindrucken ist, nicht einmal mit Geld, obwohl sie es braucht. Sobald sie zurückkommt und half past three – soviel Englisch kann sie aus Stolz – verspricht er ihr neue Berge, diesmal goldene. Sie ist nicht neugierig. Sie weiß eh alles. Er sucht sie bald hier, bald dort zu fassen zu kriegen. Er macht das so ungeschickt, so zaghaft, trotzdem jeder Bewegung eine Vorbereitung voraus geht und eine exakte Ausführung sie sekundiert; er imponiert ihr nicht damit. Sie hat tausendmal mehr Erfahrung als er. Sie weiß gar nichts. Sie kann offenbar nicht einmal Englisch; von Musik oder Psychiatrie (…) hat sie nicht die leiseste Ahnung. Und doch weiß sie alles, was er will; sie weiß, was er tun wird. Sie müßte kein Wort verstehen, und sie hätte ein Buch in der Tasche. Sie kennt jede leiseste Geste, darum nimmt sie von keiner Notiz. Sie ist die Psychologin, die Wissenschaftlerin, der er gern sein möchte. Sie übersieht alles Charakteristische. Sie weiß, daß er Hosen anhat. Sie kennt das Typische und richtet danach ihr Verhalten. Darin liegt ihre Begrenztheit. Daher kommt es, daß sie trotz sechzehn schon wie vierzig aussieht (…). Denn für ein Eingehen auf ihre individuelle Eitelkeit zahlen Männer Unsummen. Ihre allgemeinen Bedürfnisse sind nicht so schwer zu befriedigen.
Der Wind hieb ihm schmerzlich um die nackten Ohren, jeder Balken des uralten Hauses schien nur da zu sein, um laut zu kreischen. Türen schlugen auf und zu, kein Schloß war vor der Willkür des Sturmes sicher. Die Schwalben unterm Dach, längst eingeschlafen, erwachten eine nach der andern, flogen plötzlich aus den Nestern hervor und schossen in rasender Eile hinauf, hinab. Die Nacht, längst schon pechschwarz, wurde immer schwärzer und dichter. Zu den schrillen Peitschentönen des Windes kam alle Augenblicke ein Klirren unsichtbarer leerer Flaschen. Wo lagen sie nur? Wer hatte sie ausgetrunken? Gleich nebenan im Walde splitterten Bäume, die älter waren als das Haus, eins, zwei in Stücke. Aufgescheuchte Vögel kamen schutzflehend zu den längst zerbrochenen Fenstern herein geflogen. Das Getöse erschreckte sie noch mehr als der Fall. Aus dem Dachboden kam ein Gewimmer; hundert eingesperrte, sich selbst überlassene Säuglinge. Doch ist es möglich, daß kein Dach mehr besteht. In diesem Zimmer hat man noch ein Dach überm Kopf. Darum sind alle Vögel hier. Das Bett hebt sich hoch und schlägt zornig am Boden auf. Bald wird es aus den Fugen gegangen sein. Holz, Haus, zahllose Fenster, Türen, Wald, Nachtvögel, Menschen erwarten den ersten Blitz. Was hie und da hell aufzückt inmitten des Zimmers sind nur schwirrende Vögel. Hier macht kein Vogel Jagd. Nachtfalter streifen an Nase und Wange, immer wieder, viele, unzählige, die Luft ist dick von kleinem Getier; niemand will fressen, alles will fliehen. Die gewaltigen Stöße des Sturmes treiben einen Strom.
Wir danken dem Carl Hanser Verlag für die Abdruckgenehmigung
more Elias Canetti, here