
20-11-2006
Startseite, hier
RUTH KLÜGER
(b. 1931)

taz Magazin Nr. 7981 vom 27.5.2006, Seite VI
Wahrheit und Dichtung
"Ich trau den Dichtern, besonders
den deutschen, nicht": Ruth Klüger untersucht in
"Gelesene Wirklichkeit" die Zusammenhänge von Fakten und Fiktionen in der
Literatur
von OLIVER PFOHLMANN
Ruth Klüger: "Gelesene Wirklichkeit. Fakten und Fiktionen in der Literatur". Wallstein Verlag, Göttingen 2006, 222 Seiten, 22 Euro
Literatur erzählt Fiktionen, erfindet Geschichte und Geschichten. Niemand würde sie deshalb heute mehr wie einst Platon der Lüge und Täuschung bezichtigen. Was aber, wenn sich die Literatur auf die Wirklichkeit einlässt? Wenn sie reale Geschichte nacherzählen will wie im historischen Roman oder im Drama? Kann sie dann lügen? Maria Stuart und Elisabeth I. etwa waren zum Zeitpunkt ihres Konflikts um einiges älter als bei Schiller - war diese Verjüngungskur nun ein genialer Kunstgriff oder eine Verfälschung der historischen Wahrheit im Dienste des Kitschs?
Jener Literatur, die sich an den Schnittstellen von Realität und Fiktion entzündet, gilt seit langem das Augenmerk der amerikanischen Germanistin Ruth Klüger. Ihre Beiträge zu diesem Thema, Rezensionen, Preisreden sowie ihre Bonner und Tübinger Poetikvorlesungen aus den Jahren 1995 und 2005 liegen jetzt unter dem Titel "Gelesene Wirklichkeit" gesammelt vor. Ruth Klüger, die 1931 in Wien geboren wurde und "noch einen letzten Zipfel eines untergegangenen, kurzlebigen Wiener Kulturjudentums" erwischen konnte, ist eine Essayistin im besten Sinne. Wie schon ihre früheren Bücher ("Katastrophen", 1993; "Frauen lesen anders", 1996) gezeigt haben, sind ihre literaturkritischen Arbeiten originelle Denkexperimente, keine Dekrete. Sie lassen den Leser auf eine sehr sympathische Weise am Prozess der Wahrheitsfindung teilhaben, mit ebenso unaufgeregten wie beharrlichen Reflexionen über die Zusammenhänge von Ethik und Ästhetik.
Das Interesse an "Fakten und Fiktionen in der Literatur" hat, wie Ruth Klüger bekennt, nicht zuletzt persönliche Gründe. Bis heute bezeichnen Leser, aber auch Kritiker, die ihre Autobiografie "weiter leben" loben wollen, diese gerne als "Roman". Ein, aus Ruth Klügers Sicht, fragwürdiges Etikett. "Fiktiv" wollen ihre Erinnerungen an ihr Überleben im Nazi-Terror ja gerade nicht sein, im Gegenteil: Ihr Anspruch ist der einer Zeugenaussage, eines subjektiven Beitrags zur Geschichtsschreibung. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine Autobiografie auch lügen kann. Siehe beispielsweise Benjamin Wilkomirskis "Bruchstücke". Für Ruth Klüger zeigt der Fall der zunächst gefeierten, dann als gefälscht enttarnten KZ-Erinnerungen Wilkomirskis noch etwas anderes: Wir beurteilen Bücher, die sich auf Wirklichkeit berufen, Autobiografien, aber auch "historische Romane" nicht allein nach ästhetischen Maßstäben.
Vielmehr kann sich die Wahrnehmung ästhetischer Qualitäten ändern, wenn der Leser erkennt, dass er getäuscht wurde, dass der Autor jenen Kontrakt, den er mit ihm eingegangen ist, gebrochen hat. Gerade von Holocaust-Literatur wird verlangt, dass sie sich an die Fakten hält. Jedoch: "Der Holocaust eignet sich hervorragend für Kitsch und Pornografie." Weshalb man solchen "Kitschmenschen" wie Benjamin Wilkomirski leicht auf den literarischen Leim geht.
Auch Steven Spielbergs Film über den guten Deutschen Oskar Schindler, den Ruth Klüger gegen Kritiker wie Claude Lanzmann in Schutz nimmt, erschiene wohl als unerträglich, wäre er reine Erfindung. Und dass es bei der Beurteilung eines Werkes einen erheblichen Unterschied macht, wer sein Autor ist, ein Deutscher oder ein Jude, das verdeutlicht Ruth Klüger am Beispiel von "Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch".
Dieser angeblich frühe Roman Wolfgang Koeppens, der 1992 vom Suhrkamp Verlag veröffentlicht wurde, entpuppte sich als plumpes Plagiat, wie erst die Publikation der originalen Aufzeichnungen des in die USA emigrierten polnischen Juden Jakob Littner erkennen ließ. Was sich aber unter dem Namen Wolfgang Koeppen als anmaßend las, erscheint unter Littners Namen als legitimes Zeugnis eines Überlebenden.
Man sieht: "Werkimmanente" Deutungen, wie sie sie in den Sechzigerjahren während ihres Studiums in den USA kennen lernte, sind Ruth Klüger so fremd wie postmoderne, dekonstruktivistische Perspektiven. Die Literatur, so Ruth Klüger unter Berufung auf eine Metapher Elfriede Jelineks, hat eine ethische Aufgabe: Sie hat die ungekämmte, struppige Wirklichkeit zu frisieren, in eine tröstliche Form zu bringen.
Der Autor ist für sie nach wie vor quicklebendig, und dass sich Wahrheit und Lüge, Facts und Fiction, manchmal zum Verwechseln ähnlich sehen, wie etwa im neuen Genre des Dokudramas, zeigt für sie nur eines: die Notwendigkeit der Kritik. "Ich habe ein gespanntes Verhältnis zu der Literatur, mit der ich mich abgebe", bekennt Klüger denn auch. "Ich trau den Dichtern, besonders den deutschen, nicht."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.05.2006, S. 38
Der zerbrochene
Kamm
Zurück zur Wirklichkeit: Ruth Klügers
Aufsätze zur Literatur
FRIEDMAR APEL
Ruth Klüger:
"Gelesene Wirklichkeit". Fakten und Fiktionen in der Literatur. Wallstein
Verlag, Göttingen 2006. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Die Abkehr vom Nachahmungsprinzip war im achtzehnten Jahrhundert
ein Akt der Selbstbehauptung der Kunst gegen die Zudringlichkeit einer
instrumentalisierten Vernunft, der nicht wenig zur beispiellosen Blüte der
deutschen Literatur beigetragen hat. Die Widersprüche des Autonomiepostulats
aber traten erst in der Moderne hervor. Das literarische Feld konstituierte sich
als symbolische Sphäre der Unabhängigkeit vom Gesellschaftlichen, zugleich wurde
die Wirklichkeit zur bloßen Außenseite einer Unendlichkeit des Möglichen
herabgewürdigt. Der ästhetische Absolutismus hoher Literatur verabschiedete sich
im Namen einer überlegenen Wahrheit von der Auseinandersetzung mit den real
handelnden und leidenden Menschen und ihrer Geschichte.
Nach den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dieser Abschied noch
einmal akademisch bekräftigt. Die Auschwitz-Überlebende Ruth Klüger, bei der
nach ihrer bewegenden Biographie beinahe in den Hintergrund gerückt scheint, daß
sie eine bedeutende Literaturwissenschaftlerin ist, hält das im Rückblick für
eine Fehlentwicklung: "Es ist bezeichnend, daß gerade eine Generation wie die
meine, die gebeutelt von Krieg und Holocaust zum Studium kam, belehrt wurde, daß
selbst beim Lesen von Kriegsromanen politische und historische Fragen nichts zu
suchen hätten. Und wir waren doch junge Menschen, die gern Erklärungen gehabt
hätten für den Erdrutsch, den wir gerade mit knapper Not überlebt hatten. Aber
das war in Amerika nicht zu haben, genausowenig wie in Deutschland. Alles war
festgelegt, die Fakten waren die Fakten, und die Dichtung war beschränkt aufs
rein Menschliche und etwas später, mit dem Dekonstruktivismus, aufs rein
Sprachliche."
Daher fragt sich Ruth Klüger in der vorliegenden Sammlung ihrer jüngsten
Aufsätze und Reden, ob die Literaturwissenschaft nicht die Flucht vor einer
geschichtlichen Wirklichkeit befördert hat, "die man am eigenen fast verbrannten
Fleisch erlebt hatte". Dabei scheint es ihr so absurd wie bezeichnend, daß der
belgische Literaturwissenschaftler, der seine antisemitischen Schriften
verschwieg, nämlich jener Paul de Man, der den Dekonstruktivismus erfolgreich
nach Amerika exportierte, "besonders viele jüdische Studenten zu seinen Jüngern
zählte". Es könne sein, daß sie sich derart der Erniedrigung durch den Holocaust
hätten entziehen wollen oder müssen.
Die anschwellende Diskussion über den Holocaust aber hat die Frage nach dem
Verhältnis von Literatur, Wirklichkeit und Geschichte gegenläufig zum Erfolg
dekonstruktivistischer Thesen wieder auf die Tagesordnung gesetzt. "Bei der
Holocaust-Literatur werden oft auch nur geringe Abweichungen von der
historischen Wirklichkeit vom Leser als Beleidigung empfunden. Der Einwand: so
war es nicht, so stimmt es nicht, der leicht naiv erscheint, wiegt hier schwerer
als bei anderen historischen Fiktionen." Gleichzeitig aber werde Fiktionen
Geltung eingeräumt, "die unserem Bedürfnis entgegenkommen, das Grauen auch
richtig auszuschöpfen und auszukosten". So sei in der Verwischung der Grenzen
zwischen Fiktion und Wirklichkeit "eine schizophrene Bewußtseinslage"
entstanden, die es erfordere, die abgetan scheinende Frage nach Wahrheit und
Lüge der Literatur neu zu stellen.
Ein so exemplarischer wie irritierender Fall ist für Ruth Klüger das Buch "Jakob
Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch", das 1948 unter dem Namen des
jüdischen Überlebenden erschienen war, 1992 aber noch einmal unter dem des
Romanciers Wolfgang Koeppen herausgegeben wurde.
"Der Unterschied ist ein Buch von einem Juden oder ein Buch über die Juden von
einem Nichtjuden. Das Buch ist voller Meinungsäußerungen, über Strafe und
Gerechtigkeit, auch über das Mitwirken der Judenräte an den Verbrechen, und
endet mit einem weinerlichen Versöhnungspathos. Wenn das nun die
Meinungsäußerungen des jüdischen Überlebenden sein sollen, in Wirklichkeit aber
die Parolen eines deutschen Nichtjuden sind, so handelt es sich schlicht um
Lüge, nicht um Fiktion." So ist der Text von 1948 verlogener als der von 1992,
obwohl sie identisch sind. Aber auch die Edition unter Koeppens Namen ist von
Lügen umgeben. In dem beigegebenen Vorwort leugnet Koeppen, Littner persönlich
gekannt zu haben und von einem damals vorliegenden Manuskript zu wissen. In
Wahrheit habe Koeppen fast alles nur leicht verändert abgeschrieben. Ruth Klüger
will Koeppen und dem Suhrkamp Verlag die Redlichkeit nicht völlig absprechen,
gleichwohl laufe die Edition faktisch auf "eine letzte Enteignung und
Erniedrigung" der Erinnerungen Littners, gleichsam auf eine "Arisierung"
jüdischen Erlebens hinaus.
Mit Erinnerungen wahrhaftig und ohne falsche Sentimentalität umzugehen ist um so
notwendiger, als die Holocaust-Darstellung zu einem florierenden Geschäftszweig
geworden ist. Erinnerung ist für Ruth Klüger "ein Graus, eine Zumutung, eine
einzige Kränkung der Eigenständigkeit", zugleich aber ist die "Erinnerung an das
Leiden auch eine Art Schatz, ein Besitz, und wer ihn uns entreißen will, macht
uns ärmer". Die Sammelwut der "Shoa-Beflissenen" der oral history ist der
Überlebenden freilich verdächtig. "Man wird nicht zum Zeugen, sondern zum
Rohmaterial." Aber der Holocaust eignet sich eben "hervorragend für Kitsch und
Pornographie", wie sich nicht nur an dem Film "Schindlers Liste" von Spielberg
zeigen läßt. In die leidenschaftliche Entrüstung Claude Lanzmanns aber will Ruth
Klüger nicht einstimmen. Die Unterscheidung zwischen Kitsch und Kunst sei zwar
bei diesem heiklen Thema durchaus dienlich, sie dürfe aber nicht auf die
Restitution eines Bilderverbots hinauslaufen.
Die Frage nach dem Zusammenhang von Literatur und Geschichte führt die Autorin
auch zurück zur Autonomieästhetik der deutschen Klassik, in der sie die Anfänge
der Flucht vor der Wirklichkeit kenntlich macht. Am Beispiel der "Jungfrau von
Orleans" wirft sie ausgerechnet dem Historiker Schiller Mißachtung der
Geschichte vor. "Schiller strebte eine höhere Wahrheit an und begrub dabei die
historische Aktualität so gründlich, daß sie nicht umhin konnte, aus ihrem
seichten Grab aufzustehen und uns Heutigen den Spaß an diesem Trauerspiel zu
verderben." Das Besondere und Einmalige des Lebens der Jeanne d'Arc sei hier dem
abstrakten Ideal des Kampfs um das Vaterland zum Opfer gefallen. Nicht zufällig
zitiert Ruth Klüger Büchners Überzeugung, daß der ästhetische Idealismus "die
schmählichste Verachtung der menschlichen Natur" sei. Jedoch hält sich die
Autorin von dogmatischer Verurteilung fern. In "Don Carlos" seien die
Geschichtsklitterungen zu ertragen oder sogar heute noch interessant: Es sei
"die Dialektik von Fortschritt und Reaktion, die dieses Drama so unverwüstlich
macht".
Kleists Geschichtsbewußtsein steht ihr freilich näher, er bringe Geschichte in
Bewegung, gerade wenn er anachronistisch verfahre, wie in dem Gespräch des
Michael Kohlhaas mit Luther. Ideen, die in der Geschichte eine bewegende Rolle
gespielt haben, soll die Literatur darstellen, nicht deren Kostüm. Wenn die
Fiktion sich der Geschichte bedient, muß sie einen Weg finden, mit den Fakten
umzugehen, denn diese hemmen die Phantasie keineswegs.
Das schließt aber die Möglichkeit ein, "sich die Geschichte anders vorzustellen,
als es die Fakten erlauben, also eine alternative Geschichte zu erfinden, von
der die Leser wohl wissen, daß sie nicht stattgefunden hat". Bei der Gelegenheit
verrät Ruth Klüger, daß ihr zwei Novellenprojekte durch den Kopf gehen, deren
Ausführung sie dem Leser leider vorenthalten will. Die eine Erzählung würde
"Lessing verkauft seine Bücher" heißen und sich eher faktengetreu mit der
Kehrseite der Aufklärung befassen. Der Held würde darin als ein periodisch
verzweifelnder Glücksspieler auftreten.
Die andere Novelle würde ein Beispiel für alternative
Geschichtsbildung abgeben. Sie würde erzählen, was passiert wäre, wenn Lili
Schönemann Goethe fester gebunden hätte, so daß er nicht zur kleinstaatlichen
Aristokratie hätte davonlaufen können.
Goethe wäre dann zunächst nach Italien gereist, und hernach hätte er Frau
Schönemann geheiratet und in Frankfurt mit Romanen und Erzählungen statt mit
Dramen in Blankversen oder Epen in Hexametern die deutsche bürgerliche Literatur
begründet.
Ein bißchen Lyrik wäre
neben dem Engagement in städtischen Angelegenheiten auch noch angefallen. Wie
man solche Geschichten schreibt, habe Thomas Mann gezeigt. Bei ihm sei "das
Individuelle und das Geschichtliche, das Erfundene und das Überlieferte auf
nahezu perfekte Weise verknüpft".
Es gibt aber noch ein dritte Möglichkeit, "nämlich aus der Geschichte
auszuscheren und ein Gegenmodell zu errichten". Das geschieht in der Utopie als
Geschichte, wie sie nie stattgefunden hat, und in der Dystopie, wie sie
keinesfalls stattfinden sollte. Zu diesen Gattungen hätte die deutsche Literatur
wenig Bemerkenswertes beigetragen, gäbe es nicht Theodor Herzl, in dessen Werk
Utopie und geschichtlicher Entwurf eine Einheit bilden wie nirgendwo anders.
Freilich wollte sich Herzl selbst nicht als Erfinder "einer lieblichen Utopie"
verstanden wissen.
Er wollte eine Generation erreichen, die ins wirkliche Geschehen eingreifen
kann, und das in der Schaffung des Judenstaats schließlich tat, wenngleich nicht
genau so, wie Herzl es sich dachte. Dem Geschichtlichen entkommt auch die Utopie
nicht. Je stärker sie sich entfernt, desto deutlicher macht sie den Leser auf
die dunklen Seiten der realen Geschichte und die Unsinnigkeiten des zerzausten
Wirklichen aufmerksam, das nach einer "erheiternden Metapher" Elfriede Jelineks,
der "zerbrochene Kamm der Dichtung" nicht frisieren kann.
So greifen die Deutungen Ruth Klügers hinter die idealistische und
ästhetizistische Autonomieästhetik zurück auf den Literaturbegriff Lessings, mag
der in der hoffentlich doch noch entstehenden Novelle auch von Zweifeln am Sinn
der Aufklärung befallen sein. Der Leser wird an der klaren Sprache Ruth Klügers,
ihrer undogmatischen Argumentation und ihren souveränen Urteilen seine Freude
haben. Für Literaturwissenschaftler und Kritiker hält das Buch freilich
Zurechtweisungen bereit, die manch einer mit säuerlicher Miene zur Kenntnis
nehmen wird.

Artikel erschienen am 18.11.2006
Sachbuch
Die Autorin Ruth Klüger legt Essays vor - über die Holocaust-Serie im Fernsehen, über die Schriftsteller Wolfgang Koeppen, Adalbert Stifter und ihren Geburtsort Wien.
Ruth Klüger: Gelesene Wirklichkeit. Wallstein, Göttingen. 224 S., 22 Euro.
Die Poesie hat ihr nie den Blick auf Menschen und Dinge verstellt. Mag sein, dass das Überleben in Auschwitz Ruth Klüger vor literaturwissenschaftlichen Illusionen bewahren sollte. Durch schöne Worte lässt sie sich nicht blenden. Stets schaut sie nach, was dahinter steckt. Naturgemäß nicht naiv, sondern mit dem Instrumentarium einer Gelehrsamkeit, die keinen akademischen Jargon benötigt.
Darum ist sie eine Essayistin von Rang - ohne Scheuklappen, präzise im Urteil und höchst differenziert. Ihr Band "Gelesene Wirklichkeit" legt von all dem schönstes Zeugnis ab. Ruth Klüger kann es sich erlauben, die amerikanische Holocaust-TV-Produktion energisch abzulehnen. Der Zweck heiligt für sie die Mittel eben nicht: "Wenn ich um der Wahrheit willen lüge, so wird deshalb aus der Lüge keine Wahrheit." Der einzige Kompromiss, zu dem sie bereit ist, besteht in einer Doppelsicht: "Die Holocaust-Serie ist einerseits Kitsch, also verlogene Kunst, doch im Dienste einer guten Sache." Darin wird ihr jeder Wohlmeinende zustimmen.
Beharrlich und genau untersucht sie Koeppens Roman "Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch", die poetisierende Bearbeitung eines Erlebnisberichts, und kommt im Vergleich mit Littners Originaltext zu wenig schmeichelhaftem Befund für den Dichter: "Hier hat einer aus der Tätergesellschaft, mochte er auch noch so einfühlsam sein und noch so gut schreiben können, dem Opfer das Letzte genommen, was ihm geblieben war, nämlich das gelebte Leben und das Recht, seine Erinnerungen in seinen eigenen Worten zu gestalten, so dass eine letzte Enteignung und Erniedrigung über das Grab hinaus stattfand." Ruth Klüger bevorzugt Klartext, der - wenn es sein muss - von Empörung beflügelt sein kann.
Ein anderes Thema ist Wien, ihr Geburtsort, der ihre intellektuell-emotionale Biografie im Positiven wie im Negativen bestimmt hat. Sie zitiert Ilse Aichinger: "Wien ist die Stadt, aus der mir die Flucht nicht gelang." Ihre Wiener Herkunftsgeschichte begreift Klüger als Gespenstergeschichte, geprägt von Antisemitismus und Literatur. Und wie es Ruth Klügers Art ist, braucht sie nur Austrias Parnass kurz zu inspizieren, um uns ganz nebenbei verblüffende Einsichten zu vermitteln. Sie sind so selbstverständlich, dass niemand davor sich der Mühe unterzog, sie zu bemerken und schriftlich festzuhalten: "Stifter ist meines Wissens der einzige der großen Österreicher, der ungern und selten vom Tod schreibt." Die implizite Pointe wird von Adalbert Stifters Selbstmörderschicksal gratis mitgeliefert.
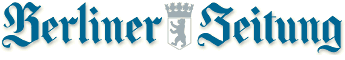
18.09.2006
Feuilleton - Seite 31
Ruth Klüger: Gelesene Wirklichkeit. Fakten und Fiktionen in der Literatur. Wallstein, Göttingen 2006. 222 S., 22 Euro.
Eine Zeitung kann lügen, ein Geschichtsbuch, eine Statistik. Kann auch Literatur lügen? Literatur, die mit historischen Stoffen arbeitet, vermengt Fakten und Fiktionen - aber erfinden ist nicht dasselbe wie lügen. Andererseits: Wenn Literatur den Anspruch erhebt, eine "Wahrheit" auszudrücken, kann sie dann nicht auch der Lüge überführt werden? Diese Fragen stellt Ruth Klüger in ihrem klugen Essayband "Gelesene Wirklichkeit"; der Prüfstein, an dem sie sie entscheidet, ist die Schoah, die Antwort ist deutlich. Literatur über den Judenmord ist Wirklichkeitsbewältigung, sie ist für Klüger im weitesten Sinne Nachahmung und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zu lügen: etwa wenn sie die Wahrheit durch Kitsch entstellen, wie im Aufsatz über "KZ-Kitsch" dargestellt. Oder wenn ein Autor die Erfahrungen, die moralische Autorität, ja den Text eines Anderen usurpiert - wie in Wolfgang Koeppens Roman "Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch". Klüger ist Literaturwissenschaftlerin, Holocaust-Überlebende, Verfasserin einer Autobiografie; ihr Schicksal hat sie empfindlich gemacht für jeden falschen Ton. Sie schreibt gelehrt und einfach zugleich - und erwähnt zwei eigene Novellenprojekte, die die historische Fakten und Fiktion verbinden: über Lessing, der als glückloser Spieler seine Bibliothek verkaufen und so die traurige Kehrseite der optimistischen Aufklärer zeigen würde. Und über einen Goethe, der nicht am Fürstenhof in Weimar Hexameter schriebe, sondern mit Lili Schönemann in Frankfurt bliebe und mit Romanen eine andere, eine engagierte deutsche Literatur begründet hätte. Schade, dass diese Novellen gleich doppelt Fiktion bleiben, weil Ruth Klüger, wie sie selbst sagt, sie nie schreiben wird.

Artikel erschienen am 04.11.2006
Auszeichnung
Bei ihr lernt man Verstand, Witz, Trotz und Mut: Elke Heidenreich gratuliert Ruth Klüger zum Roswitha-Preis: Der Schrifstellerin wurden schon früh die Wurzeln genommen - als Zwölfjährige war sie in drei verschiedene KZs deportiert worden. Doch trotz allem behielt sie ihren Lebensmut - und entwickelte sich zur Lehrerin für ein selbständiges Denken.
Einmal an einem trüben Samstagmorgen lag ich im Bett und hörte im Deutschlandradio Kultur ein Gespräch mit Ruth Klüger. Ich hatte zu der Zeit bereits ihr Buch "weiter leben" gelesen und hörte also sehr interessiert zu. Sie sprach über ihr Leben, sie redete ohne Sentimentalität über die Zeit, die sie als Zwölfjährige in gleich drei verschiedenen KZs verbracht hatte, und am Ende des Gesprächs stellte der Moderator die Frage:
"Was bedeutet GLÜCK für Sie?"
Ich hielt den Atem an, um die Antwort dieser Frau mit der brüchigen, immer noch leicht wienerisch gefärbten Stimme auf diese Frage nicht zu verpassen.
Es entstand eine längere Pause, eine Pause, wie sie normalerweise im Radio nicht geduldet und, wenn es keine Live-Sendung ist, sofort herausgeschnitten wird.
In meinem Kopf sprangen die Antworten hin und her, die ich selbst gegeben hätte. Was ist Glück? Was würde jemand mit einer Biographie wie Ruth Klüger antworten?
Nach einer endlos scheinenden Weile sagte sie etwas ganz Erstaunliches, Unerwartetes und Einfaches: "Glück", sagte sie, "das ist Sonne auf der Hoteltapete."
Ruth Klüger hat nicht das, was wir Wurzeln oder Heimat nennen. Sie wurde, 1931 geboren, als jüdisches Kind in Österreich isoliert, aus der Schule geworfen, verlor früh den Familienzusammenhalt, hatte keine Freundinnen und Freunde, das einsame jüdische Kind saß im Dunkeln und las.
"Wien", schreibt sie, "ist Weltstadt, von Wien hat jeder sein Bild. Mir ist die Stadt weder fremd noch vertraut, was wiederum umgekehrt bedeutet, dass sie mir beides ist, also heimatlich unheimlich. Freudlos war sie halt und kinderfeindlich. - Bis ins Mark hinein judenkinderfeindlich."
Dann kam die Deportation, zusammen mit der Mutter, wir alle haben das Buch gelesen oder sollten es lesen. Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Christianstadt, das Außenlager von Groß-Rosen. Von 1942, sie war gerade zwölf Jahre alt, bis 1945, sie war noch 14, als das Lager evakuiert wurde. Wichtige Jahre der Kindheit in den KZs der Nazis.
Fast alle Schriftsteller nehmen vor allem ihre Kindheit als Steinbruch für ihre Geschichten und Romane. Wie sehr arbeiten wir uns ab am Verhältnis zu den Eltern, am Erwachsenwerden, an der Rückschau auf diese Jahre im Wiederaufbau oder in den 60ern, je nach Alter. Ruth Klüger erzählt nicht wie eine Schriftstellerin, obwohl sie eine schriftstellerische Sprache hat, sie lässt Fiktion nicht zu, sie erzählt als Chronistin des eigenen Lebens und einer grausamen, unbegreiflichen Zeit. Sie beschreibt das unwürdige Leben im Lager, sie beschreibt auch Freundschaften, die entstanden, sie sagt sogar den eigentlich unfassbaren Satz: "Ich hab Theresienstadt irgendwie geliebt, und die neunzehn oder zwanzig Monate, die ich dort verbrachte, haben ein soziales Wesen aus mir gemacht, die ich vorher in mich versponnen, abgeschottet, verklemmt und vielleicht auch unansprechbar geworden war. In Wien hatte ich Ticks, Symptome von Zwangsneurosen, die überwand ich in Theresienstadt, durch Kontakte, Freundschaften, Gespräche."
Natürlich beginnt das nächste Kapitel mit "Ich habe Theresienstadt gehasst" und schildert Schikanen und Verarmung des Lebens, unerträgliche hygienische Zustände und, wie sie sagt: "die nicht enden wollende Vorläufigkeit", die nur schwer zu ertragen war. Wie würde es weitergehen, würde es überhaupt weitergehen mit dem bisschen Leben?
Trost gaben Gedichte, die sie selbst schrieb, aber vor allem Gedichte, die sie als Kind gelernt hatte und sich nun aufsagte - die gebundene Form, die Sprache als Kraft und Stütze, Schillers Balladen waren es allen voran. Hier muss ihre frühe Beschäftigung mit Dichtung, mit Sprache begonnen haben, die sie leidenschaftlich ihr ganzes Leben lang nun schon betreibt. Sie schreibt in "weiter leben": "Die Schillerschen Balladen wurden dann auch meine Appellgedichte, mit denen konnte ich stundenlang in der Sonne stehen und nicht umfallen, weil es immer eine nächste Zeile zum Aufsagen gab, und wenn einem eine Zeile nicht einfiel, so konnte man darüber nachgrübeln, bevor man an die eigene Schwäche dachte. Dann war der Appell womöglich vorbei, und die Grammophonplatte im Kopf konnte abgestellt werden (...) Man konnte sich trollen und Wasser trinken gehen. Bis zum nächsten Appell."
Natürlich setzt sich ein so durch Gedichte geprägtes Kind als erwachsene Germanistin mit Adorno auseinander, der gefordert hatte, man möge von und nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben. Dazu Ruth Klüger: "Die Forderung muss von solchen stammen, die die gebundene Sprache entbehren können, weil sie diese nie gebraucht, verwendet haben, um sich seelisch über Wasser zu halten. Statt zu dichten möge man sich nur informieren, heißt es, also Dokumente lesen und ansehen - und das gefassten, wenn auch betroffenen Mutes. Und was sollen sich Leser oder Betrachter solcher Dokumente dabei denken? Gedichte sind eine bestimmte Art von Kritik am Leben und könnten ihnen beim Verstehen helfen. Warum sollen sie das nicht dürfen? Und was ist das überhaupt für ein Dürfen und Sollen? Ein moralisches, ein religiöses? Welchen Interessen dient es? Wer mischt sich hier ein? Das Thema brennender Dornbusch auf heiligem Boden, nur mit nackten Füßen und unterwürfiger Demut zu betreten."
Für mich waren diese Worte wie eine Zündladung. Ich war es heimlich seit meinem 68er Germanistikstudium leid, derart gegängelt zu werden, und Ruth Klüger lehrte mich wieder den Mut, selbstständig zu denken, zu entscheiden, die Demut über Bord zu werfen und meine Forderungen zu stellen. Auch in meiner von Krankheiten und Einsamkeit geprägten Kindheit waren es Gedichte, die mich retteten, die mir durchzuhalten halfen. Ruth Klüger zeigte mir, dass ich darauf stolz sein und darüber reden und diese Erfahrung weitergeben darf.
Die polnische
Lyrikerin Wislawa Szymborska bekam für ihre zarten, klugen, großartigen Gedichte
1996 den Literaturnobelpreis. Eines dieser Gedichte beschäftigt sich genau
damit: mit Poesie, und wer sie braucht und wer nicht. Erlauben Sie mir, ihr
Gedicht "Manche mögen Poesie" in der Übersetzung von Karl Dedecius hier zu
zitieren:
"Manche - das heißt nicht alle. Nicht einmal die Mehrheit, sondern die
Minderheit. Abgesehen von Schulen, wo man mögen muss, und von den Dichtern
selbst, gibt's davon etwa zwei pro Tausend. Mögen - aber man mag ja auch
Nudelsuppe, mag Komplimente und die Farbe Blau, mag den alten Schal, mag auf dem
Seinen beharren, mag Hunde streicheln. Poesie - was aber ist das, die Poesie.
Manch wacklige Antwort fiel bereits auf diese Frage. Aber ich weiß nicht und
weiß nicht und halte mich daran fest wie an einem rettenden Geländer." Die
Poesie als rettendes Geländer - Hilde Domin, Wislawa Szymborska, Mascha Kaléko,
Christine Lavant, Anna Achmatowa, Ruth Klüger haben mich das gelehrt, mir dieses
rettende Geländer zugestanden.
Als ich sie vor Jahren kennenlernen durfte, redeten wir, soviel ich mich erinnere, zuerst über Gedichte und dann gleich über unsere Mütter, denn "weiter leben" ist auch das Buch einer äußerst komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung, und auch ich hatte so eine äußerst komplizierte Beziehung zu meiner Mutter, wenn auch natürlich und zum Glück nicht unter diesen extremen Bedingungen der Jahre im Lager.
Wir sprachen über diese starken alten Frauen, für die man immer Kind ist, die nie aufhören, an uns herumzuerziehen, neben denen wir immer nur kläglich, nie souverän sein können. Sie hat ihr Buch erst ins Englische übersetzen lassen nach dem Tod der Mutter, die in den USA lebte, - die Tochter musste über 60 Jahre alt werden dazu. Ich habe erst zu schreiben begonnen, als meine Mutter nicht mehr so richtig verstand, was ich da schrieb - nämlich bittere Abrechnungen. Ich musste über 50 werden.
Als Ruth Klüger ihr Erinnerungsbuch für uns alle schrieb, war sie längst eine bekannte Literaturwissenschaftlerin. Dem Buch merkt man das natürlich an. Das Kapitel der Flucht aus dem letzten Lager 1945 endet mit den Worten: "So kam ich unter die Deutschen."
Wir wissen: das ist Hölderlin, so leitet er im "Hyperion" seine bitterböse Abrechnung mit den Deutschen ein. "An wen sonst als euch", schreibt sie am Schluss des Buches, das sie ihren Göttinger Freunden widmet. Auch das ist Hölderlin: "Wem sonst als dir" schreibt er in den ersten Band des "Hyperion", als er ihn seiner Diotima, Suzette Gontard, schickt. Ruth Klüger zeigt, dass die deutsche Literatur ihr mehr Halt und Nähe bietet als die deutsche Mentalität, die deutsche Geschichte, die Deutschen. Die ersten Worte des Buches lauten: "Der Tod", die letzten: "Ein deutsches Buch", und ich denke gewiss nicht zufällig an Paul Celans "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland".
Ruth Klüger lehrte mich soviel. Den unsentimentalen, aber geraden Blick auf Deutschlands finsterste Zeit, zum Beispiel. Sie lehrte mich auch, dass man unversöhnlich sein darf, ja muss.
Auf die Frage: "Was habt ihr Kinder in Auschwitz gemacht?" antwortete Ruth Klüger in einem Gespräch knapp: "Appell gestanden sind wir. In Birkenau bin ich Appell gestanden und hab Durst und Todesangst gehabt. - Das war alles, das war es schon."
Das war es schon.
Elie Wiesel, der als 16-jähriger in Auschwitz war, dessen ganze Familie man mordete und der überlebte, schrieb: "Das Kind, das ich war, ist von den Flammen verzehrt worden. Übrig blieb nur eine Gestalt, die mir gleich sah."
Ruth Klügers großes Erinnerungsbuch, frei von Pathos, Holocaust-Kitsch und allem Erhabenen, ist eine Geschichte der tiefen Beschädigungen. Dass aus einem Kind, das solche Beschädigungen er- und überlebt, eine so kluge Lehrerin der Literatur werden konnte, ist ein Wunder und ein Geschenk, für das wir nur dankbar sein können. Sie hat sogar in Deutschland studiert, zunächst, später in den USA, wo sie auch lange an Universitäten lehrte. Wie gern hätte ich bei ihr studiert.
Aber mir, uns bleibt, ihre Essays zu lesen, ihre Bücher zur Literatur. "Katastrophen" - Klügers Studien zu jüdischen Gestalten in der deutschen Literatur, "Gelesene Wirklichkeit", Essays über die Frage, was mit der Literatur geschieht, wenn sie sich der Wirklichkeit stellt, was also passiert, wenn sich Lebens- und Leseerfahrung überschneiden. Ruth Klüger ist Kleist- und Lessingspezialistin, das bedeutet ja etwas: gerade diese beiden sind die notorisch Aufsässigen, die Fragenden, die Nichtangepassten. Kleist, schreibt sie, hat wie kaum einer geahnt, was da kommt - " die Zeit der Diktatoren und der Massen". Er ist daran zerbrochen.
Alles passt zusammen: Christa Wolf ist für Ruth Klüger wie auch für mich, für viele von uns, eine wichtige Autorin, und ich erinnere hier an ihr für mich bewegendstes Buch "Kein Ort. Nirgends" Es schildert die fiktive Begegnung zweier Künstler Anfang des 19. Jahrhunderts auf einem Spaziergang am Rhein, zweier Künstler, denen auf dieser Welt nicht zu helfen war - sie, Karoline von Günderode, die Dichterin, stieß sich 26jährig einen Dolch ins Herz, er, der Dramatiker Heinrich von Kleist, erschoss sich 34jährig. Warum? Weil die Erde "Kein Ort. Nirgends" ist und weil es die Berührung, nach der uns so unendlich verlangt, nicht gibt, und weil wir an unseren Sehnsüchten zerbrechen, wenn wir nicht stark sind.
Ruth Klüger hat über Barock- und Gegenwartsdichtung gleichermaßen fesselnd geschrieben. Und immer wieder beschäftigt sie sich mit der Literatur von und über Frauen, besonders zu erwähnen ist hier ihre feministische Sicht auf die Literatur in "Frauen lesen anders". Das Buch ist für mich zur unverzichtbaren Arbeitsgrundlage, zum ewigen Nachschlagewerk geworden. Hier geht es unter anderem um die These, dass wir Frauen durchaus Hemingway, Faulkner, Updike, Kafka, dass wir Frauen also die Literatur der MÄNNER lesen, dass aber Männer keineswegs Sylvia Plath, Virginia Woolf, Carson McCullers oder Jane Bowles, also Literatur von Frauen lesen. Es interessiert sie nicht, nicht wirklich, was Frauen schreiben und denken.
Ich habe mit dem feministischen Ansatz oft meine liebe Not, aber niemals im Werk von Ruth Klüger, die es immer schafft, ohne Polemik und mit dem klaren Blick des gesunden Frauenverstandes, auch mit gelassener Ironie die Dinge zu betrachten und zu zerlegen. In ihrem Aufsatz "Frauen lesen anders" versucht sie noch, tapfer zu verteidigen, dass doch die Literatur vom allgemein Menschlichen handelt, an dem beide Geschlechter gleichermaßen teilhaben. Aber sie ist dann doch zu klug, um sich dieser Illusion vollends hinzugeben und schreibt dies hier:
"Als ich Schillers ,An die Freude' als Zehnjährige las, fühlte ich mich ausgeschlossen gerade von den Versen, bei denen sich alle miteingeschlossen fühlen sollen. Da hieß es zunächst: ,Alle Menschen werden Brüder.' Eigentlich, so dachte ich, sollte es ,Geschwister' heißen, wenn auch Frauen gemeint sind. Doch entschuldigte ich den Dichter: auf ,Geschwister' findet sich nicht so leicht ein Reimwort, ,Geschwister' ist unpoetisch, also gut, ,Brüder'. Doch dann las ich: ,Wem der große Wurf gelungen / Eines Freundes Freund zu sein, / Wer ein holdes Weib errungen, / Mische seinen Jubel ein.' Ich dachte, zur Not könnte es mir ja in ferner Zukunft gelingen, ein holdes Weib zu werden, wiewohl mir diese Aussicht als nicht eindeutig erstrebenswert erschien. Da ich naturgemäß nie in der Lage sein würde, ein solches, nämlich ein holdes Weib, zu erringen, würde ich bestenfalls einen Mann zum Jubeln veranlassen, doch selber mitzujubeln schien mir der Dichter zu versagen, und das in seiner menschheitsumfassenden Versöhnungshymne. Ein Mensch konnte ich offensichtlich nicht sein, nur eines Menschen Weib. Später lernte ich, eine solche Reaktion auf ein großes Gedicht sei kindisch. Ich musste alt werden, um ihre spontane Richtigkeit zu erkennen."
Da haben wir alles, was die Literaturwissenschaftlerin und auch den Menschen Ruth Klüger ausmacht: den scharfen Verstand, den Witz, den Trotz und das Selbstbewusstsein. Schiller wird dann im weiteren Verlauf des Aufsatzes auch durchaus wegen seiner großartigen Frauengestalten in den Dramen rehabilitiert, aber, und das kann man bei Ruth Klüger immer wieder lernen: mit allem haben wir uns nicht abzufinden, nur weil ein großer Name darüber steht.
Dass Ruth Klüger seit langem regelmäßig in der "Literarischen Welt" Literatur von Frauen bespricht und vorstellt, erscheint nur konsequent. Und dass sie gerade diesen Preis, die Roswitha Gedenkmedaille, bekommt, auch. Diesen Preis bekommen nur Frauen, die sich, wie eben jene Roswitha, um die Literatur verdient gemacht haben. Wobei ich, um uns alle zu erheitern, erinnern möchte an Elfriede Jelinek, die diese Auszeichnung 1978 entgegennahm und ihrer Dankesrede sagte: "Es gibt keinen Preis nur für schreibende Männer, und auch der erste Mann, der je geschrieben hat, wird nicht sonderlich gefeiert. Daraus kann man schließen, dass das Schreiben für Männer eine quasi natürliche Tätigkeit ist, etwa wie die Seidenraupe Seide spinnt."
Auch hier haben wir es mit einer gewitzten Feministin als Preisträgerin zu tun.
In einem anderen Aufsatz über Schreibende Frauen geht Ruth Klüger schon vor 16 Jahren auf Roswitha von Gandersheim ein, auf ihre Leistung als Schriftstellerin zu einer Zeit, als nur Frauen in Klöstern diese Möglichkeiten der Bildung und der Veröffentlichung hatten. Roswitha, die im zehnten Jahrhundert lebte, ging als erste deutsche Dichterin in die Literaturgeschichte ein. Sie schrieb Dramen, Legenden, Gedichte, Historisches in einer Zeit, die von blutigen Kriegen und Machtkämpfen geprägt war. Welches Jahrhundert war das nicht, nehmen wir alles zusammen - auch das zwanzigste, in dem Ruth Klüger zu schreiben begann, hat uns reichlich Grausamkeiten beschert, und die grausamsten davon hat sie am eigenen Leibe und in der Seele erfahren. Und so ist sie eben nicht nur Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin, sie ist auch Zeugin und Überlebende der Barbarei. Sie erzählt davon, und das macht uns zu Zeugen, und unsere Zeugenschaft ist eine Verpflichtung. Sie ist ohnehin eine der jüngsten noch Überlebenden, und auch sie wurde in der vergangenen Woche schon 75 Jahre alt, wozu wir ihr nachträglich von Herzen gratulieren. Aber das Wort von Hans Sahl wird immer drängender:
"Wir sind die Letzten
fragt uns aus.
Wir sind zuständig."
Wir fragen, wir hören zu. Wir verneigen uns, voller Respekt, Dankbarkeit, Verehrung, Liebe vor Ruth Klüger.
Wir wachen morgens auf: Kein Ort. Nirgends. Wir wissen weder, wo wir gerade sind noch, warum wir immer noch weiter leben, aber da ist es, das Glück, das uns mahnt: Sonne auf der Hoteltapete.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.11.2007
Das bemalte Fenster als Tor zur Welt
Darf man Goethe
eigentlich verbessern? Und ob: Ruth Klüger betrachtet Lyrik als Lebensfuge und
präsentiert jetzt ihre gesammelten Erleuchtungen.
WULF SEGEBRECHT
Ruth Klüger:
"Gemalte Fensterscheiben". Über Lyrik. Wallstein Verlag, Göttingen 2007.
252 Seiten, geb., 22,- [Euro].
Es beginnt mit einem philologischen Paukenschlag: Ruth Klüger
korrigiert Goethe: "Eigentlich sollte es ,bemalte', nicht ,gemalte'
Fensterscheiben heißen", sagt sie forsch, um allerdings sogleich kleinlaut
hinzuzufügen: "Aber wer wagt es schon, gegen Goethes gönnerhaft-väterliche
Altherrenstimme pedantisch aufzubegehren?" Hier irrt, pardon, nicht Goethe,
sondern Ruth Klüger. Der Terminus "gemalte Fensterscheiben", den Goethe auch
regelmäßig in seinen Beiträgen zur Optik im Kampf gegen Newton benutzt, war im
achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert noch durchaus gleichbedeutend mit
"bemalten Fensterscheiben". Anderenfalls hätte er schon seine Straßburger Verse
"Kleine Blumen, kleine Blätter" der geliebten Friederike Brion nicht "mit einem
gemalten Band", sondern mit einem bemalten Band überreicht. "Gemalte Bänder
waren damals eben erst Mode geworden", schreibt Goethe in "Erinnerung an diese
Zeit".
Sei's drum. Als Titel einer Sammlung von Interpretationen deutscher Gedichte,
die Ruth Klüger hier vorlegt, eignen sich die Anfangsworte des Goethe-Gedichtes
- "Gedichte sind gemalte Fensterscheiben" - gleichwohl vorzüglich. Denn Goethes
plädiert hier dafür, sich in das Kircheninnere hineinzubegeben, wo man die
Transparenz und die Transzendenz der bedeutenden, bunten, vom Sonnenlicht
erleuchteten Kirchenfenster sinnlich wahrnehmen kann - eine einleuchtende
Empfehlung auch für Leser, die ins Innere von Gedichten einzutreten wünschen.
Dabei will ihnen Ruth Klüger mit den exemplarischen Interpretationen ihres
Buches behilflich sein.
Seit 1994 trägt die Germanistikprofessorin und Schriftstellerin Ruth Klüger
regelmäßig ihre Gedanken zu deutschen Gedichten in der von Marcel Reich-Ranicki
begründeten "Frankfurter Anthologie" vor. Nicht weniger als 29 ihrer nun
gesammelten Beiträge konnten treue Leser bereits in dieser Zeitung oder in den
Bänden der "Frankfurter Anthologie" lesen. Die Interpretationen gelten lyrischen
Texten vom Zweiten Merseburger Zauberspruch ("ben zi bena, bluot zi bluoda") bis
zu Sarah Kirsch, Robert Gernhardt und Robert Schindel. "Übrigens", schreibt Ruth
Klüger, "passt mir das Wort Interpretation für die ,Frankfurter Anthologie'
nicht recht. Denn es hat ja etwas Hochnäsiges im Sinn von: ,Ich verstehe es, und
du verstehst es nicht, also werde ich es dir erklären'" - und wer will schon als
hochnäsig gelten! Ruth Klüger jedenfalls nicht.
Sie müsste sich ja eigentlich nicht dafür entschuldigen, dass sie tatsächlich
von der Sache, über die sie spricht, allerlei versteht; und sie tut das auch
nicht. Im Bemühen, die von ihr gewählten Gedichte "in unserer Zeit
unterzubringen, in der der Kritiker und in der der Leser", sind ihr gewiss nicht
alle, aber doch viele Mittel recht: Sie lässt philologische Umsicht walten und
aktualisiert rigoros; sie bekennt persönliche Betroffenheit und vermittelt
sachliche Informationen, sie unterhält mit zugespitzten Formulierungen; und sie
kultiviert den Gestus des didaktischen Umgangs mit den Gedichten einerseits und
mit den erhofften Lesern, um die sie wirbt, andererseits. Es ist geradezu eine
Kumpanei mit diesen beiden Instanzen, die sie betreibt, und nichts ist dafür
charakteristischer als die geradezu inflationär wiederkehrende Formel "Unser
Gedicht". "Unser Gedicht" - das will heißen: Dieses Gedicht, mit dem wir - du,
"lieber betroffener Leser", und ich, die Interpretin - gerade befasst sind,
gehört schon allein deshalb uns beiden, weil wir uns gemeinsam darum bemühen;
wir machen es uns buchstäblich zu eigen.
In solcher Redeweise kommt ein wohltuend unfeierlicher, unprofessoraler und
gelegentlich aufregend respektloser Umgang mit den Gedichten und ihren Autoren
zum Ausdruck. Mit scheinbar gleichmütiger Arglosigkeit werden da die größten
Eigensinnigkeiten vorgebracht: "das Zeug zu sensationellen Zeitungsberichten und
zu griechischen Tragödien (ist) dasselbe", heißt es da beispielsweise zu Brechts
Ballade vom Elternmörder Apfelböck; und anlässlich von Erich Kästners
"Patriotischem Bettgespräch" wird gespielt beiläufig behauptet: "Übrigens ist
auch Goethes ,Selige Sehnsucht' ein solches Schlafzimmergedicht" über eine
Begattung, die "in Goethes Kammer stattfindet". Schließlich erlaubt sich Ruth
Klüger bei Gelegenheit von Celans "Todesfuge" sogar die Frage, "ob man Spaß
haben darf am Massenmord". Offensichtlich will sie Aufsehen erregen für das
jeweils zur Diskussion stehende Gedicht, dessen Einzigartigkeit sie gern mit
Hilfe von Superlativen hervorhebt: "Über kein Gedicht ist mehr geschrieben
worden als über Goethes Urworte." "Schiller ist der meistparodierte deutsche
Lyriker." Der Droste gelang "das erste und vielleicht das beste feministische
Gedicht in deutscher Sprache". "Kein deutscher Dichter ist so lange, so langsam
und so hellwach gestorben wie Heine"...
An die Einzelinterpretationen aus der "Frankfurter Anthologie" schließen sich
einige Aufsätze und Reden an, darunter gewinnende, aber nicht unkritische
Porträts deutscher Dichterinnen, die als Jüdinnen verfolgt wurden: Else
Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Rose Ausländer, Mascha Kaléko und
Hilde Domin. Das Schicksal dieser Verfolgten nimmt für sie ein, es trübt aber
nicht Ruth Klügers Blick für poetische und menschliche Schwächen; so kann sie es
als bekennende Feministin der Dichterin Else Lasker-Schüler nicht verzeihen,
dass sie Gottfried Benn, diesen "verirrten Spießbürger auf dem Weg in die
Nazipartei", einst (1912) geliebt hat.
Wo immer man dieses Buch aufschlägt, ist es, wie man sieht, erfrischend
aufmüpfig Autoritäten gegenüber. Unverhohlen spricht Ruth Klüger beispielsweise
von Rilkes Kitsch und Schillers Pathos. Dieser allerdings erhält trotzdem
Dispens in dem Beitrag "Mein Schiller". Vieles in seinen Balladen findet die
Verfasserin "anfechtbar", moralisch fragwürdig und ästhetisch unerträglich; und
doch hängt sie an ihnen. Denn "durch sie", schreibt sie, "bin ich zu einer
leidenschaftlichen, lebenslangen Leserin von Lyrik geworden". Allein die
Rekapitulation dieser auswendig gelernten Balladen habe ihr dabei geholfen, die
schlimme Auschwitz-Zeit, der sie als Kind ausgesetzt wurde, wenigstens zeitweise
zu "vertreiben" und so zu überleben. Das ist für sie das Beispiel einer wahren
Brauchbarkeit der Lyrik, und das ist auch der Hintergrund ihres kritischen
Verhaltens, "weil wir ja aus unserer Lebenserfahrung heraus und in die
Lebenserfahrung der Leser hineininterpretieren, nicht aus einer Leere in eine
andere", wie sie in der Dankesrede anlässlich der Verleihung des Preises der
Frankfurter Anthologie im Jahr 1999 sagt.

Text: F.A.Z., 11.02.2005, Nr. 35 / Seite 33
Das Gefühl, in Dresden fehl am Platz sein
Von Hubert Spiegel
11. Februar 2005
Ruth Klüger, seit Jahrzehnten in Amerika lebende Germanistin aus Wien, hat einen Vortrag abgesagt. Dergleichen kommt vor, bekümmert die Veranstalter und das Publikum, ist aber darüber hinaus in der Regel der Rede nicht weiter wert. Daß es sich in diesem Fall anders verhält, liegt an Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung, am Gegenstand des Vortrags, an der Person der Rednerin und an ihrer Lebensgeschichte.
Ruth Klüger, eine Überlebende der Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau und des Arbeitslagers Christianstadt, möchte nicht an jenem 13. Februar im Dresdener Schauspielhaus über den jüdischen Romanisten Victor Klemperer sprechen, wenn sich die Bombardierung der Stadt durch die Alliierten zum sechzigsten Mal jährt und, wie man befürchten muß, der alljährlich an diesem Datum stattfindende Aufmarsch der Rechtsextremisten besonders starken Zulauf erhalten wird.
In einem Brief an Holk Freytag, den Intendanten des Dresdener Schauspiels, hat Ruth Klüger ihre Absage vor allem mit den Vorgängen um die radikalen Rechten in Sachsen begründet: „Wenn eine ehemals verfolgte Jüdin - und als solche bin ich in Deutschland vor allem bekannt - im Staatsschauspiel einen Vortrag über einen verfolgten Juden, nämlich Victor Klemperer, hält, während auf der Straße tausende (sic!) judenfeindliche Parteianhänger demonstrieren, so wird daraus unweigerlich ein politisches Spektakel. Damit habe ich aber nicht rechnen können, und daran möchte ich nicht teilnehmen.“
Das Gefühl, in Dresden fehl am Platz sein
Als Ruth Klüger im Januar aus ihrer kalifornischen Heimat nach Deutschland kam, wurde sie sofort nach ihrer Ankunft gefragt, wie sie die Zunahme rechtsextremer Aktivitäten in Deutschland beurteile. „Vor vier, fünf Wochen“, so sagt sie jetzt im Gespräch mit der F.A.Z., „habe ich das noch als Randerscheinungen eingeschätzt. Wenn man wie ich in Amerika lebt, ist man über diese Dinge nicht so gut informiert. Selbst der Wahlerfolg der NPD im Sächsischen Landtag ist in den amerikanischen Zeitungen kaum eine Nachricht. Aber je mehr ich über die jüngsten Entwicklungen erfuhr, desto stärker wuchs in mir das Gefühl, ich würde am 13. Februar in Dresden fehl am Platz sein. Ein paar hundert glatzköpfige Neo-Nazis hätte ich vielleicht ertragen, aber ein paar tausend, wie jetzt befürchtet wird? Nein.“
Ruth Klüger hat gewußt, daß es keine einfache Aufgabe sein würde, als Jüdin am Jahrestag der Bombardierung Dresdens über Victor Klemperer zu sprechen, der den Terror der Judenverfolgung, den er jahrelang ertragen mußte, auf beklemmende Weise in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Aber sie wußte nicht, daß der 13. Februar seit Jahren einen festen Termin in der Agenda der Rechtsradikalen darstellt. „Für mich ist dieser Tag ein Tag der Trauer. Hätte ich gewußt, daß es ein Tag der Aufmärsche ist, hätte ich den Vortrag niemals zugesagt. Dann mußte ich hören, daß Neo-Nazis aus vielen Teilen Deutschlands an diesem Tag nach Dresden reisen würden. Womöglich wäre ich mit einigen von ihnen im selben Zug nach Dresden gefahren.“
Zufällig am Jahrestag der Bombardierung
Ruth Klüger macht dem Veranstalter keine Vorwürfe. Die „Dresdener Reden“ werden seit vierzehn Jahren im Schauspielhaus gehalten, jeweils an den vier Sonntagen des Februars. Die Liste der Redner reicht von Willy Brandt bis Michail Gorbatschow. Daß eine von vier Reden in diesem Jahr am Jahrestag des Bombardements gehalten werden sollte, ist ein Zufall, dem Dresdens Intendant Holk Freytag mit der Wahl einer Rednerin Rechnung tragen wollte, die der Mordlust der Nazis um Haaresbreite entgangen ist.
Ruth Klüger wurde 1931 in Wien geboren und im Alter von zwölf Jahren zusammen mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert. Mutter und Tochter gelang die Flucht, 1947 emigrierten sie in die Vereinigten Staaten, wo die Tochter zu einer angesehenen Germanistin wurde, die in Princeton und Irvine lehrte. Ihre eigene Leidensgeschichte hat sie in ihrer Autobiographie beschrieben, die 1992 unter dem Titel „weiter leben“ erschienen ist.
Ähnlich wie Klemperers Tagebücher oder die Erinnerungen von Marcel Reich-Ranicki beschreibt auch „weiter leben“, wie die deutsche Sprache, wie Kultur und Literatur den Verfolgten zu einer Quelle der Kraft und des Trostes werden konnten, die ihnen half, Not und Verfolgung zu überleben. So ist es verständlich, daß die Arbeit an der Autobiographie nicht in Amerika begann, wo sie seit 1947 lebt, sondern in Deutschland, in Göttingen, während eines Forschungssemesters an der dortigen Universität.
Eine Tatsache, die es zur Kenntnis zu nehmen gilt
Jetzt wird das ausverkaufte Große Haus in Dresden am Sonntag vormittag leer bleiben. Ein Ersatzredner für Ruth Klüger wurde gesucht, aber nicht gefunden, und das ist auch besser so. Es besteht kein Anlaß zur Hysterie, und wer Ruth Klüger auch nur ein wenig kennt, der weiß, wie fremd ihr diese Gefühlsregung ist. Aber man sollte über diesen Vorgang nicht einfach hinweggehen. Sechzig Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wagt eine Überlebende des Holocaust es nicht, in einem deutschen Theater öffentlich über einen anderen Überlebenden des Holocaust zu sprechen, weil sie Störungen und Übergriffe von Rechtsextremisten fürchtet.
Das ist, jenseits aller Erwägungen über die Besonderheiten der Dresdener Situation, zunächst eine Tatsache, die es zur Kenntnis zu nehmen gilt. „Viktor Klemperers Weg als Deutscher und Jude“, so lautet der Titel eines Vortrags, der am 13. Februar 2005 in Dresden nicht gehalten werden kann.