
4-6-2004
Holocaust I
השואה

Saturday 3 June 2000
How horror of the
Holocaust was revealed to the world
By Michael
Smith
THE Daily Telegraph broke the story of the Nazi gas chambers to a disbelieving world on June 25, 1942, with the stark headline "Germans kill 700,000 Jews in Poland".
The strange manner in which the newspaper came by the evidence is related in a Holocaust exhibition, due to be opened by the Queen on Tuesday, at the Imperial War Museum.
The story, which included first-hand accounts of "travelling gas chambers" in which an average of 1,000 Jews were being gassed each day, described the killings as "the greatest massacre in the world's history". Government officials already knew about the murders from the decrypts of German messages broken at Bletchley Park. Churchill had even denounced them as "a crime without a name".
But the Telegraph's first-hand reports of the killings, smuggled into Britain by the Polish resistance, were widely disbelieved by a sceptical public swamped with anti-Nazi propaganda. A reporter following up the story for another newspaper even went so far as to suggest to the Polish courier that he should "drop a zero or two" if he wanted to be believed.
The extraordinarily detailed reports, which included the gassing of 40,000 Jews at the Chelmno extermination camp but did not mention the similar camp at Auschwitz, were smuggled out of Poland on microfilm hidden inside a key.
The Daily Telegraph report said: "Everywhere the procedure has been the same. Men and boys between 14 and 60 have been driven together into one place, usually a public square or cemetery, and there killed. Children in orphanages, pensioners in almshouses and the sick in hospitals have been shot. Women have been killed in the streets."
The way in which news of the Holocaust reached Britain is a recurring element of the £17 million exhibition, which has taken four years to research. Some survivors have criticised it as being too unemotional, "too British". But Prof David Cesarani, one of the exhibition's expert advisers, said it was important to make it "a scrupulously balanced interpretation".
From the very start Suzanne Bardgett, the project director, and her team of curators had taken the view that attempts to exaggerate or sensationalise what happened during the Holocaust were not only redundant but counter-productive. As a result, the exhibition has "tremendous weight and authority, which is the best way to refute the claims of the Holocaust deniers", Prof Cesarani said.
The only moments of relief from the terror that swept across Nazi-occupied Europe come in the exhibits on the work of those who saved Jews, such as the Swede Raoul Wallenberg and the British spy Frank Foley. Despite the exhibition's balance, it is clear that Foley, who broke strict British immigration rules to allow thousands of Jews to emigrate to Palestine, was one of only a few Britons who recognised what was happening.
For Daniel Falkner, now 88, the exhibition's most poignant reminder of what happened to him is a small wooden cart which he last saw in the Warsaw Ghetto. Mr Falkner said: "People died like flies in the ghetto. Every morning, people with such carts would come round to collect the bodies of those who had died in the night." Mr Falkner is one of 16 survivors whose testimonies are told in video in the exhibition.
Another is Roman Halter, 72, a survivor of Auschwitz, who believes that, in providing his testimony to the exhibition, he has fulfilled a promise he made to his grandfather as he watched him dying in the Lodz ghetto. The old man said: "When you survive, speak all you have witnessed. Speak it the best way you can. Do not philosophise. Murder is murder."
But even without the interventions of revisionist historians such as David Irving, the survivors are aware of the difficulties of getting people to believe that anyone could behave the way Nazis did towards the Jews.
It was an evil so monstrous that it defied belief
(Filed: 27/01/2001)
Today is the first Holocaust Day, chosen because it is the anniversary of the liberation of Auschwitz. It will be marked by a televised ceremony attended by the Prince of Wales. Michael Smith recounts how the horrors of the Holocaust came to the attention of the world.
THE first that the Allies knew of what was to be called the Final Solution was in mid-July, 1941, just over a month after the start of Operation Barbarossa, the Nazi invasion of the Soviet Union.
That was when British codebreakers at Bletchley Park began deciphering messages between the SS commanders of the Order Police, mopping up after the invasion force, and Berlin. Some weeks before, German police commanders, including Obergruppenfuehrer Erich von dem Bach-Zelewski, were called to Wewelsburg Castle, the home of Heinrich Himmler, the SS Reichsfuehrer.
He told them that one of their roles would be to remove the Jews from Europe. Bach-Zelewski was to command the SS and Order Police units pushing through Belorussia and to annihilate not just local resistance but also Jewish "plunderers". Messages to Berlin were in the SS Enigma cipher and a relatively simple hand cipher called Double Playfair. Bletchley Park was able to read both.
On July 18, 1941, Bach-Zelewski sent a message to Himmler saying that "in yesterday's cleansing action in Slonim, 1,153 Jewish plunderers were shot". Three weeks later, he reported that his men had killed 30,000 "partisans and Jewish Bolsheviks". Throughout the summer, the horrific statistics grew.
One intelligence analyst at Bletchley Park noted that "the word has gone out that a decrease in the population of Russia would be welcomed in high quarters, and leaders of the three sectors stand in competition with each other as to their score". A measure of the disbelief with which reports of the Holocaust were met came in a terse response from the War Office that said "certain opinions and conclusions" were being "erected on shallow grounds".
But Winston Churchill believed the messages. So much so that he appears to have risked giving away the secret of Bletchley Park. In a speech in August 1941, he denounced the "scores of thousands of executions in cold blood". He added: "We are in the presence of a crime without a name."
The first concentration camps were set up in March 1933, shortly after Hitler came to power, to incarcerate his Left-wing opponents. But in early 1941 a camp was built at Birkenau, close to the Polish town of Oswiecim, known as Auschwitz. The town, about 40 miles west of Krakow in south western Poland, was already the site of a labour camp for Polish prisoners.
But Auschwitz was to become the most notorious of Hitler's death camps. Rudolf Hoess, the camp commander, was summoned to Berlin, where Himmler told him: "The Fuehrer has ordered that the Jewish question be solved once and for all. I have decided to entrust this task to you. The Jews are the sworn enemies of the German people and must be eradicated. Every Jew is to be destroyed."
A few weeks after Churchill's speech, one of the SS guards at Auschwitz had an idea. The Germans had been using an insecticide made from hydrogen cyanide to fumigate the camp huts. The Zyklon B crystals turned into lethal gas when exposed to the air. It was a perfect way to kill those who could not work in the labour camp.
The first experiment took place on Sept 3 1941. The victims were 600 Soviet prisoners of war and 250 sick prisoners taken from the camp hospital. Hoess said: "About one third died straight away. The remainder staggered about and began to scream for air. The screaming soon changed to the death rattle and in a few minutes all lay still."
Once again, the codebreakers at Bletchley Park, and Churchill and senior British officials, were aware that the Jews were being killed, though not of the full horrific details. It was nine months before The Telegraph broke the story of the Nazi gas chambers on June 25 1942, under the headline: Germans murder 700,000 Jews in Poland.
The report, which said 1,000 Jews a day were being gassed, was based on information from the Polish Underground. But it was not believed, even among those who were privy to the codebreakers' reports. Victor Cavendish-Bentinck, the chairman of the Joint Intelligence Committee, complained that the Jews exaggerated what was happening "in order to stoke us up".
A Jewish US Supreme Court judge spent an hour listening to one of the Polish Underground couriers and then told him: "I am unable to believe you." This was scarcely surprising. Lilli Kopecky, an Auschwitz survivor, said: "This is the greatest strength of the crime - its unbelievability. When we came to Auschwitz, we smelt the sweet smell. They said, 'There the people are gassed'. We didn't believe it."
Thousands were transported from as far away as south-western France, Norway and the Greek islands. As they arrived they were selected for labour, for death, or in some cases, for Block 10, where Dr Josef Mengele carried out gruesome, often deadly, experiments on inmates. Those who were gassed were stripped of anything of value and cremated.
Hoess said: "The special detachment set about removing the gold teeth and cutting the hair from the women. The bodies were laid in front of the ovens, which had been stoked up. Up to three corpses could be put into one oven at the same time." By October 1944, with Soviet troops advancing through Poland, the Germans began to evacuate the camp and to destroy the evidence.
By the time the Red Army liberated Auschwitz on Jan 27 1945, only 5,000 inmates remained. The guards had destroyed 29 of the 35 stores holding their possessions, but Russians still found 836,255 women's dresses, 348,000 mens' suits and 38,000 pairs of mens' shoes.
But it was not until April, when the Americans liberated Buchenwald, the British reached Bergen-Belsen, and the Russians took Theresienstadt that the world realised the Jewish claims were true. The late Rabbi Hugo Gryn, who survived Auschwitz, said: "It was a denial of God. It was a denial of man. It was the destruction of the world in miniature form."
|
Fri., December 26, 2003 Tevet 1, 5764
A great divide, forever divided
By Natan Sznaider
"Der Holocaust und die westdeutschen Historiker" by Nicolas Berg, Wallstein, 768 pages, 46 euros
In "Der Holocaust und die westdeutschen
Historiker," Nicolas Berg presents an indictment. In a
double move, while attacking German historians specializing in the study of the
Holocaust, he also tries to restore the respect that was once enjoyed by the
Jewish "history of memory" and to strengthen it in its determined struggle
against the guild of German historians.
The book meticulously describes how, since 1945, German
historiography deliberately refused to understand the Holocaust and
systematically rejected attempts by Jewish historians to provide a scientific
context for their personal experiences and horrors. As Berg shows his readers,
H.G. Adler, Hannah Arendt, Raul Hilberg, Leon Poliakov and Josef Wulf were all
expected to prove to German historians that they were capable of discussing the
extermination of the Jews during the Holocaust in a sober-minded, objective
manner. In effect, German historians believed that they were the only ones able
to engage in such a discussion. After all, were not they the ones who developed
theories, according to which no one bore guilt for anything?
Thus, for example, Martin Broszat, former director of the
Institute of Contemporary History in Munich, stubbornly argued, in an exchange
of correspondence with historian Shaul Friedlander, that the German scholarly,
theoretical perspective came very close to meeting the criteria of objective
research, whereas Jewish scholarship sought the asylum of "memory and
bereavement" or - to use Broszat's term - "the mythic memories of the victims."
The imagined tension between Jewish "emotionalism" and German
"objectivity" lies at the heart of Berg's perception and research work. His book
goes beyond merely an exchange of letters between a German historian and a
Jewish one, and instead presents a dialogue (which apparently never really took
place) between German and Jewish historians. As Berg demonstrates, it was German
historians (Friedrich Meinecke, Gerhard Ritter, Hans Mommsen and many others)
who denied that the Jews were capable of truly understanding the Holocaust.
Claiming that they were meeting their professional obligations
as historians in conducting a "historicization" of the period of the Holocaust,
German historians were actually bent on" normalizing" the Holocaust, reducing
its dimensions, and turning it into a brief 12-year episode in a magnificent
German history spanning several millennia. In bypassing these 12 years, they
hoped to enable their era - namely, that of postwar Western Germany - to return
to the track of history. The presence of Jewish historians who attempted to
participate in the German historiographic discourse and the lens they trained on
this historical "episode" were sabotaging the normalization process.
One of these Jewish historians, Josef Wulf, the book's chief
protagonist, paid for his efforts with his life. Wulf, a historian and Holocaust
survivor who single-handedly established a unique documentation center,
committed suicide in 1974 after years of vainly trying to obtain the Institute
for Contemporary History's professional recognition and financial support. It
was Wulf who, together with Poliakov, wrote the first books on the Holocaust
published in Germany in the late 1950s, such as, for example, "Das Dritte Reich
und die Juden: Documente und Aufsatze" and "Das Dritte Reich und seine Denker."
In their books, Wulf and Poliakov turned the Holocaust's perpetrators into human
beings: They became flesh-and-blood individuals and were not referred to merely
as anonymous bureaucrats in a nontransparent organization. Wulf even referred to
them specifically by name. Interested readers who want to peruse the detailed
indexes in his books will find there the creme de la creme of the new West
German elite, involved up to their necks in Nazi war crimes. But what would be
the use of such a perusal since, in any case, the Jews have always been
considered victims who never forget and never forgive their victimizers?
Target of criticism
In this context, Berg also discusses Germany's appropriation
of Arendt. Totally divested of her original intention, Arendt's book "Eichmann
in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil" became one of the fundamental
texts of the functionalist school of the Holocaust, a school of thought that
explains the Holocaust within the context of the "cumulative radicalization"
model (Hans Mommsen) of bureaucratic mechanisms competing with one another.
According to this explanation, the mass-murder machine was not driven by the
force of passions. The "banality of evil," the well-known term coined by Arendt,
was taken completely out of context and became a catchword for this
structuralist concept, which has recently become the subject of controversy.
Mommsen treated with contempt the criticism voiced by Jewish historians
regarding the functionalist interpretation of the Holocaust, and considered that
criticism to be the expression of a Zionist perspective.
Berg, who today finds himself the target of criticism from
these historians and their students, exposes this strategy as typical of a
certain breed of German historians, who do not want Jewish historians "to rob
them of the Holocaust." In a primitive act accompanied by a reversal of roles,
the former victims were accused of preventing objective historical research and
depiction of the process of their extermination. Berg succeeds in brilliantly
uncovering the true character of the German historiographic discourse - as a
discourse seeking to blur both the perpetrators' motives and the victims'
identity while, at the same time, criticizing the inadequacy of memory as a
historical tool.
Berg's presentation is impressive. He clarifies that, in
modernity, the difference between the perpetrator's memory and that of the
victim is an important and central aspect of the mutual absence of
understanding. The memory of the Holocaust can develop along national lines, but
it can also coalesce on the basis of the personal outlooks of the victims.
However, this was not the issue that German historians were concerned with. In
their eyes, the Holocaust would always be "Die deutsche Katastrophe" (Meinecke)
- an exclusively German calamity. For Jews, the central issue in the study of
the Jewish tragedy was different: As victims, they sought to preserve their
right never to forget, never to forgive. The victims who survived believed that
it was their mission to preserve that right. However, that does not mean that
there is no possibility of conciliation, although one must ask what would be the
borders of this conciliation. The political context in that question is of
central interest.
Berg, a researcher at the University of Leipzig's Simon Dubnow
Institute for Jewish History and Culture, rejected the illusion of the possible
emergence of an objective joint German-Jewish narrative of the Holocaust. In his
breath-taking description of the clash between German and Jewish history, Berg
exposes the impossibility of a bridge between the two narratives. All that
remains is the memory of a common history that will continue to be divided.
It is possible to argue that Berg attaches too much importance
to the historian's capacity for determining the significance of historical
events. Had he studied popular culture, Berg would have discovered that film
directors like Steven Spielberg and Roman Polanski have, for a considerable
period of time, focused on the dialectics between emotionalism and objectivity -
a dialectics with which Berg is deeply concerned. It is possible that in their
attempts to determine the significance of historical events, historians lose
their own significance. The many perspectives - Jewish, non-Jewish, secular and
religious - compete for the use of collective memories and undermine the
positions of the experts.
When one reads Nicolas Berg's book, it is difficult to regret
that fact, especially when the positions being undermined are those of German
historiography.
Prof.
Natan Sznaider teaches at the Academic College of Tel Aviv.

The Nazi Conscience
By Claudia Koonz
Belknap,
362 pp., illustrated, $29.95
Refuge in Hell: How Berlin's Jewish Hospital Outlasted the
Nazis
By Daniel B. Silver
Houghton Mifflin,
311 pp., illustrated, $24
These two books deal with one of the central questions in the history of the National Socialist regime in Germany: How was the Nazi leadership able to persuade the German people to accept, first, the disenfranchisement and expropriation of what until 1933 had been one of the best-assimilated Jewish communities in Europe, and then, after the invasion of the Soviet Union in the summer of 1941, the mass murder of all Jews -- men, women, and children -- in the Nazi sphere of influence? Historian Daniel Goldhagen has provided one explanation, claiming that from the late 19th century a general agreement developed in Germany that the Jews were an undesirable and harmful element in society. This consensus for "eliminationist anti-Semitism" led ordinary Germans to become "Hitler's willing executioners."
This explanation has not gained general acceptance. Most scholars have stressed the successes of Jewish integration -- the fact that by 1930 nearly 30 percent of Jews marrying in Germany were taking non-Jewish partners and that alongside the 550,000 Jews in Germany when the Nazis took power in January 1933, there were at least another 200,000 Germans descended in some degree from Jews. The Nazis had great difficulty in providing a clear definition of what constituted a Jew from a "racial" point of view, and the Nuremberg Laws of 1935 took a rather restricted view of this problem, creating categories of first- and second-class "mixed persons" (Mischlinge). First-class Mischlinge (the higher category from the Nazi point of view) were those with two Jewish grandparents but unconnected with organized Jewish life. They could intermarry with "racially pure" Germans, and the hope was that they would be absorbed in the national community.
Acts of anti-Jewish violence often aroused unease among those who observed them -- this was particularly the case with the disorder that followed the assassination in November 1938 of a German diplomat by a desperate Jewish youth. As late as October 1943, Heinrich Himmler, the principal architect of the Nazi genocide, in a secret speech to the leading figures in the SS could refer to "a really grave matter . . . which could never be spoken of in public . . . the annihilation of the Jewish people." He went on: " 'The Jewish people is going to be annihilated,' says every party member. 'Sure, it's in our program, elimination of the Jews, annihilation -- we'll take care of it.' And then they all come trudging, million worthy Germans, and each one has his one decent Jew."
The success of the Nazis in carrying out their attempt first to exclude the Jews from German society and then to carry out a Jewish genocide has usually been attributed to the skill with which they scapegoated the Jews and showed that they could be attacked with impunity.
Claudia Koonz has a different explanation. She argues that Hitler and the Nazis did not directly propagate their extremist anti-Semitism among the large majority of Germans. Hitler, in particular, kept his virulent hatred of the Jews for his inner circle and instead built his charismatic appeal not on a summons to hate, but in his appeal to the collective virtue of the German people and the need to reconstruct a sense of community destroyed by decadent liberalism and divisive socialism. Koonz calls her book "The Nazi Conscience," quoting a speech of Hitler's of Oct. 8, 1935, in which he claimed that "I view myself as the most independent of men . . . obligated to no one, subordinate to no one, indebted to no one -- instead answerable only to my own conscience. And this conscience has but one single commander -- our Volk!"
Certainly in the years from 1933 to 1939, Nazi public culture was saturated with a blend of racial fear and ethnic pride that Koonz describes as ethnic fundamentalism. Ordinary Germans were prepared for genocide by the widespread propagation of racial concepts -- generally presented as part of a worldwide trend in favor of eugenics and racial hygiene -- in ostensibly nonpolitical form through academic research, documentary films, and mass-market magazines.
Koonz does not deny the existence of extremist and violent anti-Semites in the Nazi leadership. But her stress on the moderate way their ultimately genocidal plans were presented as necessary cruelties adds an important dimension to our understanding of the Nazi regime and its crimes.
Daniel Silver, in "Refuge in Hell," describes one of the strangest paradoxes of the Nazi genocide. Throughout the war, while the Nazis were murdering millions of Jews, the main Jewish hospital in Berlin, founded in the 18th century, continued to function. This hospital, one of the most advanced medical facilities in the German capital, was the last surviving Jewish institution in Germany when Berlin was liberated in April 1945. In addition to its medical functions, during the war it also served as a prison, a ghetto, a deportation center, a branch of the Gestapo, and a small army camp. It was home to about 800 doctors, nurses, patients, and others, most of them half-Jewish or Jewish, living in "privileged" mixed marriages. They constituted a large proportion of the legal Jewish survivors in the capital. Silver's book attempts to explain the survival of the hospital. This was above all the consequence of a turf war between rival Nazi security services. The Berlin Gestapo wanted to close the hospital in 1943, whereas the superior authority, the Main Security office, wanted to gain control of the buildings and insisted on postponing a decision. Those responsible for the administration of the hospital may also have feared that its liquidation would lead them to be sent to the Eastern Front.
The hospital's survival also reflected the ambiguities of earlier Nazi policy on the Jews. Many of those working in the hospital or patients there were Mischlinge. This was the case of the director of the hospital, Walter Lustig, a convert to Lutheranism who had good links with a number of leading Nazis. (Lustig was arrested after the war by the Soviets who occupied the part of Berlin where the hospital was located and was probably executed by them.)
The durability of the hospital may also be linked with one of the most perplexing events in the history of the genocide. At the beginning of 1943, Hitler ordered that the remaining 40,000 Jews in Berlin be deported. Those arrested were held in a number of locations before deportation. One of these, where a number of doctors and nurses from the hospital were detained, was on the Rosenstrasse. At the beginning of March, their non-Jewish wives and dependents, reportedly numbering from several hundred to 1,500 people, demonstrated for the release of those threatened with deportation and death. These demonstrations, unprecedented in the Third Reich, continued for several days until on March 6, Joseph Goebbels in his capacity as Gauleiter of Berlin ordered the release of the Jewish spouses and Mischlinge children imprisoned as a result of the roundups. Numbering several thousand, they mostly survived the war. Was fear of a recurrence of these demonstrations another factor in the survival of the hospital?
There are no easy lessons to be learned from these two books. What they do show is that even if the Nazi persecution and genocide of the Jews required deeply committed ideological zealots to carry it out, it could not have succeeded to the degree it did without the tacit (and in some cases active) support of the silent majority of "good" Germans. It is another demonstration of the truth of Edmund Burke's aphorism that for evil to triumph it is only necessary for good men to do nothing.
|
|
Dec. 18, 2003
Hospital for the almost-dead
By
GUR SALOMON
Refuge in Hell: How Berlin's Jewish Hospital Outlasted the Nazis By Daniel B.
Silver
Houghton Mifflin Company
311 pp. $24
By the time Soviet troops conquered Berlin in April 1945, only one Jewish institution remained intact in all of Germany. At the Berlin Jewish Hospital, some 800 exhausted Jewish survivors - doctors, nurses, administrators, patients, prisoners, and others - met their liberators with apprehension, and exerted considerable effort to explain to the astonished troops that they were not the enemy.
The liberators' initial disbelief was understandable. The full magnitude of Nazi atrocities had just been revealed. Now they encountered hundreds of living Jews in the heart of the Nazi capital.
The bizarre tale of the hospital never received much publicity, and certainly never became a symbol of Jewish heroism like the Warsaw Ghetto Uprising did. Exploring how and why the hospital survived against all odds is the main endeavor of Daniel Silver's Refuge in Hell. The book's second aim is to deliver an honest description of daily life in an inhuman environment.
Silver, a former general counsel to the NSA and CIA, gives a thorough history of the hospital and an account of its functioning which is astounding, but the book at times makes for tedious reading, reminiscent of an academic review. Fortunately, Silver is not skimpy with survivors' personal accounts whose portrayal of life under the Nazis is riveting.
The hospital's roots extend to medieval times, but Silver covers only the period from 1938 to 1945. Kristallnacht signaled the beginning of the end, when the hospital was placed under the direct supervision of the Reich Security Main Office (RSHA), headed by Adolf Eichmann. In 1938, because of Nazi racial laws, the hospital was no longer permitted to admit non-Jewish patients, and bright Jewish physicians from all over Germany found themselves unemployed. The closure of all Jewish medical and welfare institutions turned the Berlin Jewish Hospital into the only functioning medical institution available to German Jews.
During the war years, the hospital represented a shaky haven from the Reich. Many who found refuge there were not patients, but Jews married to Aryans, who were protected from deportation, and half-Jews who never before had any connection with their Jewish roots. Full Jews and their children were a rarity, though they could be found in larger numbers among the medical staff. In 1941, the hospital expanded to include a police ward for Jewish prisoners and a Sammellager - a holding camp for Jews awaiting transport to the death camps.
The macabre irony of Refuge in Hell is that the deportees were sent by the Nazis to have their health restored before being shipped to their death.
"Perhaps from time to time," writes Silver, "a virtually instinctive German sense of bureaucratic order came to the fore and was applied unthinkingly, even in the midst of mass murder."
THE JEW who knew better than any other about the German bureaucratic mindset was Dr. Walter Lustig, head of the national central Jewish organization and director of the hospital from 1942 (his predecessor committed suicide together with his wife soon after receiving notice of their deportation). The book is largely about him and the life-and-death power he was given. A highly controversial figure from start to finish, Lustig's dealings in those years with his boss, Eichmann, remain as much a mystery as the man himself. Lustig was coerced to select patients and medical staff for deportation. But he also exhibited care for the ill, and could not prevent the deportation of his father to Theresienstadt.
Villain or hero? Silver does not reach a final conclusion. But there is agreement that his knowledge of the system and the personal connections he formed with senior Nazi officials - often colleagues from his service with the pre-war German police - were critical to the hospital's survival.
So was the decision made by Jewish leaders to cooperate with the deportation scheme. As long as the Nazis perceived the hospital as helpful in implementing the deportation apparatus, it would remain open. In addition, there was the Nazi leaders' indecisiveness concerning the final fate of intermarried Jews and part-Jews, which kept a minimal Jewish presence on German soil. Another crucial element was the bureaucratic rivalry between Eichmann's RSHA and the Berlin Gestapo regarding the future ownership of the hospital's handsome buildings and garden.
Perhaps as a result, the hospital was always "living on borrowed time." Periodic assaults by the Gestapo and SS ended with the deportation of many doctors and nurses to the death camps. In one particularly horrific event in March 1943, Lustig was ordered to select 100 people - half of the medical personnel - for deportation. Other members of the medical staff managed to emigrate to the US, committed suicide, or went into hiding. The rest had to fill every duty around, including acting as electricians, carpenters, and even firefighters. Patients begged for a medical deferment and swallowed poison. The mentally ill, young orphans, and elderly Jews were doomed right from the start.
But there was more than just tragedy and misery. Younger staff members in search of normality took the daring risk of going out for a night on the town without their mandatory yellow star. There was a culture of Jewish performances, social gatherings, sex, forbidden romantic love, and clandestine religious observance.
The drama reached new heights in the final months of the war, with relentless Allied bombing and increasing uncertainty about the Nazis' plans for them. Ultimately, 800 Jews lived to tell the tale.
One minor quibble: Silver seems to celebrate the fact that 800 Berlin Jews - out of a total of 186,000 pre-war Jews - survived. (In fact, a total of 5,100 Jews were living in the city at the war's end.) Surely, this is cold comfort.
What remains unchallenged is the biggest irony of all. In the afterword dedicated to the hospital today, we learn that the facility is still on the original site, bears the same name, and continues to provide medical services. The current medical director is Israeli-born, and preference in hiring is given to Jews. But in a hospital which managed to serve Jews even during the Nazi era, few Jewish patients fill the beds. Instead, the majority are Muslim Turks.

taz Magazin Nr. 7278 vom 7.2.2004, Seite VII, 206 Zeilen (Kommentar), PETER SCHÖTTLER,
VON PETER SCHÖTTLER
Nicolas Berg: "Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung". Wallstein, Göttingen 2003, 766 Seiten, 46 Euro
Die deutsche Historikerzunft kommt nicht zur Ruhe. Auf das Erdbeben des Frankfurter Historikertages von 1998 folgen immer neue Hiobsbotschaften. Kaum eine vergangene Größe der Geschichtswissenschaft, die nicht ob ihrer "Verstrickungen" ins NS-Regime kritisiert würde. Als ob ein Tabu gefallen wäre und jetzt keine Doktoranden mehr befürchten müssten, wegen allzu kritischer Nachforschungen bestraft zu werden. Manche Professoren sprechen sogar abschätzig von "Mode", als ob Erneuerungen in der Wissenschaft ohne Nachahmungseffekte und Übertreibungen zu haben sind. Viele Fragen, die nach 1945 versäumt wurden, sind jedenfalls noch keineswegs beantwortet.
Eine der brisantesten war und ist die nach dem Holocaust. Wann und wie haben die Historiker in der Bundesrepublik begonnen, die Umstände, das Ausmaß und die Ursachen des Judenmordes systematisch zu erforschen und der Öffentlichkeit als "Zivilisationsbruch" zu vermitteln? Dies ist das Rahmenthema einer umfangreichen Dissertation, die kürzlich der Historiker Nicolas Berg vorgelegt hat. Unter Berufung auf Ansätze der Diskursanalyse und Kulturgeschichte versucht Berg, nicht bloß Argumentationen, sondern auch Denkstile und Verhaltensmuster zu rekonstruieren, die erklären sollen, wie und warum die Erforschung des Holocaust im engeren Sinne so lange hinter einer allgemeinen Geschichte der "braunen Diktatur" zurückgeblieben ist.
Während die einen Hitler und seine Anhänger zu einem "Verbrecherclub" dämonisierten - und so die breite Masse des "deutschen Volkes" zum Opfer stilisierten, obwohl Millionen mitgemacht oder zugeschaut hatten -, begannen andere mit akribischer Quellenforschung. Sie konnten sich aber oft nicht entschließen, die Namen der Täter und ihren wichtigsten ideologischen Rückhalt, den Antisemitismus, offen auszusprechen. Der Grund ist klar: Die westdeutsche Gesellschaft der Fünfzigerjahre stand zwar unter dem Schock der Niederlage, doch es waren immer noch dieselben Menschen, die sich nun unter Aufsicht der Alliierten gleichsam selber "entnazifizieren" sollten.
Wie wir heute wissen, war dabei viel Vertuschung und Verdrängung im Spiel; Apologie, Amnestie und Amnesie gingen Hand in Hand. Konservative Beobachter haben stets erklärt, diese Art der "Vergangenheitspolitik" (Norbert Frei) sei letztlich notwendig gewesen, um die Nachkriegsgesellschaft mit sich selbst zu versöhnen und auf den "Weg nach Westen" (Heinrich August Winkler) zu lotsen. Andere dagegen forderten eine möglichst schnelle und schonungslose Aufarbeitung: politisch und juristisch, aber auch wissenschaftlich. Mit dem ominösen Schlagwort "Vergangenheitsbewältigung" konnte beides umschrieben werden: das Schweigen ebenso wie das offene Aussprechen, das Abwiegeln wie das ständige Erinnern an Verbrechen und Schuld.
Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts zeichnet Berg ein breites Panorama, das von den Nachkriegsdebatten über die "deutsche Katastrophe" (gemeint war 1945, nicht 1933!) und den Anfängen des Münchner "Instituts für Zeitgeschichte" bis in die jüngste Gegenwart reicht. Vieles, was er zutage fördert, ist bedrückend. Dass viele historische Lehrstühle mit ehemaligen Nazis oder Mitläufern besetzt waren und auch nach 1945 wurden, ist ja bekannt. Dass aber auch die Aufarbeitung der NS-Zeit zunächst "Ehemaligen" oblag, während frühere KZ-Häftlinge, Emigranten und Antifaschisten als "parteilich" ausgegrenzt wurden, belegt die nahezu ungebrochene Blindheit der deutschen Universität. Daher konnten bahnbrechende Dokumentationen und Studien zum Holocaust und zum Personal, das den millionenfachen Mord plante und durchführte, zunächst nur am Rand oder außerhalb des Wissenschaftsbetriebs entstehen.
Mit Recht stellt Berg die Pionierrolle von Joseph Wulf (1912-1974) heraus, der es sich nach seiner Rückkehr aus Auschwitz zur Aufgabe machte, nicht bloß die Taten, sondern eben auch die Namen der Täter zu dokumentieren. Das empört die etablierten Historiker. Wulfs Dokumentarstil galt als denunziatorisch. Als er 1961 den ehemaligen "Stadtarzt" von Warschau, Wilhelm Hagen, der es zum Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes gebracht hatte, als "Helfershelfer" darstellte, kam es zum Prozess, und die entsprechenden Seiten mussten geschwärzt werden.
Dieser Fall ist exemplarisch, da sich aus Akten des Instituts für Zeitgeschichte rekonstruieren lässt, dass ausgerechnet Martin Broszat, ein prominenter Mitarbeiter und späterer Institutsdirektor, Hagen unterstützte. Von Wulf distanzierte er sich und warf ihm vor, immer nur nach "Belastungsmaterial" zu suchen. Dabei hatte es Wulf lediglich gewagt, wie Berg schreibt, "das reale Verhalten Hagens vor Ort und nicht das ,eigentliche' Wollen oder gar die rückwirkende Erklärung zur Grundlage seiner Bewertung zu machen".
Hier deutet sich die besondere Brisanz des Buchs an: Für Berg waren viele, ja die meisten westdeutschen Historiker und nicht zuletzt die Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte einem Diskurs der Objektivität verfallen - sie selbst sprachen vom "Pathos der Nüchternheit" - , der sie dazu verleitete, prinzipiell allen Archivalien und manchmal auch den sachlichen Aussagen der Täter eher zu glauben als den Erinnerungen der jüdischen Opfer. Nicht die Intentionen der Täter seien ausschlaggebend gewesen, sondern quasi-anonyme Strukturen und Prozesse. Daraus ergibt sich Bergs zugespitzte These: der als "Strukturalismus" oder "Funktionalismus" bezeichnete Ansatz der Holocaust-Forschung verdanke sich letzten Endes einem "Geist der Apologie". Manche dieser Darstellungen seien gleichsam aus der "Perspektive der Mitläufer" verfasst worden. Sogar ein kritischer Historiker wie Hans Mommsen stehe mit seiner These von der kumulativen Radikalisierung der Judenverfolgungen in dieser problematischen Kontinuität.
Das ist nun freilich selbst eine durch und durch "funktionalistische" Argumentation, die von allen Intentionen - in diesem Fall der Historiker - abstrahiert. Obwohl Berg dafür plädiert, Wissenschaft und Erinnerung nicht gegeneinander auszuspielen, sitzt er am Ende selbst einer Konstruktion auf, die mit den realen Kämpfen innerhalb der Holocaust-Geschichtsschreibung kaum etwas zu tun hat. Hier rächt sich der rein ideengeschichtliche Ansatz seines Buchs und die Beschränkung auf ausgewählte Autoren. Denn von einer Diskurs- und Erinnerungsgeschichte hätte man sich eine breitere Untersuchung der Nachkriegswissenschaft und vielleicht sogar einen quantitativen Überblick darüber erwartet, wer damals NS-Forschung betrieb oder förderte.
Damit wären noch ganz andere Widerstände und Frontlinien sichtbar geworden, kurzum Kontexte, aus denen sich der Wandel der konkurrierenden Interpretationsansätze konkreter verstehen ließe. Denn diese Ansätze hatten eine eigene Konfliktgeschichte, die bei Berg auch dadurch aus dem Blick gerät, dass er sich mit den "intentionalistischen" oder gar "negationistischen" Ansätzen gar nicht weiter abgibt: So ist etwa vom "Historikerstreit" oder von Ernst Nolte fast nicht die Rede. Und eine rechtsradikale Geschichtspropaganda scheint es für Berg auch nicht zu geben. Dadurch gerät seine Darstellung in eine Schieflage, denn das Pathos der Wissenschaftlichkeit, das er den Funktionalisten vorwirft, war nicht zuletzt gegen diese realexistierenden Verharmloser und Apologeten gerichtet.
N Z Z Online
19. November 2003, 02:11, Neue Zürcher Zeitung
Nicolas Bergs Studie über die deutsche Holocaust-Forschung
Nicolas Berg: Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Wallstein-Verlag, Göttingen 2003. 768 S., Fr. 75.-.
Nicolas Berg erzählt in seinem Buch die Geschichte mehrerer Generationen deutscher Historiker, solcher, die während des Nationalsozialismus bereits erwachsen waren, und solcher, deren Jugend von Krieg und Diktatur überschattet wurde. Das Buch nimmt allerdings nicht noch einmal die von Götz Aly angestossene und von Ingo Haar beendete Diskussion um die deutschen Historiker Werner Conze oder Theodor Schieder auf, die zu Beginn ihrer akademischen Karriere im NS-Staat als Repräsentanten einer völkischen Historiographie «Vordenker der Vernichtung» (Götz Aly) waren und dennoch zu bis heute geschätzten Lehrern von Vertretern einer kritischen Gesellschaftsgeschichte wie Hans-Ulrich Wehler wurden (NZZ 16. 5. 01). Bergs Interesse gilt vielmehr der Frühgeschichte des renommierten Münchner Instituts für Zeitgeschichte, dem - fasst man Wissenschaft in dynastischen oder genealogischen Kategorien - bedeutende Mitglieder der von Fragen nach sozialstrukturellen Bedingungen inspirierten Zeitgeschichtsforschung von Hans Mommsen bis Norbert Frei entstammen.
Diese Schule hat ihre historiographischen Meriten bei der Auseinandersetzung um den nationalsozialistischen Judenmord durch eine sogenannte «funktionalistische» Perspektive erworben. Das Verdienst dieser Perspektive bestand darin, den Blick vom einsamen Diktator auf jene Gesellschaft, die ihm entgegenarbeitete, zu werfen. Wollte man - so liesse sich die Intention der frühen Mitglieder des Instituts für Zeitgeschichte benennen - diese Verbrechen nicht nur verurteilen, sondern in ihrer Genese erklären, wollte man nicht nur einzelne Individuen beschuldigen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihre Verbrechen ermöglichten, verstehen, dann kam alles darauf an, die deutsche Gesellschaft jener Jahre distanziert zu betrachten - und das heisst auch: die Verbrechen zu «historisieren».
Dieser Wille zur Wahrheit aber setzt eine gewisse Kälte voraus. 1985, als die Debatte zwischen «Funktionalisten» und «Intentionalisten» Fahrt gewann, fragte Martin Broszat auf einer Konferenz, ob die «doch bemerkenswerterweise auch unter Beteiligung jüdischer Gelehrter ziemlich leidenschaftlich geführte Kontroverse nicht wesentliche ausserwissenschaftliche Gründe» habe, «die diese Leidenschaftlichkeit zu erklären vermögen». - Die Art und Weise, wie sich das Münchner Institut für Zeitgeschichte, als dessen Direktor Broszat von 1972 bis zu seinem Tode 1989 wirkte, zu jüdischen Forschern, die mit dem Institut kooperieren wollten, verhielt, lässt indes den Rückschluss zu, dass Takt und Einfühlungsvermögen gegenüber den Betroffenen ebenso fehlten wie die Bereitschaft, die moralische Dimension der eigenen Forschungspraxis ernst zu nehmen.
Während etwa Hans Buchheim, fünfzehn Jahre lang Mitarbeiter am Institut, laut Berg Kontakte nicht nur zu Werner Best, dem «Reichskommissar für Dänemark» und Organisator des Reichssicherheitshauptamtes, sondern auch zu dem Statistiker der Vernichtung, Richard Korherr, unterhielt, schienen die Kontakte des Instituts zu den jüdischen, autodidaktisch gebildeten Historikern H. G. Adler und vor allem Joseph Wulf sehr viel schlechter zu sein. Und das nicht nur, weil diese überlebenden Juden - traumatisiert, wie sie waren - im persönlichen Umgang wohl schwieriger waren als im Habitus vertraute Personen wie Best oder Korherr. Berg zeigt, dass Buchheim und Broszat die Quellenpublikationen Wulfs oder Poliakovs ablehnten. Was in diesen Fällen noch den Skrupeln des Wissenschafters zuzurechnen sein dürfte, lässt sich für den wohl skandalösesten Fall dieser Art jedoch nicht mehr behaupten.
So hatte Joseph Wulf in einem Buch über das «Dritte Reich und seine Vollstrecker» auch die frühere Tätigkeit Dr. Wilhelm Hagens, Präsident des westdeutschen Bundesgesundheitsamtes von 1956 bis 1958, dokumentiert. Hagen hatte als Leiter des Gesundheitsamtes im Warschauer Ghetto 1942 bei Hitler dagegen protestiert, dass polnische Kinder und Greise ebenso getötet werden sollten wie die Juden - gegen Letzteres hatte er offensichtlich nichts einzuwenden. Wulf konnte Hagen nachweisen, dass ihm die miserablen Lebensverhältnisse der Juden und ihrer ebenfalls jüdischen Ärzte im Ghetto durchaus bekannt waren. Wilhelm Hagen wandte sich in dieser Kontroverse an das Institut für Zeitgeschichte und erhielt von Broszat einen Brief, der Solidarität ausdrückte: «Ich darf Ihnen versichern, dass wir selbst entsetzt sind über den Missgriff in Wulfs Buch. Unsere methodischen Einwände gegen diese Art grobflächiger und zusammenhangsloser Dokumentation sind dadurch aufs Neue bestätigt worden . . .» Broszat forderte zudem Wulf auf, Hagen Genugtuung zu verschaffen, und bestritt die Zuverlässigkeit des Archivs des jüdischen Ghetto-Historikers Ringelblum.
Nach Jahren der Auseinandersetzung, während deren es Wulf gelungen war, ein Schreiben Hagens zu publizieren, in dem dieser vorschlug, Juden, die das Ghetto verliessen, mit Geld- und Prügelstrafen zu belegen und im Falle des Vagabundierens zu erschiessen, schrieb Broszat noch einmal an Wulf und gab ihm nun in der Sache teilweise Recht. Indes: «Mir sind freilich», so fiel er sich reserviert ins Wort, «die Provenienzen und sachlichen Zusammenhänge, aus denen die von Ihnen neu beigebrachten Zeugnisse stammen, nicht hinreichend vertraut. Ich kenne und übersehe auch nicht die möglichen Gegenargumente Professor Hagens und möchte schon deshalb von einer Beurteilung beim jetzigen Stand der Dinge absehen.»
Was immer dieses Schreiben und Broszats Verhalten noch indizieren mögen, eines geht aus beidem klar hervor: Sympathie mit der Perspektive der Opfer, ein methodisches Ernstnehmen des Leidens schienen unwissenschaftlich zu sein. Die Begründung oder vielmehr die Nichtbegründung dieses Empathie- und Sympathieentzugs im Entstehen der neueren westdeutschen Zeitgeschichte ist das Thema der Arbeit Bergs. Indem er auf die weithin verkannte Rolle des 1913 geborenen Mediävisten Hermann Mau hinweist, des ersten Direktors des Instituts für Zeitgeschichte - er war zwar nicht Mitglied der NSDAP, wohl aber des NS-Dozentenbundes gewesen -, will er schliesslich zeigen, dass der soziologisch anspruchsvolle «Funktionalismus» in Mau seinen alles bestimmenden Vorläufer hatte: Berg spricht hier treffend von der «Geburt des Funktionalismus aus dem Geist der Apologie»: In einem Vortrag hatte Mau schon früh ausgeführt, dass im NS-Staat der innere Zusammenhang von Verantwortung und Vertrauen aufgelöst worden sei und der Staat daher aus dieser Konstellation «völlig hinausgleitet und dass dies ein Vorgang ist, den er selbst nicht in der Hand gehabt hat».
Die Psychoanalyse kennt eine Symptomenlehre, wonach sich zumal im auf den ersten Blick unscheinbaren und ephemeren Symptom die Verdrängung eines Traumas artikuliert. Die derzeit in Deutschland debattierte Frage, ob Martin Broszat sich 1944 als Siebzehnjähriger willentlich um die Aufnahme in die NSDAP bemüht hatte und warum er diesen Umstand, wenn es sich denn so verhielt, später nicht ebenso publik machte, wie er es mit seiner Mitgliedschaft in der Hitlerjugend getan hatte, rührt, so scheint es, an die Gültigkeit eines wissenschaftlichen Paradigmas. Es scheint, als hänge von der Glaubwürdigkeit Broszats in dieser Frage nicht nur die Richtigkeit seiner Überzeugungen von der «Historisierung» des Nationalsozialismus ab, sondern auch die Wahrheit des «funktionalistischen» Ansatzes.
Aber kann die fachliche Erklärungskraft des funktionalistischen Ansatzes wirklich von der persönlichen Glaubwürdigkeit eines seiner Urheber abhängen? Doch nur dann, wenn man diesem Programm - ganz entgegen dem erklärten Verständnis seiner Verfechter - eine moralische Dimension zuerkennt, die es, als wissenschaftlich distanziertes, gar nicht haben soll. Die Annahme allerdings, man könne sich dem Nationalsozialismus wissenschaftlich wertfrei nähern, ist methodologisch nicht über jeden Zweifel erhaben. Auch im Funktionalismus liess sich ja ursprünglich ein moralischer Impuls wahrnehmen: Das Paradigma verdankte sich schliesslich der Einsicht, dass die millionenfachen Mordtaten zwar vom Diktator angeordnet waren, aber der freiwilligen Mitarbeit von Hunderttausenden von Tätern und Mitläufern bedurften. Formeln wie die von der «Selbstradikalisierung» der Geschehnisse verdeckten später diesen moralischen Impuls.
Mit dem kürzlich entbrannten Streit um das Verhalten Broszats wird jene These bestätigt, um die es Nicolas Berg in seiner bedeutenden Studie geht: dass es nämlich - und dies ist ein soziales Faktum - mindestens zwei Erinnerungen an den Holocaust gibt, die der Opfer und die des «Täterkollektivs», das keineswegs mit den einzelnen Tätern identisch ist. Man mag dieses Faktum bedauern und versuchen, ihm mit einem Appell an vermeintliche methodologische Selbstverständlichkeiten wie der Forderung nach «Distanz» auszuweichen oder jene, die dieser Forderung angeblich nicht genügen, auszugrenzen. Dadurch verschwindet das Faktum zweier Erinnerungen dennoch nicht. Eine über sich selbst aufgeklärte Geschichtswissenschaft wird nicht bei positivistischer Ereignis- und Prozessgeschichte stehen bleiben, sondern die stets begleitende «Gedächtnisgeschichte» in ihre Methodologie aufnehmen und reflexiv verfahren. Die Heftigkeit der deutschen Debatte zeigt freilich, dass es für eine Historisierung der NS-Geschichtsschreibung in diesem Sinn offensichtlich noch zu früh ist - man könnte auch sagen, dass die Zeitgeschichte in eigener Sache noch zu leidenschaftlich verfährt.
Micha Brumlik
Der Verfasser ist Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, eines in Frankfurt am Main ansässigen Studien- und Dokumentationszentrums zur Geschichte und Wirkung des Holocaust.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Dokument erstellt am 04.09.2003 um 17:16:02 Uhr
Erscheinungsdatum 05.09.2003
Zwischen Erinnerung und Erforschung
Positionen westdeutscher Historiker aus gut fünf Jahrzehnten: Nicolas Berg schreibt eine Gedächtnisgeschichte des Holocaust
Von Christian Geulen
Nicolas Berg: Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Wallstein Verlag, Göttingen 2003, 768 Seiten, 46 €.
Die Historisierung der alten Bundesrepublik hat begonnen. Debatten wie der
Historikerstreit von 1986, die noch vor zehn Jahren paradigmatische Fronten
bereitstellten, auf deren eine oder andere Seite man sich zu stellen hatte,
werden heute selber als ein historischer Gegenstand untersucht. Nicht, wer
damals Recht hatte, als vielmehr die Frage, was der Streit über die
erinnerungspolitische Mentalität der 1980er Jahre und der beteiligten
Historikergenerationen aussagt, erscheint heute relevant. Nicht zuletzt die
jüngste Debatte über die Mitarbeit später prominenter Historiker an der
Bevölkerungspolitik des "Dritten Reichs" hat gezeigt, dass die westdeutsche
Geschichtswissenschaft, mindestens bis in die 1980er Jahre hinein, langsam, aber
sicher selbst Geschichte wird.
Doch so vielfältig die Anzeichen für und konkreten Bemühungen um eine solche
Historisierung auch sind, sie scheinen es bei näherem Hinsehen schwer zu haben,
selbst von den Positionen loszukommen, die sie zu untersuchen vorgeben. Allzu
häufig opfern sie die notwendig rückblickende und historisierende Perspektive
doch wieder der nachträglichen Selbstpositionierung innerhalb der
Debattenlandschaft, die sie skizzieren. So litt jene Auseinandersetzung um die
Rolle deutscher Historiker im Nationalsozialismus an einer moralisierenden und
personalisierenden Diskussionsweise, die mit Anschuldigungen und
Entschuldigungen jonglierte, den Blick auf strukturelle Kontinuitäten oder
Brüche im historischen Denken zwischen Weimarer und Bundesrepublik aber von
Anfang an verstellte. Wir scheinen uns in einer Art Zwischenzeit zu befinden, in
der neue Perspektiven auf die westdeutsche Geschichtswissenschaft möglich,
praktisch aber ihre alten Debatten fortgeführt werden.
Dieses Problem kehrt auch im jüngsten und wohl umfassendsten Versuch wieder, die
Geschichte der bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft anhand ihrer
verschiedenen Positionen zum Holocaust zu untersuchen. Nicolas Berg hat auf rund
800 Seiten eine systematische Rekonstruktion der westdeutschen
Holocaustforschung vorgelegt, die keineswegs nur eine wissenschafts-, sondern
ebenso eine erinnerungsgeschichtliche Analyse sein will. Sie ist die erste
Gesamtdarstellung dieses Themas überhaupt und zugleich so umfassend und
sorgfältig recherchiert, dass sie sicher für eine ganze Weile ein Standardwerk
in diesem Bereich sein wird.
Betroffenheit hinüberretten
Von den frühen Bildern und Darstellungen des "Dritten Reichs" als Tragödie und
hereingebrochener Katastrophe bei Friedrich Meinecke oder Gerhard Ritter über
die hochinteressante Darstellung der Entstehungsgeschichte des Münchener
Instituts für Zeitgeschichte oder die so wenig bekannte wie berührende
Geschichte des nie wirklich anerkannten Holocaustforschers und
Auschwitzüberlebenden Joseph Wulf bis zur Debatte über die Möglichkeiten, den
Nationalsozialismus strukturalistisch zu deuten, bespricht Berg alle wichtigen
Positionen und Auseinandersetzungen der letzten fünf bis sechs Jahrzehnte.
Seine Sympathie liegt dabei eindeutig bei jenen, die, aus intellektueller
Überzeugung oder eigener Erfahrung, auf der Notwendigkeit bestehen, auch die
emotionale und erinnerungstheoretische Dimension in die historische Aufarbeitung
des Holocausts mit einzubeziehen, wie es seit langem schon Saul Friedländer etwa
vertritt. Dagegen geht Berg besonders hart mit jenen ins Gericht, die, ebenfalls
aus intellektueller Überzeugung oder eigener Erfahrung, ein höheres Maß an
Sachlichkeit und analytischen Herangehensweisen gefordert haben, wie etwa der
langjährige Leiter des Münchener Instituts, Martin Broszat.
Bergs Ablehnung von Positionen, die seiner Meinung nach das Moment der
Erinnerung zu wenig beachten, geht so weit, dass er sogar Hannah Arendt, die wie
nur wenige andere über die übergreifende historische Bedeutung des Holocausts
nachgedacht hat, den Vorwurf macht, zu analytisch und zu wenig
gedächtnisorientiert zu argumentieren, den "Anteil der Täter" an dem Bild, das
man sich später von ihnen machen sollte, zu unterschätzen. Dieses Argument
taucht mehrfach auf. Allein Ansätze, die sich nicht nur der Erforschung, sondern
vor allem der Erinnerung des Holocausts widmen, mithin die eigene Affiziertheit
vom Gegenstand systematisch mitreflektieren, erscheinen legitim, während jede
bewusste oder unbewusste Abweichung von dieser Betroffenheit in Bergs Sichtweise
auf den falschen Weg führt.
Für einen Historiker, dessen eigene Generation von den Geschehnissen der 1930er
und 1940er Jahre nur mittelbar betroffen sein kann, ist dies eine bemerkenswerte
Position. Sie scheint auf dem Wege der Erinnerungsgeschichte die Erinnerung
selbst in jene anstehende Epoche hinüberretten zu wollen, in der es keine
persönliche Erinnerung an das Geschehen mehr geben wird. Vielleicht ist dies ja
tatsächlich die eigentliche Aufgabe einer Gedächtnisgeschichte des Holocausts
und der einzige Weg, auch der zukünftigen Forschung jenes Moment der direkten
Betroffenheit und Berührtheit durch das Ereignis selbst zu erhalten.
Doch er hat seinen Preis. Zu Gunsten einer Erinnerungs- und Gedächtnisgeschichte
des Holocausts vernachlässigt er seine Geschichte, seine Vorgeschichte (nach der
zu fragen vor dem Hintergrund des gegenwärtig hegemonialen Themas der Erinnerung
schon fast antiquiert erscheint) ebenso wie seine Nachgeschichte: und zwar
diejenige jenseits von Erforschung, Erinnerung, Gedächtnis und Gedenken. Oder
hat der Holocaust außerhalb seiner Erinnerung keine Nachgeschichte? Ist nichts
von dem, was ihn ermöglichte, heute mehr virulent? Ist allein die Frage wichtig,
wie wir ihn erinnern? Das wäre wohl nur eine andere Version jener Tendenz, die
Berg zu Recht einem einseitigen Strukturalismus vorwirft: in einer allein auf
Sachlichkeit (oder eben auf Erinnerung) gerichteten Forschung die historischen
Langzeitwirkungen des Holocausts zu vernachlässigen.
So wenig Berg laut seiner Einleitung auf theoretischer Ebene auch zustimmen
würde, in den bewertenden Passagen lebt sein Buch davon, Erinnerung und
Erforschung als Alternativen gegeneinander auszuspielen. Und das in genau dem
Maße, in dem er seine Rekonstruktion der westdeutschen Holocaustforschung als
eine Kette von Positionen darstellt, die ihn zwingt, selbst Position zu
beziehen, in der einen oder anderen Weise anzugeben, wer die besseren Argumente,
wer im Grunde Recht und wer Unrecht hatte.
Politische Kursschwankungen
Eine Alternative zu dieser nachträglichen Bewertung und Selbstpositionierung
anhand der immer wieder neu vollzogenen Abwägung von Erinnerung und Erforschung
hätte darin bestanden, die Erinnerung zu erforschen, mithin zu rekonstruieren,
was sich jenseits der Intentionen und Motive der einzelnen Autoren in den
Debatten an diskursiven Strukturen, wiederkehrenden Denkfiguren und politischen
Ideologemen entwickelte und tradierte. Was waren die eigentlichen Gründe dafür,
dass die Holocaustforschung und -erinnerung nach 1989/90 einen so umfassenden
Aufschwung erfuhr? Welche Beziehung bestand zwischen den Holocaustdebatten der
1960er Jahre und der von Studentenbewegung und Linksschwenk geprägten
politischen Kultur der Bundesrepublik?
Warum nahm man die Arbeiten Joseph Wulfs so lange nicht wirklich ernst, und
wieso spielte das Werk Hannah Arendts ab den späten 1960er Jahren kaum noch eine
Rolle? Aus welchen (nicht nur persönlichen) Quellen speiste sich das
Sachlichkeitsbestreben eines Martin Broszat, und was waren die tieferen Ursachen
für das in Deutschland in der Tat lange Übergewicht der Täterforschung?
Gegenüber solchen Fragen schließt sich der von Berg gewählte Zugang über die
Paradigmen Erinnerung und Erforschung hermetisch ab. Wenn Erfahrung ins Spiel
kommt, dann allein die Erfahrungen, die die behandelten Autoren im "Dritten
Reich" gemacht haben, nicht aber der erfahrungsgeschichtliche Kontext, in dem
ihre Forschungen und Erinnerungen entstanden. Dabei wird in fast jeder der von
Berg zitierten Passagen deutlich, in welchem Maße die behandelten Texte immer
auch einen politischen Selbstverständigungsdiskurs markierten, in welchem Maße
Erforschung und Erinnerung des Holocausts Referenz und Medium politischer
Identitätsbildung waren und sind.
Zu Gunsten einer immer begründeten, aber immer auch bekennenden Bewertung lässt
Berg diese Dimension jedoch fast ganz außen vor. Trotz der einleitenden
Ankündigung einer Gedächtnisgeschichte ist das Buch vom Aufbau und Stil her eine
beurteilende Gesamtdarstellung, eine Art voluminöse Sammelbesprechung der
westdeutschen Holocaustliteratur seit 1945. Und damit stellt es durchaus eine
wichtige Grundlage bereit, die zukünftige Analysen der Geschichte des
westdeutschen Holocaustdiskurses nutzen können.
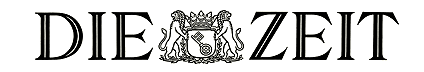
Holocaust
Forschung ohne Erinnerung
Nicolas Bergs Buch über den Holocaust und die deutschen Historiker sorgt für Streit
Nicolas Berg: Der Holocaust und die westdeutschen Historiker
Erforschung und Erinnerung; Wallstein Verlag, Göttingen 2003; 766 S., 46,–
In seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag im September 1949 beklagte Bundespräsident Theodor Heuss, dass „manche Leute in Deutschland“ die Untaten des „Dritten Reichs“ „zu rasch vergessen“ wollten. Heute, 50 Jahre später, wird eher vor einem Übermaß an Erinnerung gewarnt. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und seinen Massenverbrechen hat immer zwischen diesen beiden Polen – der Sorge vor dem „Zuwenig“ und dem Lamento über ein „Zuviel“ – geschwankt.
Nun hat der junge Leipziger Kulturhistoriker Nicolas Berg dieses Spannungsverhältnis zum Thema einer groß angelegten Untersuchung gemacht, die in der historischen Zunft für Aufregung sorgt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Historiker nach 1945 mit dem Holocaust umgegangen sind und welche Wege die Forschungen in den Jahrzehnten bis zur Wiedervereinigung 1990 genommen haben. Berg hantiert etwas sorglos mit dem modischen Vokabular der Diskursgeschichte, hat darüber aber das solide Quellenstudium nicht vernachlässigt. Die Arbeit stützt sich nicht nur auf veröffentlichte Schriften, sondern vor allem auf Korrespondenzen aus den Nachlässen führender Historiker.
Protestantische Bußfertigkeit
Der Autor weist nach, dass in den ersten Wortmeldungen aus der deutschen Historikerschaft nach Kriegsende vom Judenmord allenfalls am Rande die Rede war. Man betonte vielmehr die eigene Opferrolle. Friedrich Meinecke bezeichnete in seinem Schlüsselwerk Die deutsche Katastrophe (1946) das „Dritte Reich“ als ein „Zeitalter innerer Fremdherrschaft“, in dem es einem „Verbrecherclub“ gelungen sei, das deutsche Volk „zwölf Jahre hindurch in seine Gefolgschaft zu zwingen“. Für Gerhard Ritter, den einflussreichen Freiburger Historiker, war der Nationalsozialismus etwas „Undeutsches“, „eine satanische Verfälschung echter deutscher Tradition“. Und selbst Hans Rothfels, der wegen seiner jüdischen Herkunft hatte emigrieren müssen, vertrat in seinem Buch Die deutsche Opposition gegen Hitler (1948) die Ansicht, „daß Deutschland nach 1933 ein‚ besetztes Land‘ war“. In der Zunft fand dieses Buch eine begeisterte Aufnahme, entsprach es doch, wie Berg hervorhebt, dem Bedürfnis nach einer „Gegenerzählung zum Nationalsozialismus“.
Die fünfziger Jahre gelten gemeinhin als eine Zeit der Verdrängung und der Restauration. Was die deutsche Geschichtswissenschaft angeht, versucht Nicolas Berg diese Vorstellung zu korrigieren. Er erkennt bereits im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik das Bemühen, das Schweigen zu überwinden und die Judenvernichtung ins öffentliche Gedächtnis zu rücken. Freilich zeigt er am Beispiel der Göttinger Historiker Hermann Heimpel und Reinhard Wittram, wie unzulänglich diese Versuche blieben. Beide übten sich in „protestantischer Bußfertigkeit“, ihr Nachdenken über die eigene schuldhafte „Verstrickung“ trug Züge eines bekennerhaften Rituals, wobei an die Stelle einer konkreten Analyse der Täter und ihrer Taten das Räsonieren über das schlechthin „Böse“ in der menschlichen Natur trat.
Dagegen machte eine junge Generation von Forschern Front, die sich in den fünfziger Jahren am neu gegründeten Münchner Institut für Zeitgeschichte versammelte. „Vergangenheitsbewältigung“ – ein Begriff, der damals aufkam – war unter diesen Historikern verpönt. Statt folgenloser Schuld- und Schambekenntnisse wollten sie nüchterne Quellenforschung betreiben und über die tatsächlichen Verbrechen aufklären. Nicolas Berg hat die Frühgeschichte des Instituts noch einmal gründlich durchleuchtet, und das Resultat ist weniger glanzvoll, als es in der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum aus dem Jahre 1999 erscheint. Zwar würdigt er die Leistungen, etwa die Edition der Memoiren von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß (1958), die der Täterforschung wichtige Anstöße gab, oder das zweibändige Gutachten zum Frankfurter Auschwitz-Prozess Anatomie des SS-Staates (1965), das, wie der Autor sagt, bis dahin „beste Buch über die Massenverbrechen des Nationalsozialismus“. Doch zugleich kritisiert er, dass über die intensive Beschäftigung mit den Tätern die Perspektive der Opfer zu sehr vernachlässigt worden sei. Vor allem habe das Institut auf die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden nicht angemessen reagiert.
Dieser Vorwurf richtet sich in erster Linie gegen Martin Broszat, von 1972 bis zu seinem Tode 1989 Direktor des Instituts. Vor einem Jahr schon hat Nicolas Berg in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung (17. Juli 2002) enthüllt, dass Broszat noch spät, am 20. April 1944, Mitglied der NSDAP geworden war, über die Tatsache aber geschwiegen habe. Daraus zieht der Autor nun den Schluss, dass der Münchner Historiker auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nicht frei gewesen sei von einer „unausgesprochenen Entlastungssehnsucht“. Das Pathos der Nüchternheit, das er für sich reklamierte, erscheine, so gesehen, fragwürdig. Mehr noch: Berg glaubt hier eine Erklärung dafür gefunden zu haben, dass Broszat in der Auseinandersetzung mit dem jüdischen Publizisten Joseph Wulf ein besonders unduldsames Verhalten an den Tag gelegt habe.
Bestechend scharfe Urteile
Über diese Kritik an einer der wenigen Lichtgestalten unter den deutschen Zeithistorikern wird gewiss noch heftig gestritten werden. Denn wenn es tatsächlich so war, dass an Hitlers Geburtstag 1944 ganze HJ-Jahrgänge in die NSDAP überführt wurden, ist nicht auszuschließen, dass Broszat von seiner Parteimitgliedschaft gar nichts gewusst hat.
Dennoch ist es ein großes Verdienst dieser umfänglichen Untersuchung, dass sie den fast vergessenen Autodidakten und ehemaligen Auschwitz-Häftling Josef Wulf in Erinnerung ruft und seinem Werk endlich Gerechtigkeit widerfahren lässt. Wulf veröffentlichte zwischen 1955 und 1960 (gemeinsam mit Léon Poliakov) vier Dokumentationen (Das Dritte Reich und die Juden; Das Dritte Reich und seine Diener; Das Dritte Reich und seine Denker; Das Dritte Reich und seine Vollstrecker), die den Mord an den Juden in den Mittelpunkt rückten und das Verhalten der Deutschen eingehend beleuchteten. Mit der vorweggenommenen Goldhagen-These, dass Hitler viele willige Helfer gefunden habe, widersprach er der vorherrschenden Meinung in der akademischen Zunft. Auch Broszat lehnte die Arbeiten Wulfs als zu polemisch und „unwissenschaftlich“ ab. Er vertrat die Auffassung, dass das Thema der Judenvernichtung nicht Holocaust-Überlebenden überlassen werden dürfe, weil sie nicht „objektiv“ urteilen könnten.
Angesichts des Widerstands, auf den seine Forschungen stießen, begann Wulf zu resignieren. „Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht, und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst Dich bei den Deutschen totdokumentieren, es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein – und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen“, klagte er im August 1974 einem Freund. Wenige Wochen später, am 10. Oktober 1974, stürzte er sich aus dem 4. Stock seiner Berliner Wohnung in den Tod.
Nicolas Berg ist ein nicht ganz untypischer Vertreter der Enkelgeneration unter den Historikern. Er schreibt nicht sine ira et studio, sondern mit Zorn und Leidenschaft. Seine Urteile sind von bestechender, manchmal auch verletzender Schärfe. So wirft er den 68ern vor, mit ihrem inflationären Faschismus-Begriff einer „zweiten Verdrängung“ Vorschub geleistet zu haben. Hart ins Gericht geht er auch mit Hans Mommsen, dem Wortführer der „funktionalistischen“ Schule, die ihre Blütezeit Anfang der achtziger Jahre erlebte, deren Ursprünge Berg indes in die fünfziger Jahre verlegt. Er verkennt dabei, dass der Versuch, die Radikalisierung der antijüdischen Politik aus den Strukturen und Funktionsbedingungen der NS-Herrschaft abzuleiten, gegenüber jenen Hitler-zentrierten Deutungen, die hinter allen Entscheidungen den dämonischen Willen des „Führers“ vermuteten, einen beachtlichen Fortschritt darstellte. Die Entwicklung der Historiografie zum Holocaust lässt sich eben nicht als reine Defizitgeschichte schreiben.
Insgesamt freilich, darin muss man dem Autor beipflichten, ist die Beschäftigung mit dem schwierigen Thema kein Ruhmesblatt der deutschen Zeitgeschichtsschreibung. Dieses wichtige Buch zeigt, welch langer Weg zurückgelegt werden musste, bevor das monströse Verbrechen in seiner ganzen Dimension erkannt und erforscht werden konnte – wie schwer es professionellen Historikern aber bis heute fällt, über Zeitgebundenheit und lebensgeschichtliche Hintergründe ihrer Erkenntnisinteressen nachzudenken.
DIE WOCHENZEITUNG
Nicolas Berg:
Der Holocaust und
die westdeutschen Historiker, Erforschung und Erinnerung
Rezensiert von Shelley Berlowitz
aus WoZ Nr. 39 vom 25. September 2003
Nicolas Berg zeigt in seinem Buch, wie die westdeutsche Historikerzunft das
Gedächtnis der jüdischen Opfer abwertete und ausblendete.
1987 stritten sich der hoch angesehene deutsche Zeitgeschichtler Martin
Broszat und der jüdische Historiker Saul Friedländer über die Geschichte des
Nationalsozialismus. Broszat, von 1972 bis zu seinem Tod 1989 Direktor des
Münchner Instituts für Zeitgeschichte, unterschied dabei zwischen so
genannter «mythischer Erinnerung» einerseits und «wissenschaftlicher
Geschichtsschreibung» andererseits.
Mythische Erinnerung resultiere aus einer schmerzhaften und problematischen
Beziehung zur Vergangenheit. Die «auf mehr rationales Begreifen ausgehenden»
jüngeren deutschen Historiker hätten es oft «mit einer solchen
geschichtsvergröbernden Erinnerung unter den Geschädigten und Verfolgten des
NS-Regimes und ihren Nachkommen» zu tun – also mit dem Gedächtnis jüdischer
Menschen. Broszat war überzeugt, dass gerade die Erfahrungen, die er als
Jugendlicher unter dem Nationalsozialismus gemacht habe, ihn für einen
sachlichen Umgang mit der Geschichte gerüstet hätten. Friedländer hingegen
wies diese Gegenüberstellung von mythischer jüdischer Erinnerung und
wissenschaftlicher deutscher Forschung scharf von sich. Er anerkannte die
Bedeutung der Multiperspektivität auch innerhalb der Geschichtswissenschaft.
Kommunikatives Schweigen
In dieser Auseinandersetzung wird die angeblich rein wissenschaftliche,
sachliche, objektive und historisierende Perspektive als spezifisch deutsche
Perspektive sichtbar. Der Historiker Nicolas Berg hat deren Geschichte in
seinem gut lesbaren Buch «Der Holocaust und die westdeutschen Historiker»
eindrücklich freigelegt. Er unterstellt dabei den bundesrepublikanischen
HistorikerInnen nicht einfach eine ideologische Haltung; vielmehr untersucht
er ihre Erinnerungsperspektive und bettet sie in biografische und
generationelle Kontexte ein.
In den vierziger und fünfziger Jahren wurde die Verfolgung der Jüdinnen und
Juden und die NS-Vernichtungspolitik in der westdeutschen Forschung
überhaupt nicht oder nur am Rande behandelt. Deutsche HistorikerInnen, so
wird bei Berg deutlich, bezeichneten damals den Nationalsozialismus und die
NS-Vernichtungspolitik als «deutsche Katastrophe» (Friedrich Meinecke), als
«Betriebsunfall der Geschichte» (Gerhard Ritter) – oder übten sich in
konsequentem «kommunikativem Beschweigen» der Verbrechen. Zwar gab es auch
Historiker, die weder schwiegen noch die NS-Zeit ausklammerten. Bei ihnen
konstatiert Berg weniger eine Verweigerung als vielmehr eine Überforderung
von Erinnerung. Sie demonstrierten «protestantische Bussfertigkeit» und
betonten zwar die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, liessen jedoch historiografisch keinerlei Fortschritt in der
Erforschung dieser Vergangenheit zu. Werke von jüdischen oder ausländischen
HistorikerInnen wurden entweder negativ rezipiert oder nicht einmal
übersetzt. So lehnte die deutsche Fachwelt die von Joseph Wulf und Léon
Poliakov in den fünfziger Jahren vorgelegten Quelleneditionen zum «Dritten
Reich» als unwissenschaftlich ab, und Raoul Hilbergs 1961 verfasstes
Standardwerk «Die Vernichtung der europäischen Juden» erschien erst zwanzig
Jahre später in deutscher Übersetzung. Die «Geschichte der Geschichte» in
der Bundesrepublik kann also auch als Ausschluss nichtdeutscher Forschung
gelesen werden.
Die aufsehenerregendste These des Buches ist jene über die «Geburt des
Strukturalismus aus dem Geist der Apologie». Berg beschreibt, in welchem
Kontext gesellschaftsgeschichtlich-strukturalistische Ideen entstanden und
welches kollektive oder individuelle Gedächtnis in ihnen mittransportiert
wird. Bereits 1952, in der Frühphase des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ),
wurden die Weichen für ein Forschungsprogramm gestellt, das Anonymität und
Automatismus im Ablauf der Verbrechen betonte. Dabei entdeckte man die
Zeitzeugen als Quelle – allerdings nicht die Opfer der Nazis, sondern
deutsche Beamte, Mitwisser, Mitläufer oder Täter, die Einsicht in die
Verbrechen gehabt hatten und nun vom IfZ als natürliche Bündnispartner in
der Aufklärung des Nationalsozialismus gesehen wurden.
Das strukturalistische Erklärungsmodell, das in den späten sechziger und
frühen siebziger Jahren vor allem von Hans Mommsen und Martin Broszat
ausformuliert und als vorherrschende geschichtsphilosophische Position
etabliert wurde, setzte sich vom früheren intentionalistischen Ansatz ab.
War dieser von den Absichten und einem vorsätzlichen Programm der Akteure
ausgegangen und hatte etwas naiv eine Schuldzuweisung an einzelne Personen
vorgenommen («Hitler und seine Schergen») und damit alle anderen aus der
Schuld entlassen, so stellte das neue Modell die komplexen Strukturen und
situativen Bedingungen in den Vordergrund, die zu den NS-Verbrechen geführt
hätten. Der neue Blick entdeckte den komplexen «Mechanismus», den «Apparat»,
die «Vernichtungsmaschinerie»; weil alle in die Struktur «verstrickt» waren,
vermochten sie nicht den ganzen Prozess zu überblicken, was erst den
reibungslosen Ablauf der Mordaktionen ermöglicht habe. Die
strukturalistische Forschung galt ihren Protagonisten als wissenschaftlich
fundierter und sachlicher als das ältere intentionalistische
Erklärungsmodell. Strukturalismus, so das Selbstverständnis, sei objektive
Geschichtsschreibung und habe keine dem Gedächtnis geschuldeten
perspektivischen Anteile.
Berg bestreitet nicht, dass die strukturfunktionalistische Forschung eine
enorme Erweiterung und Vertiefung unserer Kenntnisse über das Dritte Reich
und die Vernichtungspolitik gebracht hat; der neue Ansatz erlaubte
zweifelsohne eine differenzierte Sicht auf die Gesellschaft des Dritten
Reiches. Aber er weist darauf hin, dass dieser Ansatz – im Gegensatz zum
Selbstverständnis der HistorikerInnen – auch einen Aspekt von Erinnerung und
Gedächtnis enthält. Die westdeutsche Fachgeschichte übernahm nämlich in
vielen Fällen die «Erinnerungsversionen ehemaliger Funktionsträger des
NS-Staates», die allesamt sich erinnerten, nur ein hilfloses Rädchen in
einem grossen Apparat gewesen zu sein, der quasi von alleine lief und zu
Verbrechen führte, die niemand der Beteiligten wirklich gewollt habe.
Gelobter Ghettoarzt
Als exemplarisch für den Ausschluss des Gedächtnisses der Opfer (und an
die Opfer) gilt Berg eine Kontroverse zwischen dem jüdischen Historiker
Joseph Wulf und dem IfZ. In seiner 1961 publizierten Quellenedition über die
«Liquidation» des Warschauer Ghettos bezeichnete Wulf den ehemaligen Leiter
der Warschauer NS-Gesundheitsbehörde, Wilhelm Hagen, als «Helfershelfer».
Als Amtsarzt war Hagen mitverantwortlich gewesen für die Hygienebedingungen,
die medizinische Versorgung und die Essensrationen im Warschauer Ghetto, die
den Tod von hunderttausenden Menschen zur Folge hatten. Der ehemalige
NS-Arzt wandte sich darauf Hilfe suchend an den IfZ-Mitarbeiter Martin
Broszat, der ihm volle Rückendeckung gab und ihm eine «integre Haltung
während der NS-Zeit als Amtsarzt in Warschau» attestierte. Wulfs Darstellung
kanzelte er als «Verzerrung» und «grobflächige und zusammenhanglose
Dokumentation» ab. Wulf konnte sich in der mehrjährigen, erbittert geführten
Kontroverse, die vor Gericht endete, nicht durchsetzen. Der Name Wilhelm
Hagens musste aus allen nicht verkauften Büchern getilgt werden. Im Namen
der wissenschaftlichen Objektivität stellte Martin Broszat den Ghettoarzt,
der 1941 vorgeschlagen hatte, «vagabundierende Juden» als Massnahme zur
Seuchenbekämpfung zu erschiessen, als Ehrenmann dar. Joseph Wulf aber führte
dieser Fall in die völlige Isolierung und Resignation; 1974 brachte er sich
um. Zuvor hatte er KZ und einen «Todesmarsch» überlebt.
Nicolas Berg weist nach, dass Sachlichkeit und Emotionalität, objektive
Erforschung und subjektive Erinnerung im vorherrschenden historiografischen
Diskurs Westdeutschlands seit der Nachkriegszeit und bis in die späten
achtziger Jahre als Gegenpole konzipiert und dann unterschiedlichen
kollektiven Gedächtnissen zugeordnet wurden: die Objektivität dem deutschen,
die Subjektivität dem der Opfer. Diese Gegenüberstellung selbst als Teil des
Problems historisiert zu haben, ohne seinerseits die gesamte ältere deutsche
NS-Forschung als inhaltlich wertlos abzutun, ist Bergs grosses Verdienst. Er
leuchtet den toten Winkel der deutschen Zeitgeschichtsforschung aus und
zeigt auf, wo und wie die subkutanen Verbindungslinien zum kollektiven
Gedächtnis der Tätergesellschaft wirkten, trotz oder parallel zur
Distanzierung vom Nationalsozialismus.
DasPARLAMENT
Nicolas Berg
Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung.
Wallstein Verlag, Göttingen 2003, 768 S., 46,- Euro
Wolfgang Benz
Abrechnung
mit der Historikerzunft / Von Wolfgang Benz
Das Buch ist mit Spannung erwartet worden. Es ist eine Abrechnung mit der Historikergeneration, die nach 1945 mit der Erforschung des Nationalsozialismus begann und das Fach Zeitgeschichte um den Nukleus des Münchner Instituts etablierte. Die Methode des Autors, die handelnden Figuren in Lichtgestalten und Märtyrer auf der einen, in Finsterlinge und Interessengesteuerte einzuteilen, ist effektvoll, aber letztendlich der Wahrheitsfindung nicht unmittelbar dienlich. Dass ausgerechnet Hans Mommsen, dessen scharfsinnige und quellensatte Überlegungen zum Funktionieren und zur Radikalisierung nationalsozialistischer Herrschaft die Geschichtswissenschaft entscheidend vorangebracht haben, als erinnerungsfeindlicher Unhold vorgeführt wird, ist grotesk.
Der andere Dunkelmann ist Martin Broszat, seit den frühen 50er-Jahren Mitarbeiter und von 1972 - 1989 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Dass er 1944 noch NSDAP-Mitglied geworden ist, wäre unerheblich, wenn er nicht darüber geschwiegen hätte. Die Parteimitgliedschaft machte den jungen Mann aber auch nicht zwangsläufig zum Täter. Sein Vorgänger, Helmut Krausnick, auch er eine wichtige Figur in Bergs Buch, hat kein Hehl aus seiner einstigen Eigenschaft als PG gemacht, und das war besser so.
Für ehemalige Mitarbeiter Broszats war die Enthüllung ein persönlicher Schock, aber seine wissenschaftlichen Anstrengungen zur Erforschung des Dritten Reiches haben deshalb nicht weniger Bestand. "Der Staat Hitlers" und Broszats Arbeiten zur Geschichte der Konzentrationslager bleiben Pionierleistungen. Das ist die eine Seite. Dass der Historiker Broszat in Unkenntnis über seine NSDAP-Mitgliedschaft gelebt haben soll, erscheint freilich mehr als unwahrscheinlich. Aber war das trübselige Faktum handlungsleitend für den Historiker Broszat, wie Bergs Darstellung nahe legt?
Exemplifiziert wird die These, das junge Fach Zeitgeschichte sei erinnerungsfeindlich gewesen, am Konflikt des Publizisten Joseph Wulf, des Holocaustüberlebenden, mit den Historikern des Münchner Instituts, insbesondere mit dem Protagonisten Broszat.
Berg fördert Erstaunliches und Unrühmlichen aus den Akten hervor, und der Vorwurf unsensiblen Umgangs mit jüdischen Überlebenden, die sich wie H. G. Adler und Joseph Wulf um wissenschaftlichen Umgang mit der kollektiven Erfahrung des Holocaust bemühten - damit mit der Zunft der Fachhistoriker konkurrierend - ist sehr berechtigt. Aber auch hier verwendet der Autor nur Schwarz und Weiß. Dass das Verhältnis zwischen beflissenen und professionellen Geschichtsforschern - die einen von bitterer eigener Erfahrung angetrieben, die anderen im Besitz des besseren methodischen Rüstzeugs und darob arrogant gegenüber den Liebhabern ihrer Kunst - an sich schwierig ist, wäre aller Reflexion wert. Dass Auftragsarbeiten, wie Adler sie vom Institut für Zeitgeschichte übernahm, nicht nur durch einseitige Schuld scheiterten, wäre ebenfalls genauer zu betrachten. Auch die Rolle Joseph Wulfs erscheint in wenigstens einem Punkt korrekturbedürftig:
Als Publizist war er, vielleicht auch im Gegensatz zu eigener Empfindung, nicht erfolglos. Seine Dokumentationen sind auflagenstarke Standardwerke bis zum heutigen Tag, sie werden von vielen immer noch als unentbehrliche Hilfen geschätzt. Ruhm zu erwerben ist freilich mit derlei Kärrnerarbeit nicht, das ist das eine. Dass auf schnöde Weise die erhoffte Anerkennung für die schätzenswerte Leistung verweigert wurde, ist ein anderes.
Das Buch Nicolas Bergs vermittelt eine Fülle wichtiger Einsichten und Erkenntnisse über bundesrepublikanische Geschichtswissenschaft. Der konzeptionelle Ansatz, nämlich die Rückverlängerung des Erinnerungsdiskurses der 90er-Jahre auf die Anfänge der wissenschaftlichen Behandlung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen erscheint allerdings fragwürdig. Damit werden nämlich Intentionen konstruiert und Folgerichtigkeiten konstatiert, die es so nicht gab. Dass die junge Zeitgeschichte positivistisch agierte, muss ihr nicht als Schuld vorgehalten werden ("quellenfetischistische Fachwissenschaft", Seite 338). Für die Durchsetzung der Disziplin in der akademischen Nachkriegslandschaft war der Münchner Positivismus existentiell wichtig und notwendig.
Bei der Kategorisierung der Protagonisten wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Wenn Martin Broszat in der Einleitung zur Edition der Aufzeichnungen von Rudolf Höß das Triviale, Alltägliche, Kleinbürgerliche des Auschwitz-Kommandanten vorführt, zeichnet er das Bild des Apparatschiks, der innerhalb des Rasters Pflicht-Gehorsam-Befehl-Funktion operiert und im totalen Staat beliebig einsetzbar ist. Berg macht Broszat aber zum Vorwurf, dass an dieser Stelle von antisemitischer Ideologie und vom Hass auf Juden keine Rede ist. Joseph Wulf aber wird gelobt, wenn er die Alltäglichkeit der Diener und Vollstrecker des Dritten Reiches dokumentiert.
Das Buch ist erkennbar mit Leidenschaft geschrieben. Das Bestreben, der These Erinnerung versus Forschung zum Sieg zu verhelfen, scheint schon bei der Quellenrecherche wirksam gewesen zu sein. Der Eindruck entsteht, wenn etwa der einstige Mitarbeiter des Münchner Instituts, Hans-Dieter Loock, so oft in den Zeugenstand gerufen wird, andere, von denen ebenfalls verwertbare Texte vorliegen, aber gar nicht.
Warum wird der Eindruck erweckt (Seite 286), das Projekt zur Ermittlung der Opferzahlen des Holocaust sei in statu nascendi gescheitert? Es ist, viele Jahre später, auf Betreiben Martin Broszats realisiert worden. Es stimmt auch nicht, dass der "Generalplan Ost", dieses entlarvende Dokument deutscher Umsiedlungspolitik, zwischen Joseph Wulf 1967 und Götz Alys Studie jahrzehntelang niemals behandelt worden wäre. Ein Blick in die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte lehrt dieses und mehr.
Die Darstellung, monumental im Anspruch, glänzend geschrieben, in der Anlage weniger konzis als materialreich, endet auf Seite 661 etwas jäh. Insgesamt hätte dem Text ein gründliches Lektorat nicht geschadet. Zusammen mit dem Autor hätten dann wohl auch die vielen Schlampereien vermieden werden können, die bei einem so aufwendigen und wichtigen Unternehmen stören. Nur einige Beispiele: Aus Nornen wurden Normen (Seite 348), Literatur erscheint in den Fußnoten oft anders als im Verzeichnis, Himmlers Statistiker heißt bei Nicolas Berg Koherr statt Korherr, der SS-General in Warschau erscheint auf der gleichen Seite einmal mit dem Namen Stoop und einmal richtig als Stroop, dafür wird der Name des israelischen Historikers Zwi Bacharach konsequent falsch geschrieben. Die Beckmesserei soll die historiographische Leistung des Autors nicht schmälern. Das Buch ist anregend, wichtig und provozierend. Das sind für einen Text über Historiker und über die Geschichtswissenschaft entscheidende Meriten.
Professor Wolfgang Benz leitet in Berlin das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität.